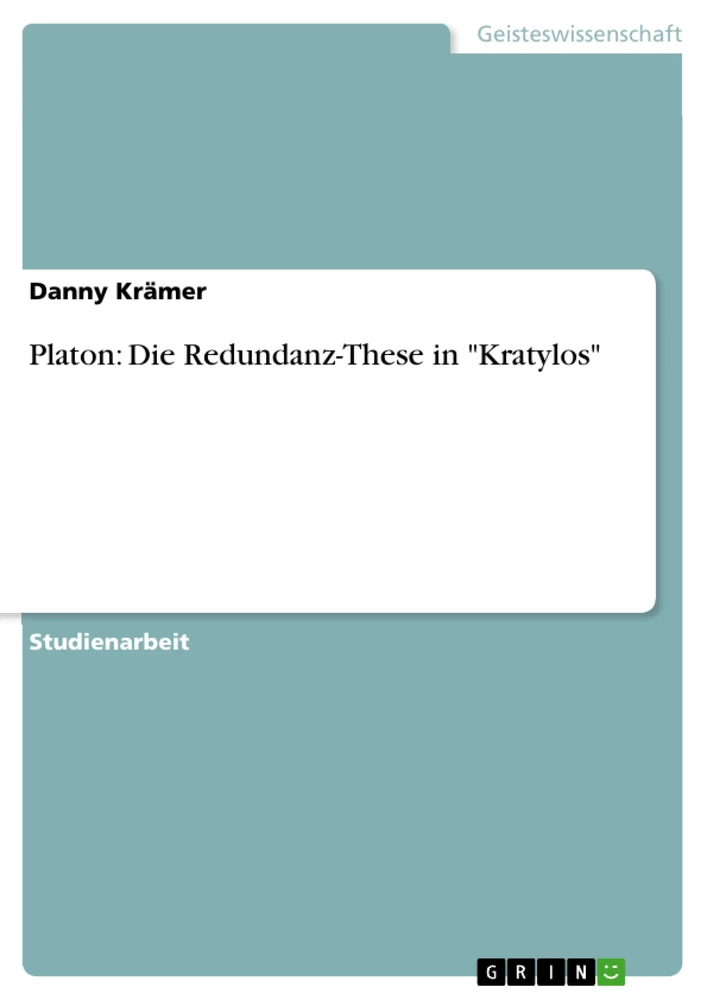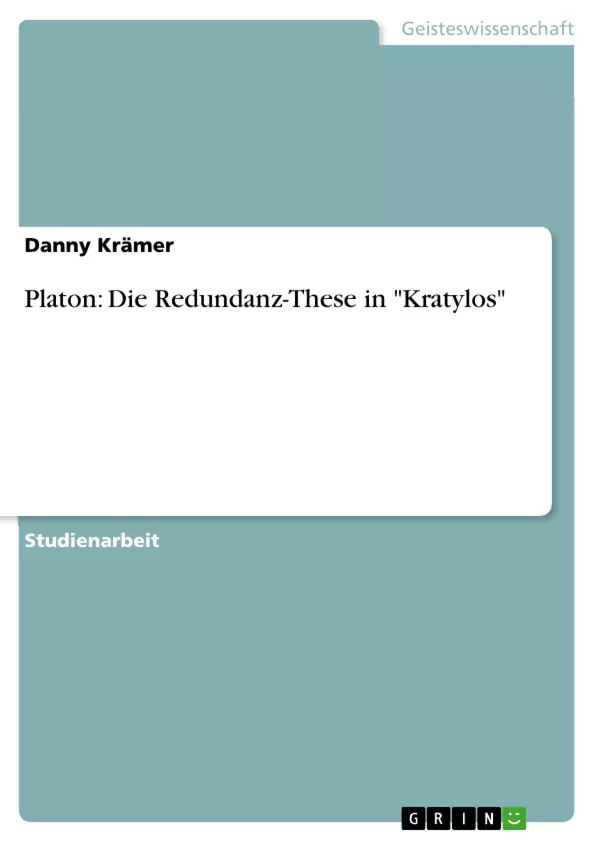Platons Kratylos ist einer der schwierigsten Dialoge. Er ist vielschichtig und voller Anspielungen und Kritik von Zeitgenossen. Außerdem ist er gespickt mit Ironie, was es schwer macht zu erkennen, welche Ansichten Platons Sokrates nun ernst meint und welche nicht. Trotzdem ist er einer der aktuellsten Dialoge, da er wichtige Themen wie Wahrheit, Relativismus, Privatsprache usw. behandelt. Platon bietet dem Leser keine Lösung des Problems, sondern lässt ihn selbst weiter denken. Diese Arbeit versucht einen roten Faden durch den Dialog zu finden. Die Behauptung ist, dass Platon eine bestimmte These kritisiert, die sowohl Kratylos, Hermogenes, als auch andere zeitgenössische Philosophen akzeptieren, die allerdings eine philosophische Betrachtung von Sprache und Welt unmöglich machen. Es wird nicht behauptet, dass dies die einzige oder wichtigste These im Kratylos ist. Aber sie bietet einen Weg, die Struktur des Dialogs besser zu verstehen und einige dunkle Stellen zu erhellen. Platons Dialoge lassen sich nicht verstehen, wenn man nicht betrachtet, welche Personen in ihnen vorkommen. Deswegen wird es eine Vorstellung der Personen geben, die, auf Grund des Umfangs der Arbeit, kurz ausfällt. In der Sekundärliteratur gibt es viel darüber zu lesen. Anschließend wird die besagte These vorgestellt. Der Dialog wird nicht detailliert auseinandergenommen, das haben andere bereits getan. Stattdessen wird versucht zu zeigen, wo die These zu finden ist, welche Folgen sie mit sich zieht und wie Platon sie widerlegt. Diese Arbeit hofft so, eine neue Art den Dialog zu lesen anzuregen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charaktere
- Hermogenes
- Kratylos
- Die Redundanz-These
- Hermogenes' Konventionalismus
- Hermogenes' These
- Widerlegung des Hermogenes
- Darstellung des Naturalismus
- Die Etymologien
- Kratylos' These
- Widerlegung der These des Kratylos
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Platons Kratylos-Dialog und konzentriert sich auf die Kritik einer spezifischen These, die sowohl von Hermogenes als auch Kratylos vertreten wird. Das Hauptziel ist es, einen roten Faden durch den komplexen Dialog zu ziehen und die Struktur des Textes durch die Untersuchung dieser These zu verdeutlichen. Die Arbeit argumentiert, dass diese These eine philosophische Betrachtung von Sprache und Welt unmöglich macht.
- Kritik der Redundanz-These in Platons Kratylos
- Vergleich des Konventionalismus von Hermogenes und des Naturalismus von Kratylos
- Die Auswirkungen der These auf die Möglichkeit philosophischer Betrachtung
- Analyse der Argumentationsstruktur im Kratylos-Dialog
- Die Rolle von Sokrates in der Widerlegung der These
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kratylos-Dialog als schwierig und vielschichtig, voller Anspielungen und Ironie. Sie benennt das Hauptanliegen der Arbeit: die Analyse einer These, die von den Dialogteilnehmern vertreten wird und die eine philosophische Betrachtung von Sprache und Welt unmöglich macht. Es wird betont, dass diese These nicht als die einzige oder wichtigste im Dialog betrachtet wird, sondern als ein Schlüssel zum Verständnis der Struktur und einiger dunkler Stellen.
Charaktere: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Dialogfiguren, Hermogenes und Kratylos, kurz vor. Hermogenes wird als wohlhabender Athener und enger Vertrauter Sokrates beschrieben, der einen Konventionalismus vertritt. Kratylos wird als radikaler Herakliteer und junger Athener dargestellt, der einen Naturalismus vertritt. Die kurzen Charakterbeschreibungen dienen als Grundlage für das Verständnis ihrer jeweiligen Positionen in der Debatte um die Benennung.
Die Redundanz-These: Dieses Kapitel führt die zentrale These der Arbeit ein: die Redundanz-These. Diese besagt, dass der Name eines Gegenstandes nur dann ein korrekter Name ist, wenn er tatsächlich der Gegenstand ist; ansonsten ist es kein Name. Die Arbeit argumentiert, dass sowohl Hermogenes als auch Kratylos dieser These zustimmen, obwohl sie unterschiedliche Positionen (Konventionalismus vs. Naturalismus) vertreten. Der Fokus liegt darauf, wie Sokrates diese These widerlegt, indem er zeigt, dass sie die Philosophie unmöglich macht.
Hermogenes' Konventionalismus: Dieses Kapitel behandelt Hermogenes' konventionalistische Position bezüglich der Benennung. Es erläutert seine These und wie Sokrates diese widerlegt, indem er aufzeigt, dass sie zu einer Unmöglichkeit philosophischer Betrachtung führt. Der Abschnitt verdeutlicht die Konsequenzen von Hermogenes' Ansatz für die sprachphilosophische Debatte im Kratylos.
Darstellung des Naturalismus: Dieses Kapitel analysiert Kratylos' naturalistischen Standpunkt. Es beschreibt seine These und wie sie, trotz ihres scheinbaren Gegenteils zu Hermogenes' Position, zu denselben problematischen Konsequenzen führt, die Sokrates kritisiert. Die Verbindung zwischen Kratylos' Heraklitismus und der Redundanz-These wird hier detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Platon, Kratylos, Redundanz-These, Konventionalismus, Naturalismus, Hermogenes, Kratylos, Benennung, Sprache, Philosophie, Sokrates, Widerlegung, Heraklit.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Platon-Dialog "Kratylos"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Kratylos-Dialog, konzentriert sich auf eine zentrale These (die "Redundanz-These"), die sowohl von Hermogenes als auch Kratylos vertreten wird, und untersucht deren Auswirkungen auf die philosophische Betrachtung von Sprache und Welt. Die Arbeit verfolgt den roten Faden dieser These durch den komplexen Dialog und beleuchtet die Struktur des Textes anhand ihrer Kritik.
Welche Hauptfiguren werden im Kratylos behandelt und welche Positionen vertreten sie?
Die Hauptfiguren sind Hermogenes, ein wohlhabender Athener und Vertrauter Sokrates, der einen konventionalistischen Standpunkt vertritt, und Kratylos, ein junger, radikaler Herakliteer, der einen naturalistischen Ansatz verfolgt. Beide vertreten, entgegen ihrer unterschiedlichen Ansätze, implizit die "Redundanz-These".
Was ist die "Redundanz-These" und warum ist sie zentral für diese Arbeit?
Die "Redundanz-These" besagt, dass ein Name nur dann korrekt ist, wenn er den Gegenstand selbst ist. Die Arbeit argumentiert, dass diese These, die von beiden Hauptfiguren vertreten wird, eine philosophische Betrachtung von Sprache und Welt unmöglich macht. Die Widerlegung dieser These durch Sokrates ist der zentrale Punkt der Analyse.
Wie wird Hermogenes' Konventionalismus behandelt?
Die Arbeit erläutert Hermogenes' konventionalistische These zur Benennung und analysiert, wie Sokrates diese widerlegt, indem er ihre unvereinbaren Konsequenzen für die philosophische Betrachtung aufzeigt. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieses Ansatzes auf die sprachphilosophische Debatte im Kratylos.
Wie wird Kratylos' Naturalismus dargestellt?
Die Analyse von Kratylos' naturalistischem Standpunkt zeigt, dass seine These, obwohl scheinbar entgegengesetzt zu Hermogenes' Position, zu denselben problematischen Konsequenzen führt, die Sokrates kritisiert. Die Verbindung zwischen Kratylos' Heraklitismus und der "Redundanz-These" wird detailliert untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was sind deren Inhalte?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den Charakteren (Hermogenes und Kratylos), die detaillierte Erläuterung der "Redundanz-These", Kapitel zu Hermogenes' Konventionalismus und Kratylos' Naturalismus, sowie ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert Aspekte des Dialogs im Kontext der zentralen These.
Welche Ziele verfolgt diese Arbeit?
Die Hauptziele sind die Analyse der "Redundanz-These" im Kratylos-Dialog, der Vergleich des Konventionalismus von Hermogenes und des Naturalismus von Kratylos, die Untersuchung der Auswirkungen dieser These auf die philosophische Betrachtung, die Analyse der Argumentationsstruktur des Dialogs und die Rolle Sokrates bei der Widerlegung der These.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind Platon, Kratylos, Redundanz-These, Konventionalismus, Naturalismus, Hermogenes, Kratylos, Benennung, Sprache, Philosophie, Sokrates, Widerlegung, Heraklit.
- Arbeit zitieren
- Danny Krämer (Autor:in), 2013, Platon: Die Redundanz-These in "Kratylos", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274710