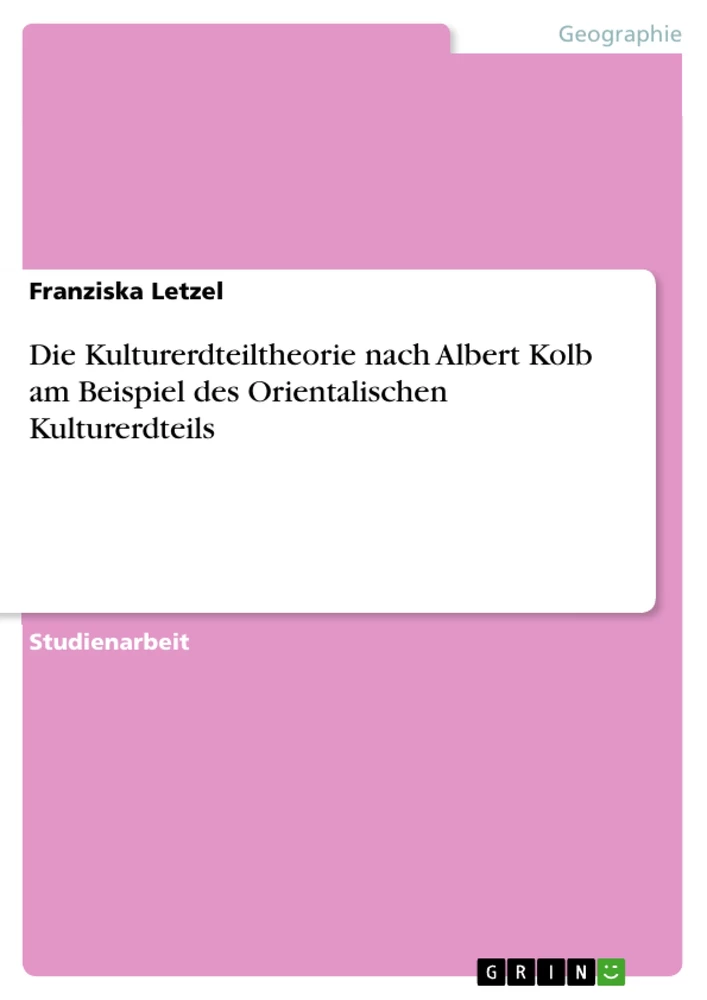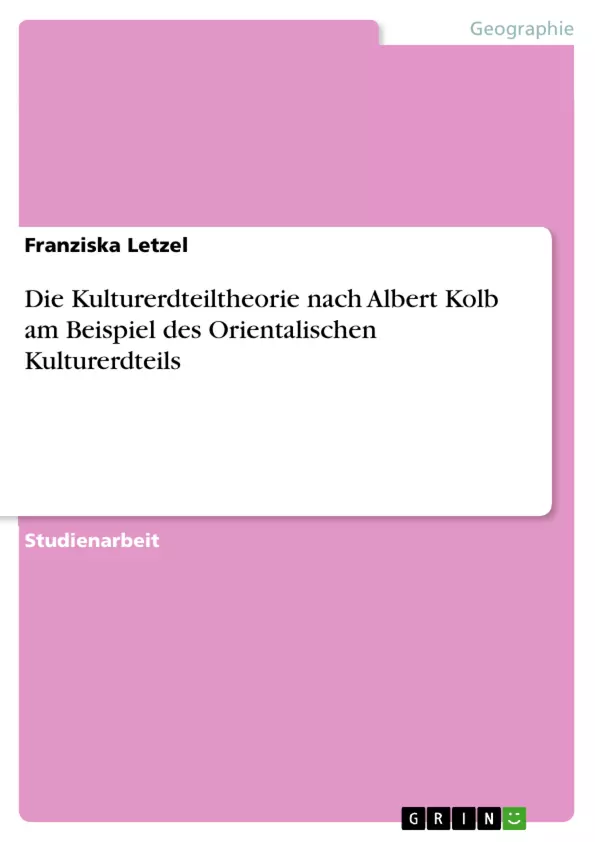Die Region des Nahen Ostens und Nordafrikas ist gegenwärtig ein Raum, der international mit dauerhaft großem Interesse betrachtet wird, insbesondere durch die Zuspitzung der politischen Lage in Israel, den Bewegungen des Arabischen Frühlings und dem anhaltenden syrischen Bürgerkrieg. Vom Orient als „Pulverfass“ wird in diesem Zusammenhang häufig gesprochen. Doch ist es überhaupt noch angemessen, die Region mit dem eher traditionellen Begriff „Orient“ zu bezeichnen? Hier gehen die Meinungen sowohl zwischen Alltags- und Wissenschaftsdenken, als auch innerhalb der geographischen Forschung weit auseinander. Spricht man nun von Morgenland, Orient, Nahem Osten oder orientalischem Kulturerdteil? Oder ist die Bezeichnung der Region als „Islamischer Kulturerdteil“ viel zutreffender? Nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Kontroversen um Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen der Region erscheint es von hohem Wert, sich mit diesem geographischen Raum eingehender zu befassen. Um eine möglichst ganzheitliche Betrachtung der Region zu ermöglichen und dabei sowohl naturräumliche als auch kulturelle Elemente in den Blick zu nehmen, liegt der vorliegenden Arbeit das Konzept der Kulturerdteile zugrunde.
Was aber ist nun das Besondere am Orient als Kulturerdteil? Für welche Merkmale, Ideen und Besonderheiten steht der Kulturerdteil und was unterscheidet ihn von angrenzenden Räumen?
Eben jene Fragen stehen im Fokus der vorliegenden Projektarbeit. Um deren Beantwortung zielführend zu realisieren, erfolgt zunächst eine separate Betrachtung ausgewählter Merkmalskomplexe, anhand derer die zentralen Eigenheiten des Orientalischen Kulturerdteils herausgestellt werden. Die Analyse folgt dabei dem Kulturerdteilkonzept von Albert Kolb, der insgesamt fünf Merkmalskomplexe unterscheidet, die demgemäß auch der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen: (1) Geschichte und Kultur, (2) Raum und Umwelt, (3) Menschen und Bevölkerung, (4) Leitsystem und Religion und (5) Wirtschaft und Infrastruktur. Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung der spezifischen Strukturqualität des Orientalischen Kulturerdteils, indem bestimmte Merkmalskomplexe miteinander verknüpft und deren Interdependenzen aufgezeigt werden. Abgerundet wird die vorliegende Arbeit durch ein abschließendes Fazit, welches die zentralen Ergebnisse der Analyse noch einmal zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die fünf Merkmalskomplexe nach KOLB
- Geschichte und Kultur
- Raum und Umwelt
- Menschen und Bevölkerung
- Leitsystem und Religion
- Wirtschaft und Infrastruktur
- Verknüpfung der Merkmalskomplexe
- Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem orientalischen Kulturerdteil und analysiert dessen spezifische Merkmale und Besonderheiten. Sie verfolgt das Ziel, eine umfassende Betrachtung des Raumes zu ermöglichen, indem sie sowohl naturräumliche als auch kulturelle Elemente in den Blick nimmt. Die Arbeit basiert auf dem Kulturerdteilkonzept von Albert Kolb, der den Orient als einen von insgesamt zehn Kulturerdteilen ausweist.
- Geschichte und Kultur des orientalischen Kulturerdteils
- Raum und Umwelt des orientalischen Kulturerdteils
- Bevölkerungsstruktur und -entwicklung im orientalischen Kulturerdteil
- Das Leitsystem und die Religionen im orientalischen Kulturerdteil
- Wirtschaft und Infrastruktur des orientalischen Kulturerdteils
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel 2.1 „Geschichte und Kultur" beleuchtet die Entwicklungen im orientalischen Kulturerdteil, der als Wiege der Zivilisation gilt. Es werden die Entstehung erster Hochkulturen, die Entwicklung der Schrift und die Entstehung der drei monotheistischen Religionen Judentum, Islam und Christentum dargestellt. Außerdem werden die Auswirkungen der Religionen auf die Herrschaftsformen und die Staatsbildungsprozesse im Orient behandelt.
Das Kapitel 2.2 „Raum und Umwelt" beschreibt die klimatischen und naturräumlichen Bedingungen des orientalischen Kulturerdteils. Es werden die typischen Vegetationsformen, die Bedeutung des Wassers und die Auswirkungen der Aridität auf die Nutzung und die Wirtschaftsweise des Raumes erläutert.
Das Kapitel 2.3 „Menschen und Bevölkerung" analysiert die Bevölkerungsstruktur und -entwicklung im orientalischen Kulturerdteil. Es werden die Auswirkungen des Wassermangels auf die Siedlungsstruktur und die Konflikte zwischen Sesshaften und Nichtsesshaften thematisiert. Außerdem werden die Folgen des Bevölkerungswachstums für die öffentliche Infrastruktur und die Herausforderungen der Urbanisierung im Orient dargestellt.
Das Kapitel 2.4 „Leitsystem und Religion" untersucht die ethnische und religiöse Vielfalt des orientalischen Kulturerdteils. Es werden die Auswirkungen der Religionen auf die Gesellschaftsstruktur, die Rolle des Islam als normative Ordnung und die Herausforderungen der patriarchalischen Gesellschaftsstruktur im Orient behandelt.
Das Kapitel 2.5 „Wirtschaft und Infrastruktur" analysiert die Wirtschaftsstruktur des orientalischen Kulturerdteils. Es werden die Bedeutung der Erdölindustrie, die Rolle der Landwirtschaft und des Tourismus sowie die Herausforderungen des Rentenkapitalismus im Orient dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den orientalischen Kulturerdteil, die Kulturerdteiltheorie nach Kolb, die Orientalische Trilogie, die Aridität, die Wasserknappheit, die Bevölkerungsentwicklung, die Urbanisierung, die Religionen, die Gesellschaftsstruktur, die Wirtschaft und die Herausforderungen der Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Kulturerdteiltheorie nach Albert Kolb?
Die Theorie teilt die Welt in zehn Kulturerdteile ein, die jeweils durch spezifische Merkmale in Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Religion definiert sind.
Welche fünf Merkmalskomplexe werden untersucht?
Die Analyse umfasst: 1. Geschichte und Kultur, 2. Raum und Umwelt, 3. Menschen und Bevölkerung, 4. Leitsystem und Religion sowie 5. Wirtschaft und Infrastruktur.
Was ist das Besondere am Orientalischen Kulturerdteil?
Er gilt als Wiege der Zivilisation und ist geprägt durch Aridität (Trockenheit), die "Orientalische Trilogie" (Stadt, Dorf, Nomaden) und den Islam als prägendes Leitsystem.
Wie beeinflusst Wasserknappheit die Region?
Die Aridität bestimmt die Siedlungsmuster, führt zu Konflikten zwischen sesshaften und nicht-sesshaften Gruppen und stellt eine enorme Herausforderung für die Landwirtschaft dar.
Welche Rolle spielt der Rentenkapitalismus im Orient?
Der Rentenkapitalismus beschreibt eine Wirtschaftsform, bei der Einkommen primär aus Ressourcen (wie Erdöl) oder Besitz statt aus produktiver Arbeit erzielt werden.
- Quote paper
- Franziska Letzel (Author), 2014, Die Kulturerdteiltheorie nach Albert Kolb am Beispiel des Orientalischen Kulturerdteils, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274794