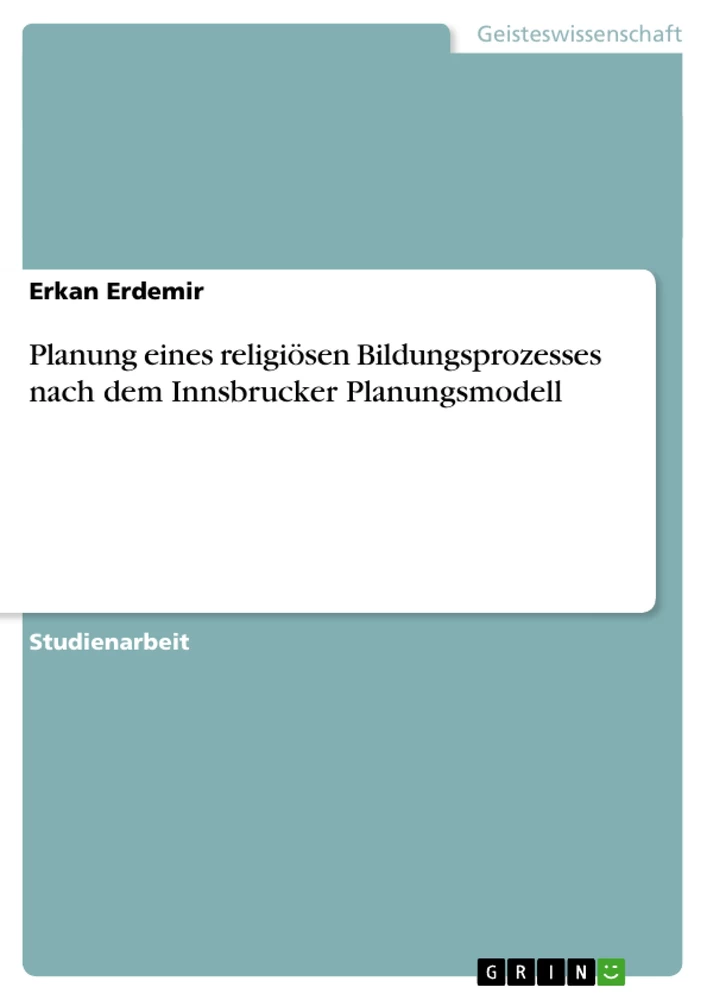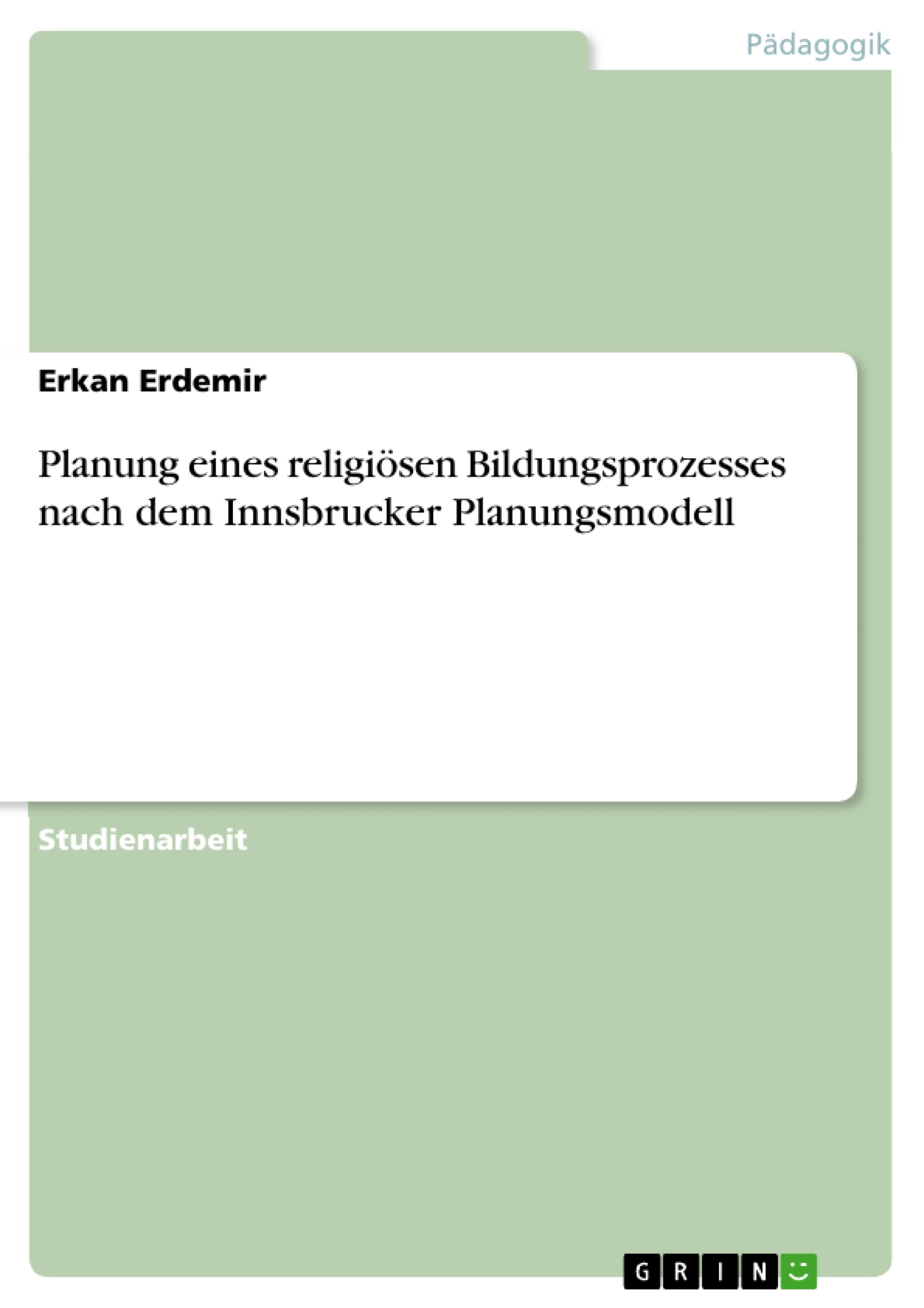Die Seminararbeit besteht aus zwei Teilen.
Im ersten Teil sollen wir ein religiöses Bildungsprozess nach dem Innsbrucker Planungsmodell planen und reflektieren. Dabei werde ich eine Einzelplanung im Bereich Schule vornehmen. Vorbereiten werde für die Hauptschule 5. Jahrgangsstufe für den islamischen Religionsunterricht (IRU) das Thema "Prophetengeschichten". Folgende Themenüberschriften sind dabei angedacht: „Noah und die Sintflut, Moses und das Volk Israel und Jesus, Sohn von Maria.“ Konkret werde ich aber nur eine Unterrichtsstunde durchplanen. Die im Lehrplan angegebenen Anliegen und Ziele in Bezug auf das Thema „Prophetengeschichten“ sind wie folgt:
„Der Glaube (Iman) an die Propheten
Jede Muslimin und jeder Muslim verinnerlicht den Iman an alle Propheten – ohne Unterschied: „Wir machen keinen Unterschied bei keinem Seiner Gesandten.“ (Baqara 2/285, vgl. auch an-Nisa 4/164; al-An’am 6/83-90; Hud 11/120 etc. sowie die Ahadith bei Bukhari, Muslim, Ahmad u.a.)
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit der Frage beschäftigen, warum überhaupt Propheten gesandt wurden, was ihre Eigenschaften waren, ihre Aufgaben, ihre Namen etc. Die Unterschiede zwischen Rasul (Gesandter) und Nabiy (Prophet) sollen in diesem Kontext ebenso thematisiert werden wie die Entscheidungskraft der sogenannten Ulul-Azm und andere wesentliche Themen der Prophetenschaft, wie etwa die Frage, ob zu jeder Ummah ein Gesandter geschickt wurde. (vgl. al-Fatir 35/24)
- Was ist ein Prophet?
- Der Unterschied zwischen einem Gesandtem und einem Propheten
- Eigenschaften, Aufgaben, Zahl und Namen der Propheten
- Ulul-Azm von den Gesandten und Propheten
- Für jede Gemeinschaft gibt es einen Gesandten“
Im zweiten Teil der Seminararbeit wird die Planung für die im Team gestaltete Seminareinheit beschrieben und reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- A) Planung eines religiösen Bildungsprozess nach dem Innsbrucker Planungsmodell
- Theologisch-Didaktische Orientierung
- 1.1. Analyse der einzelnen Perspektiven
- 1.1.1. Subjektiv-Biographische Perspektive (ICH)
- 1.1.1_1. Mein Bezug zur gewählten Thematik
- 1.1.1_2. Welchen Bezug haben die TeilnehmerInnen zu meiner Thematik?
- 1.1.2. Intersubjektiv-Kommunikative Perspektive (WIR)
- 1.1.2_1. Bin ich/wann bin ich (eher) Leiter vor/ für/mit den SchülerInnen TeilnehmerInnen?
- 1.1.2_2. Welche Sozialstrukturen (Peergroups, Paare, Experten, Außenseiter, _ gibt es in der Gruppe? Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Sache?
- 1.1.2_3. Wie/wodurch wird die „Sache" in der Interaktion zwischen den Teilnehmenden repräsentiert?
- 1.1.2_4. Wie/wodurch wird die „Sache" in der Interaktion zwischen Leiter und Teilnehmenden repräsentiert?
- 1.1.3. Sachlich-Inhaltlich-Symbolische Perspektive (ES)
- 1.1.3_1. Woher weiß ich von der Sache (Studium, Bücher,___) und was gibt es davon zu wissen?
- 1.1.3_2. Was bedeutet die Sache in der Vergangenheit; gegenwärtig und zukünftig?
- 1.1.3_3. Was an der Sache ist besonders sperrig, unzugänglich, verwirrend?
- 1.1.3_4. Was ist der Kern der Sache? Was ist elementar, essentiell/existentiell und was ist Hilfswissen?
- 1.1.3_5. Welche menschlichen, religiösen Grundeffahrungen kommen in der ThematiWim Text zum Ausdruck?
- 1.1.3_6. An welchen Beispielen, Symbolen, _ wird die Sache zugänglich?
- 1.1.4. Kontextperspektive (Globe)
- 1.2. Anliegen I Anforderungssituationen I Kompetenzen
- 1.2.1. Anliegen (Ziele formulieren)
- 1.2.2. Anforderungssituationen
- 1.2.3. Kompetenzen
- 2. Prozessplanung
- B) Beschreibung der Planung und Reflexion der im Team gestalteten Seminareinheit
- Theologisch-Didaktische Orientierung
- 1.1. Analyse der einzelnen Perspektiven
- 1.1.1. Subjektiv-Biographische Perspektive
- 1.1.1_1. Mein Bezug zur gewählten Thematik
- 1.1.1_2. Welchen Bezug haben die TeilnehmerInnen zu meiner Thematik?
- 1.1.2. Intersubjektiv-Kommunikative Perspektive
- 1.1.2_1. Bin ich/wann bin ich (eher) Leiter vor/ für/mit den SchülerInnen TeilnehmerInnen?
- 1.1.2_2. Welche Sozialstrukturen (Peergroups, Paare, Experten, Außenseiter, _ gibt es in der Gruppe? Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Sache?
- 1.1.2_3. Wie/wodurch wird die „Sache" in der Interaktion zwischen den Teilnehmenden repräsentiert?
- 1.1.2_4. Wie/wodurch wird die „Sache" in der Interaktion zwischen Leiter und Teilnehmenden repräsentiert?
- 1.1.3. Sachlich-Inhaltlich-Symbolische Perspektive
- 1.1.3_1. Woher weiß ich von der Sache (Studium, Bücher,___) und was gibt es davon zu wissen?
- 1.1.3_2. Was bedeutet die Sache in der Vergangenheit; gegenwärtig und zukünftig?
- 1.1.3_3. Was an der Sache ist besonders sperrig, unzugänglich, verwirrend?
- 1.1.3_4. Was ist der Kern der Sache? Was ist elementar, essentiell/existentiell und was ist Hilfswissen?
- 1.1.3_5. Welche menschlichen, religiösen Grundeffahrungen kommen in der Thematik/Im Text zum Ausdruck?
- 1.1.3_6. An welchen Beispielen, Symbolen, _ wird die Sache zugänglich?
- 1.1.4. Kontextperspektive (Globe)
- 1.2. Anliegen I Anforderungssituationen I Kompetenzen
- 1.2.1. Anliegen (Ziele formulieren)
- 1.2.2. Anforderungssituationen
- 1.2.3. Kompetenzen
- 2. Prozessplanung
- 3. Reflexion
- Schlussgedanken
- Literaturverzeichnis
- Die Anwendung des Innsbrucker Planungsmodells in der Praxis
- Die Analyse und Reflexion von Perspektiven im Bildungsprozess
- Die Didaktik des islamischen Religionsunterrichts
- Die Bedeutung von Prophetengeschichten in der islamischen Religion
- Die Arbeit mit islamischen Quellen-Texten im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Planung und Reflexion eines religiösen Bildungsprozesses im Bereich der Islamischen Religionspädagogik. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung des Innsbrucker Planungsmodells, einem didaktischen Modell für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten. Der erste Teil der Arbeit analysiert die einzelnen Perspektiven des Modells anhand des Themas "Prophetengeschichten" im islamischen Religionsunterricht der Hauptschule. Der zweite Teil beschreibt und reflektiert die Planung und Durchführung einer Seminareinheit zum Thema "Methoden zur Arbeit mit islamischen Quellen-Texten", die im Team mit einem Kommilitonen gestaltet wurde.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Seminararbeit widmet sich der Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema "Prophetengeschichten" im islamischen Religionsunterricht der Hauptschule. Dabei wird das Innsbrucker Planungsmodell Schritt für Schritt angewendet. Die einzelnen Perspektiven des Modells, die Subjektiv-Biographische Perspektive (ICH), die Intersubjektiv-Kommunikative Perspektive (WIR), die Sachlich-Inhaltlich-Symbolische Perspektive (ES) und die Kontextperspektive (Globe), werden detailliert analysiert. Die Arbeit beleuchtet dabei den persönlichen Bezug des Autors zum Thema, die Vorkenntnisse der Schüler, die Sozialstrukturen in der Klasse, die Inhalte und Methoden des Unterrichts sowie die Rahmenbedingungen der Schule. Anschließend werden die Anliegen, Anforderungssituationen und Kompetenzen für die Unterrichtseinheit formuliert.
Im zweiten Teil der Arbeit wird die Planung und Durchführung einer Seminareinheit zum Thema "Methoden zur Arbeit mit islamischen Quellen-Texten" beschrieben und reflektiert. Die Seminareinheit wurde im Team mit einem Kommilitonen gestaltet und an der Universität Innsbruck durchgeführt. Auch hier werden die einzelnen Perspektiven des Innsbrucker Planungsmodells analysiert, wobei der Fokus auf die besonderen Herausforderungen liegt, die sich aus der interreligiösen Zusammensetzung der Seminarteilnehmer ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Methoden und Sozialformen, die in der Seminareinheit eingesetzt wurden, sowie die Reflexion der Durchführung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Innsbrucker Planungsmodell, die Islamische Religionspädagogik, den islamischen Religionsunterricht, Prophetengeschichten, Methoden zur Arbeit mit islamischen Quellen-Texten, die Didaktik des Religionsunterrichts, die Analyse von Perspektiven im Bildungsprozess sowie die Reflexion von Unterrichtseinheiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Innsbrucker Planungsmodell?
Es ist ein didaktisches Modell zur Planung religiöser Bildungsprozesse, das verschiedene Perspektiven wie ICH, WIR, ES und GLOBE einbezieht.
Welches Thema wird im islamischen Religionsunterricht (IRU) geplant?
Die Arbeit befasst sich mit der Planung einer Unterrichtsstunde zum Thema „Prophetengeschichten“ für die 5. Jahrgangsstufe.
Was ist der Unterschied zwischen Rasul und Nabiy?
Im islamischen Kontext bezeichnet Rasul einen Gesandten mit einer neuen Offenbarung, während Nabiy allgemein einen Propheten bezeichnet.
Was beinhaltet die „Sachlich-Inhaltliche Perspektive“ (ES)?
Sie analysiert den Kern der Sache, das notwendige Hilfswissen und die religiösen Grunderfahrungen, die im Text zum Ausdruck kommen.
Wie werden islamische Quellentexte im Unterricht methodisch bearbeitet?
Die Arbeit reflektiert den Einsatz spezifischer Methoden, um Schülern den Zugang zu komplexen religiösen Originaltexten zu erleichtern.
- Quote paper
- Erkan Erdemir (Author), 2013, Planung eines religiösen Bildungsprozesses nach dem Innsbrucker Planungsmodell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274830