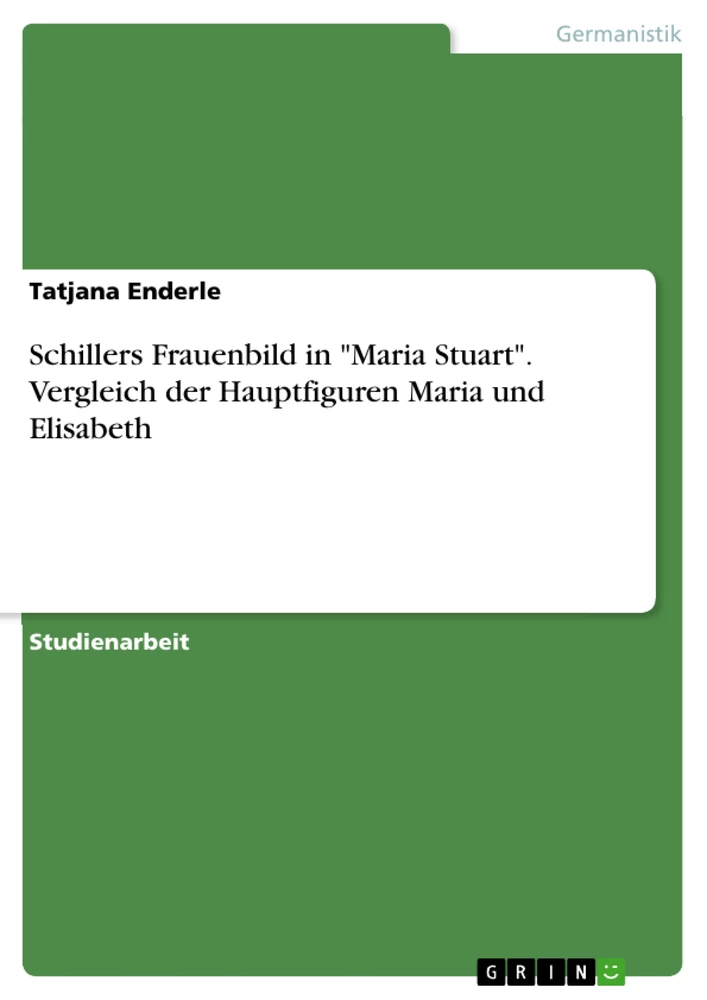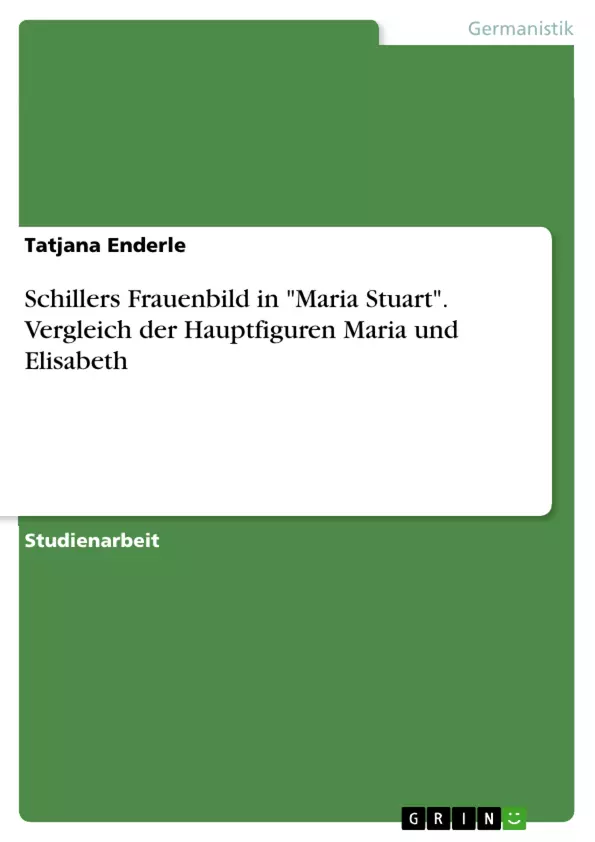Maria und Elisabeth – sind sie in ihrem Charakter absolut gegensätzlich?
Ich möchte aufzeigen, dass in den beiden Hauptfiguren, die beide als Frau ein politisches Amt ausübten, zwei völlig verschiedene Frauenbilder aufgezeigt wurden.
Auch dass sich die Charaktere der Frauen im Laufe des Dramas ändern, möchte ich am Text darlegen. Maria, die anfangs einsam und ohnmächtig ist, wird am Ende zumindest in moralischer Hinsicht über Elisabeth siegen. Die zu Beginn festgelegte Schuld wird sich immer weiter relativieren, sodass sie am Ende mit einer reinen Seele stirbt - so meine These.
Ebenso kontrastreich wie die Frauen selbst stehen beide auch konträr zu dem üblichen Frauenbild, das Schiller vertrat. Dies gilt in der folgenden Arbeit zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schillers Frauenbild
- Die Königinnen: Maria und Elisabeth
- Beginn: Schuld und Macht
- Maria
- Elisabeth
- Maria vs. Elisabeth - der dritte Akt
- Der Tod der Königin
- Beginn: Schuld und Macht
- Schluss
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Frauenbild in Schillers Drama "Maria Stuart". Die Arbeit untersucht, wie Schiller die Charaktere der beiden Königinnen Maria und Elisabeth darstellt, und wie diese Darstellungen zu seinem allgemeinen Frauenbild in Beziehung stehen. Zudem wird untersucht, ob sich die Charaktere der beiden Frauen im Laufe des Dramas verändern und wie diese Veränderungen mit der Frage nach Schuld und Macht zusammenhängen.
- Schillers Frauenbild im Vergleich zu den Königinnen Maria und Elisabeth
- Die Darstellung von Schuld und Macht bei den beiden Königinnen
- Die Entwicklung der Charaktere von Maria und Elisabeth im Laufe des Dramas
- Die Rolle der Liebe und Leidenschaft im Kontext des Frauenbildes
- Die Frage nach der Vereinbarkeit von Weiblichkeit und politischem Amt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, dass Schiller in "Maria Stuart" ein abweichendes Frauenbild präsentiert, das sich von seinen anderen Werken unterscheidet. Sie führt die beiden Hauptfiguren Maria und Elisabeth ein und stellt die Frage, ob sie in ihrem Charakter gegensätzlich sind. Die Einleitung legt zudem dar, dass sich die Charaktere der Frauen im Laufe des Dramas verändern.
Das zweite Kapitel analysiert Schillers allgemeines Frauenbild, das in seinen anderen Werken deutlich wird. Dabei werden die typischen Eigenschaften von Frauen in Schillers Werken beschrieben, wie Häuslichkeit, bürgerliche Tugendhaftigkeit, Milde und Zärtlichkeit. Der Gegensatz zwischen Mann und Frau wird beleuchtet, wobei der Mann als stark, politisch engagiert und mutig dargestellt wird, während die Frau ihre Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter erfüllen soll. Die weibliche Schönheit wird als ein Ideal der "schönen Seele" definiert, das sich durch perfekte sittliche Empfindungen auszeichnet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den beiden Königinnen Maria und Elisabeth. Es wird untersucht, ob sich ihre Charaktere im Laufe des Dramas verändern und ob sie als Repräsentantinnen eines anderen Frauenbildes betrachtet werden können. Der Fokus liegt auf der Frage nach Schuld und Macht und wie diese Aspekte in der Darstellung der beiden Königinnen zum Ausdruck kommen.
Im Unterkapitel 3.1 wird der Beginn des Dramas untersucht. Maria wird als eine verlassene, eingesperrte Frau dargestellt, die jedoch nicht unterschätzt werden darf. Ihre Schuld wird zwar angedeutet, jedoch auch von ihrer Amme Kennedy verteidigt, die sie als Opfer ungünstiger Verstrickungen sieht. Elisabeth wird als die Königin von England dargestellt, die alle Fäden in der Hand hält und sich ihrer Rolle als Königin vollkommen hingibt, dabei aber die Rolle als Frau abzulegen versucht. Der Konflikt zwischen Weiblichkeit und den Pflichten einer Königin wird deutlich.
Das Unterkapitel 3.2 befasst sich mit dem Treffen von Maria und Elisabeth im dritten Akt. Dieser Dialog ist der Wendepunkt des Dramas und zeigt die unterschiedlichen Charaktere der beiden Frauen deutlich. Maria ist zunächst unsicher und ängstlich, während Elisabeth ihr gegenüber kalt und hart wirkt. Maria versucht durch Überredungskunst Gnade von Elisabeth zu erlangen, doch diese bleibt unnachgiebig. Im Laufe des Dialogs entwickelt sich ein Kampf um die weibliche Ehre und die politische Macht. Maria gelingt es, Elisabeth zu demütigen und ihre eigene Ehre zu bewahren.
Das Unterkapitel 3.3 behandelt den Tod der Maria. Es wird gezeigt, dass Maria sich im Laufe des Dramas zu einer "reinen Seele" entwickelt hat. Sie ist bereit, ihr Leben auf der Welt abzuschließen und in das Himmelreich überzutreten. Elisabeth hingegen kämpft weiterhin mit Zerrissenheit und kann sich nicht über den Tod Marias hinwegsetzen. Sie scheitert sowohl als Königin als auch als Frau.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Frauenbild, Maria Stuart, Elisabeth, Schuld, Macht, Weiblichkeit, politisches Amt, Liebe, Leidenschaft, Charakterentwicklung, Drama, Theater, Schiller, Literatur, Geschichte, und die "reine Seele".
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Schillers allgemeines Frauenbild von den Figuren in Maria Stuart?
Während Schiller in vielen Werken ein Ideal der häuslichen, milden und tugendhaften Frau vertrat, zeigt er in Maria Stuart zwei Frauen in politischen Machtpositionen, die mit dem Konflikt zwischen Weiblichkeit und Staatsräson kämpfen.
Welche Rolle spielt die Charakterentwicklung bei Maria Stuart?
Maria entwickelt sich im Laufe des Dramas von einer anfangs ohnmächtigen Gefangenen zu einer "reinen Seele". Am Ende siegt sie moralisch über Elisabeth, indem sie ihre Schuld akzeptiert und gefasst in den Tod geht.
Wie wird Elisabeth im Vergleich zu Maria dargestellt?
Elisabeth wird als mächtige Königin von England dargestellt, die jedoch innerlich zerrissen ist. Sie versucht, ihre Weiblichkeit zugunsten ihres Amtes abzulegen, scheitert jedoch am Ende sowohl als Herrscherin als auch als Frau an ihrer eigenen Unentschlossenheit.
Was passiert beim Aufeinandertreffen der Königinnen im dritten Akt?
Das Treffen ist der Wendepunkt des Dramas. Es eskaliert in einem Kampf um weibliche Ehre und politische Macht, bei dem Maria Elisabeth demütigt, was letztlich ihr Todesurteil besiegelt, aber ihre moralische Überlegenheit festigt.
Was versteht Schiller unter einer "schönen Seele"?
Die "schöne Seele" ist ein Ideal, bei dem Pflicht und Neigung im Einklang stehen und sich durch perfekte sittliche Empfindungen auszeichnen – ein Zustand, den Maria Stuart vor ihrem Tod erreicht.
- Quote paper
- Tatjana Enderle (Author), 2012, Schillers Frauenbild in "Maria Stuart". Vergleich der Hauptfiguren Maria und Elisabeth, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274984