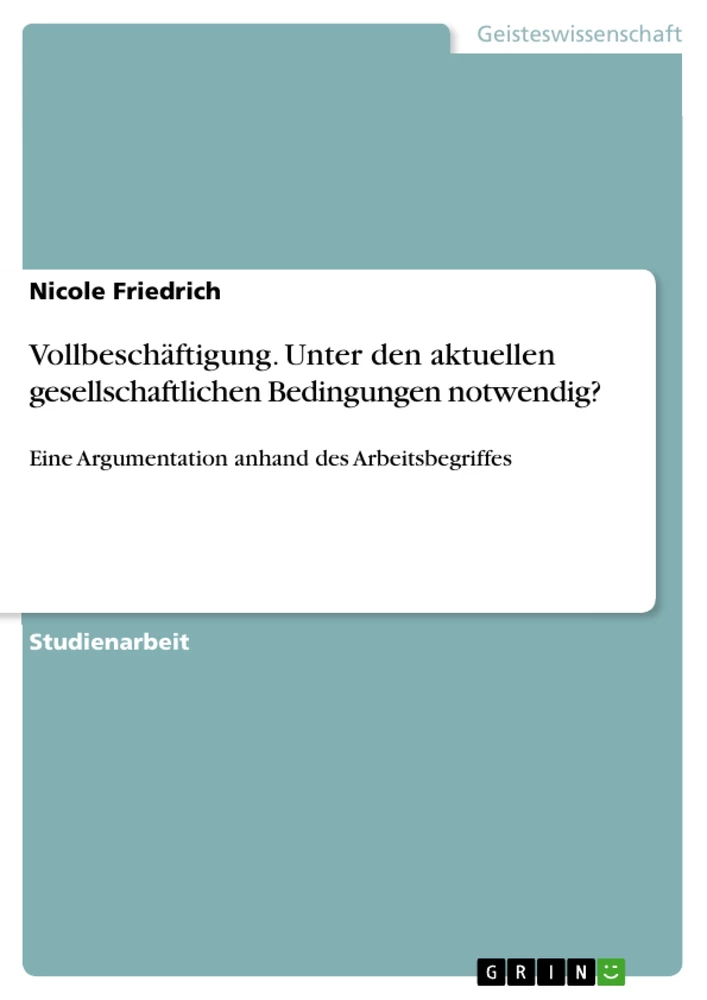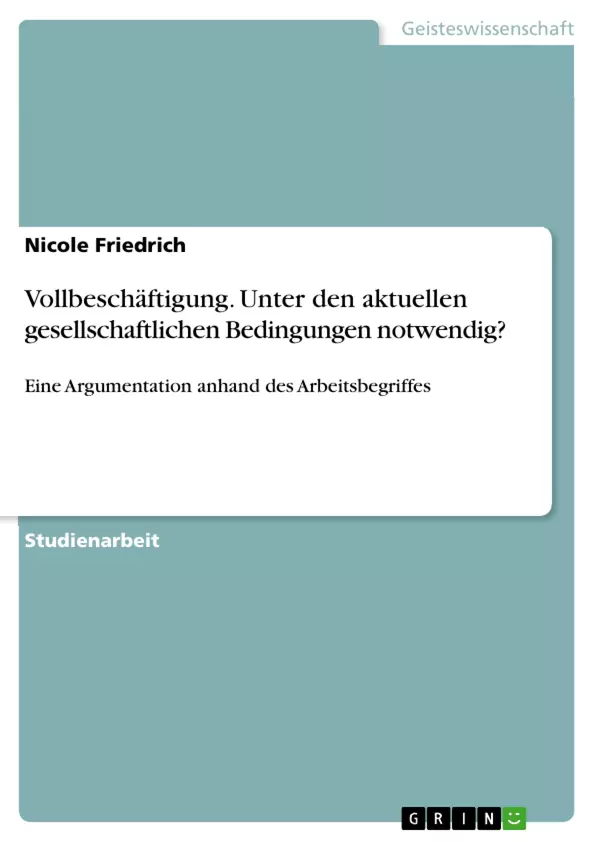Schon der deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky sagte einmal: „Eine der schauerlichsten Folgen der Arbeitslosigkeit ist wohl die, daß Arbeit als Gnade vergeben wird. Es ist wie im Kriege: wer die Butter hat, wird frech.“ (Tucholsky 1930). Es ist wohl kein Geheimnis, dass die Welt und damit auch Deutschland im 21. Jahrhundert stark unter dem Faktor Arbeitslosigkeit leidet. Vor allem aber sind es die diejenigen Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und dadurch nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Einbußen hinnehmen müssen. Im Zeitalter des rasant fortschreitenden technologischen Wandels, der Globalisierung und der Flexibilität ist es ein stetiges auf und ab von Arbeitsplätzen, wobei der Trend eher in Richtung Reduzierung statt Neuschaffung tendiert.
Dennoch wird in Politik und Gesellschaft weiterhin das Ideal der Vollbeschäftigung und der Abbau der Arbeitslosigkeit als höchstes Ziel angestrebt, immerhin kommt Erwerbslosigkeit dem Staat teuer zu stehen. Jährlich werden Unsummen für die Beseitigung von Arbeitslosigkeit bzw. die Förderung von (Langzeit-)Arbeitslosen ausgegeben, um diesem Ideal näher zu kommen. Zwar konnte man in den letzten Jahren durch diverse arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Erfolge verbuchen, indem die Arbeitslosenquote unter fünf Prozent fiel, allerdings zum Preis der Qualität der Arbeitsplätze. Während das sogenannte Normalarbeitsverhältnis langsam aber sicher erodiert, expandieren die populären atypischen Beschäftigungen. Nach Definition des Statistischen Bundesamtes ist jemand erwerbstätig, sofern er „mindestens eine Stunde pro Woche gegen Bezahlung gearbeitet hat und mindestens 15 Jahre alt ist“ (Statistisches Bundesamt 2013a). Teilzeit, Leiharbeit, befristete Beschäftigungen und Mini- bzw. Midijobs erfüllen diese Kriterien, wodurch sich die Arbeitslosenzahlen scheinbar senken. Im Grunde sind diese atypischen Beschäftigungen objektiv kaum negativ anzusehen, denn sie sorgen für Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. Unternehmen können sich besser an konjunkturelle Schwankungen anpassen und Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, ein Unternehmen kennen zulernen oder auch ihre reguläre Arbeitszeit auf Wunsch zu reduzieren. Gäbe es da nicht ein Problem: die Koppelung von Einkommen und Erwerbstätigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Arbeitsbegriff im historischen Wandel
- Von der Schöpfungsgeschichte bis zum Mythos
- Antike: Die Elite gegen den Rest
- Christentum und Mittelalter
- Arbeit heute: ambivalent wie eh und je
- Der moderne Arbeitsethos
- Trennung von Arbeit und Nicht-Arbeit
- Vollbeschäftigung — Utopie oder Realität?
- Ist das Ziel der Vollbeschäftigung eine längst vergangene Utopie?
- Stimmen für eine neue Vollbeschäftigung
- Fazit
- Quellennachweis
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Notwendigkeit der Vollbeschäftigung unter Berücksichtigung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen. Sie argumentiert anhand des Arbeitsbegriffes, dass die Vollbeschäftigung angesichts der fortschreitenden Automatisierung und des exponentiellen Maschineneinsatzes nicht mehr erforderlich ist. Das Ziel der Vollbeschäftigung wird lediglich aufgrund des aktuell herrschenden Arbeitsethos angestrebt, hat aber nichts mehr mit einer sinnvollen Arbeitsgesellschaft gemein.
- Der Arbeitsbegriff im historischen Wandel
- Der moderne Arbeitsethos
- Die Trennung von Arbeit und Nicht-Arbeit
- Die Folgen der fortschreitenden Automatisierung
- Die Notwendigkeit einer neuen Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Vollbeschäftigung ein und stellt die Arbeitshypothese der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Problematik der Arbeitslosigkeit im 21. Jahrhundert und die Ambivalenz des Begriffs der Vollbeschäftigung.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Arbeitsbegriff im historischen Wandel, beginnend mit der Schöpfungsgeschichte und dem Mythos bis hin zur frühen Neuzeit und der modernen Gesellschaft. Es zeigt auf, wie sich das Verständnis von Arbeit in verschiedenen Epochen entwickelt hat und welche Faktoren diese Entwicklungen beeinflusst haben.
Das dritte Kapitel analysiert die ambivalenten Aspekte des Arbeitsbegriffes in der heutigen Zeit. Es beleuchtet den modernen Arbeitsethos und die Trennung von Arbeit und Nicht-Arbeit. Es wird die Bedeutung der Erwerbsarbeit im heutigen Kontext und die daraus resultierenden sozialen Ungleichheiten diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Vollbeschäftigung in der heutigen Zeit noch ein realistisches Ziel ist. Es analysiert die Entwicklung der Vollbeschäftigung in der Nachkriegszeit und die daraus resultierenden Veränderungen im Arbeitsmarkt. Es werden die Ursachen der strukturellen Arbeitslosigkeit und die Problematik der atypischen Beschäftigungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arbeitsbegriff, die Vollbeschäftigung, die Arbeitslosigkeit, die Automatisierung, die Globalisierung, die Individualisierung, der moderne Arbeitsethos, die Trennung von Arbeit und Nicht-Arbeit, atypische Beschäftigungsverhältnisse, die strukturelle Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit einer neuen Arbeitsmarktpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Ist Vollbeschäftigung im 21. Jahrhundert noch ein realistisches Ziel?
Angesichts rasanter Automatisierung und technologischer Fortschritte wird Vollbeschäftigung oft als Utopie betrachtet, die primär aus einem veralteten Arbeitsethos heraus angestrebt wird.
Was versteht man unter "atypischen Beschäftigungsverhältnissen"?
Dazu gehören Teilzeit, Leiharbeit, befristete Jobs sowie Mini- und Midijobs, die zwar die Arbeitslosenquote senken, aber oft die Qualität der Arbeitsplätze mindern.
Wie hat sich der Arbeitsbegriff historisch gewandelt?
Vom Fluch in der Antike über die religiöse Pflicht im Mittelalter bis hin zum modernen Arbeitsethos, der Erwerbsarbeit als zentralen Identitäts- und Wohlstandsfaktor sieht.
Welche Folgen hat die fortschreitende Automatisierung für den Arbeitsmarkt?
Maschinen übernehmen zunehmend komplexe Aufgaben, was tendenziell zur Reduzierung statt zur Neuschaffung von klassischen Vollzeitstellen führt und neue Konzepte der Arbeitsmarktpolitik erfordert.
Warum ist die Koppelung von Einkommen und Erwerbstätigkeit problematisch?
In einer Gesellschaft, in der menschliche Arbeit durch Technik ersetzt wird, führt diese Koppelung zu wachsender sozialer Ungleichheit für diejenigen, die keinen Platz im Arbeitsmarkt finden.
- Citation du texte
- Nicole Friedrich (Auteur), 2013, Vollbeschäftigung. Unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen notwendig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275024