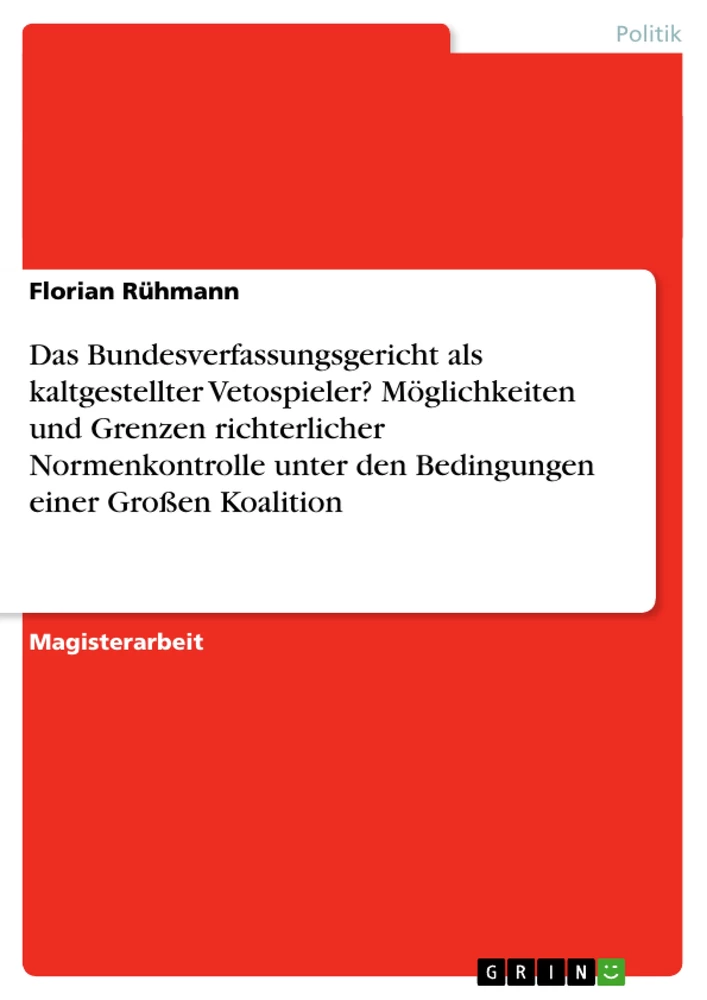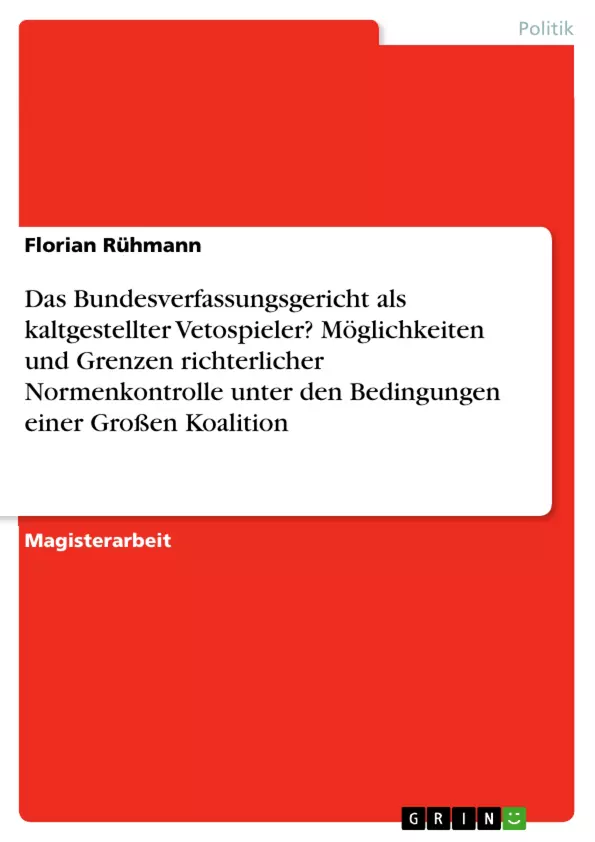Das Bundesverfassungsgericht ist dazu berufen, über die Einhaltung des Grundgesetzes zu wachen und konstitutionellen Grenzüberschreitungen des Gesetzgebers mit den Mitteln des Verfassungsrechts entgegenzutreten. Da die richterlichen Möglichkeiten zur Normenkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland besonders stark ausgeprägt sind, steht das Karlsruher Gericht in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zur Legislative. Mit seiner Befugnis zur Normverwerfung greift das Bundesverfassungsgericht tief in den Kompetenzbereich der gesetzgebenden Körperschaften ein und beschneidet diese in ihrem originären Handeln. Allerdings gilt dieser Befund in erster Linie für den bundesdeutschen Normalfall, wenn die Koalitionsbildung nach dem Muster einer kleinen Koalition erfolgt. Wie es unter den Bedingungen einer Großen Koalition um die Einflussmöglichkeiten der Karlsruher Richterschaft bestellt ist, bleibt indessen unklar. Genau an diesem Punkt setzt diese Magisterarbeit an. Es wird davon ausgegangen, dass sich der verfassungsgerichtliche Wirkungskreis während einer Großen Koalition tendenziell verkleinert. Schließlich nimmt in diesem koalitionspolitischen Sonderfall die Zahl der potenziellen Antragsteller ab, so dass die konstitutionell verbrieften Normenkontrollrechte der Karlsruher Richterschaft den Regierenden weniger Schmerzen bereiten dürften. Man könnte sogar sagen, dass das Bundesverfassungsgericht für die Dauer großkoalitionärer Zusammenarbeit zu einem kaltgestellten Vetospieler wird, der sein Machtpotenzial nicht mehr vollumfänglich abrufen kann. Zur Verifikation dieser These stützt sich die vorliegende Magisterarbeit in ihrer Methodik auf ein empirisch-analytisches Verfahren. Dabei soll das Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem Koalitionsmodell und der Intensität der Verfassungsgerichtsbarkeit geprüft werden, um mögliche Unterschiede bezüglich der verfassungsgerichtlichen Normenkontrollbefähigung während einer kleinen Koalition und einer Großen Koalition herauszustellen und nachzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verfassungsgerichtsbarkeit im Kontext der Vetospieler-Theorie
- Das Ursprungstheorem nach George Tsebelis
- Was ist ein Vetospieler?
- Wie wirken Vetospieler im politischen System?
- Welche Rolle spielt die Verfassungsgerichtsbarkeit innerhalb der Vetospieler-Theorie?
- Die Grenzen der Vetospieler-Theorie als Ausgangspunkt ihrer methodischen Erweiterung
- Das Alternativkonzept der Vetopunkte nach André Kaiser
- Die modifizierte Vetospieler-Konzeption nach Heidrun Abromeit und Michael Stoiber
- Das Ursprungstheorem nach George Tsebelis
- Das Bundesverfassungsgericht als Vetospieler? — Zur verfassungsrechtlichen und gesellschaftspolitischen Stellung eines Staatsorgans
- Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System
- Historische Grundlagen
- Aufbau, Funktionslogik und Organisationsstruktur des Gerichtshofs
- Die Verfahrensarten — Wann in Karlsruhe Recht gesprochen wird
- Möglichkeiten und Grenzen verfassungsgerichtlicher Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess
- Die Karlsruher Entscheidungsvarianten als Grundlage der richterlichen Macht
- Systemimmanente Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Das Bundesverfassungsgericht im Spannungsfeld zwischen Recht und Politik
- Die Agenda-Setzer-Qualitäten des Bundesverfassungsgerichts
- Justizialisierung der Politik oder Politisierung der Verfassungsjustiz?
- Warum das Karlsruher Gericht ein Vetospieler ist
- Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System
- Kleine Koalition vs. Große Koalition: Die Vetomacht des Bundesverfassungsgerichts im koalitionspolitischen Blickwinkel
- Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber während des Normalfalls einer kleinen Koalition
- Die richterliche Normenkontrolltätigkeit im historischen Zeitverlauf
- Die legislativen Schlüsselentscheidungen im Spiegel der Karlsruher Rechtsprechung
- Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber in Zeiten Großer Koalitionen
- Das Bundesverfassungsgericht und die Regierung Kiesinger (1966-1969)
- Empirische Analyse der ersten Großen Koalition
- Die legislativen Schlüsselentscheidungen im Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter
- Das Bundesverfassungsgericht und die Regierung Merkel (2005-2009)
- Erste empirische Befunde — Ein zeitnaher Rückblick auf die zweite Große Koalition
- Das Organstreitverfahren als alternativer Weg zur Kontrolle großkoalitionärer Gesetzesprojekte?
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit während der ersten und zweiten Großen Koalition
- Das verfassungsgerichtliche Vetospiel in der Praxis: Kleine Koalition und Große Koalition im Vergleich (Zwischenfazit)
- Das Bundesverfassungsgericht und die Regierung Kiesinger (1966-1969)
- Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber während des Normalfalls einer kleinen Koalition
- Exkurs: Das Ausfertigungsverweigerungsrecht des Bundespräsidenten als zeitweiser Ersatz richterlicher Normenkontrolle?
- Die Rolle des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsprozess
- Das formelle und materielle Prüfungsrecht
- Die Ausfertigungsverweigerung als ultima ratio
- Der Bundespräsident unter den Bedingungen einer Großen Koalition
- Die Rolle von Heinrich Lübke und Gustav Heinemann während der ersten Großen Koalition
- Horst Köhler und die zweite Große Koalition
- Soll der Bundespräsident als einspringender Verfassungshüter agieren?
- Die Rolle des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsprozess
- Das Bundesverfassungsgericht in Zeiten einer Großen Koalition: Kaltgestellter Vetospieler oder potenter Verfassungshüter? (Schlussbetrachtung)
- Abkürzungsverzeichnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als Vetospieler im deutschen politischen System, insbesondere unter den Bedingungen einer Großen Koalition. Die Arbeit analysiert, ob die Vetomacht des Gerichts während einer Großen Koalition aufgrund der breiten Mehrheitsverhältnisse und der damit verbundenen geringeren Anreize für die Opposition, Verfassungsklagen einzureichen, tendenziell eingeschränkt wird.
- Verfassungsgerichtsbarkeit im Kontext der Vetospieler-Theorie
- Stellung des Bundesverfassungsgerichts im politischen System
- Möglichkeiten und Grenzen verfassungsgerichtlicher Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess
- Verhältnis von Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber in Zeiten einer Großen Koalition
- Rolle des Bundespräsidenten im Gesetzgebungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II beleuchtet die Vetospieler-Theorie und ihre Relevanz für die Verfassungsgerichtsbarkeit. Es werden die Ansätze von Tsebelis, Kaiser und Abromeit/Stoiber vorgestellt und deren Aussagekraft für die Einordnung des Bundesverfassungsgerichts als Vetospieler analysiert.
Kapitel III analysiert die verfassungsrechtliche und gesellschaftspolitische Stellung des Bundesverfassungsgerichts im deutschen politischen System. Es werden die staatsrechtlichen Grundlagen, die Organisationsstruktur und die Verfahrensarten des Gerichtshofs erläutert. Zudem wird das Spannungsfeld zwischen Recht und Politik im Hinblick auf die Agenda-Setzer-Qualitäten des Bundesverfassungsgerichts beleuchtet.
Kapitel IV untersucht empirisch die Vetomacht des Bundesverfassungsgerichts in Zeiten einer kleinen Koalition und einer Großen Koalition. Es werden die Kontrolldichte, die Verwerfungsquote, die Annullierungswahrscheinlichkeit und die Verfahrensdauer für die beiden Koalitionsmodelle anhand von Daten aus den Datenhandbüchern zur Geschichte des Deutschen Bundestages und der Jahresstatistik des Bundesverfassungsgerichts verglichen.
Kapitel V befasst sich mit dem Ausfertigungsverweigerungsrecht des Bundespräsidenten als möglichem Ersatz für die richterliche Normenkontrolle in Zeiten einer Großen Koalition. Es werden das formelle und materielle Prüfungsrecht des Staatsoberhaupts sowie dessen bisherige Rolle im Gesetzgebungsprozess unter den Bedingungen einer Großen Koalition analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem „Vetospieler“ im politischen System?
Ein Vetospieler ist ein Akteur (individuell oder kollektiv), dessen Zustimmung erforderlich ist, um eine Änderung des politischen Status quo herbeizuführen.
Warum wird das Bundesverfassungsgericht als Vetospieler bezeichnet?
Durch seine Befugnis zur Normenkontrolle kann das Gericht Gesetze für verfassungswidrig erklären und somit Entscheidungen der Legislative blockieren oder revidieren.
Wie verändert eine Große Koalition die Rolle des Gerichts?
In einer Großen Koalition sinkt die Zahl potenzieller Antragsteller für abstrakte Normenkontrollen, da die Opposition oft zu klein ist. Dies kann die Kontrollmacht des Gerichts faktisch einschränken.
Kann der Bundespräsident als „Ersatz-Verfassungshüter“ fungieren?
Ja, durch sein Prüfungsrecht und die mögliche Ausfertigungsverweigerung von Gesetzen kann er in Zeiten politischer Dominanz großer Koalitionen eine zusätzliche Kontrollinstanz bilden.
Was ist die „Justizialisierung der Politik“?
Es beschreibt den Trend, dass politische Konflikte zunehmend vor Gericht ausgetragen werden, wodurch das Bundesverfassungsgericht zu einem zentralen Akteur im Gesetzgebungsprozess wird.
- Citar trabajo
- Florian Rühmann (Autor), 2012, Das Bundesverfassungsgericht als kaltgestellter Vetospieler? Möglichkeiten und Grenzen richterlicher Normenkontrolle unter den Bedingungen einer Großen Koalition, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275132