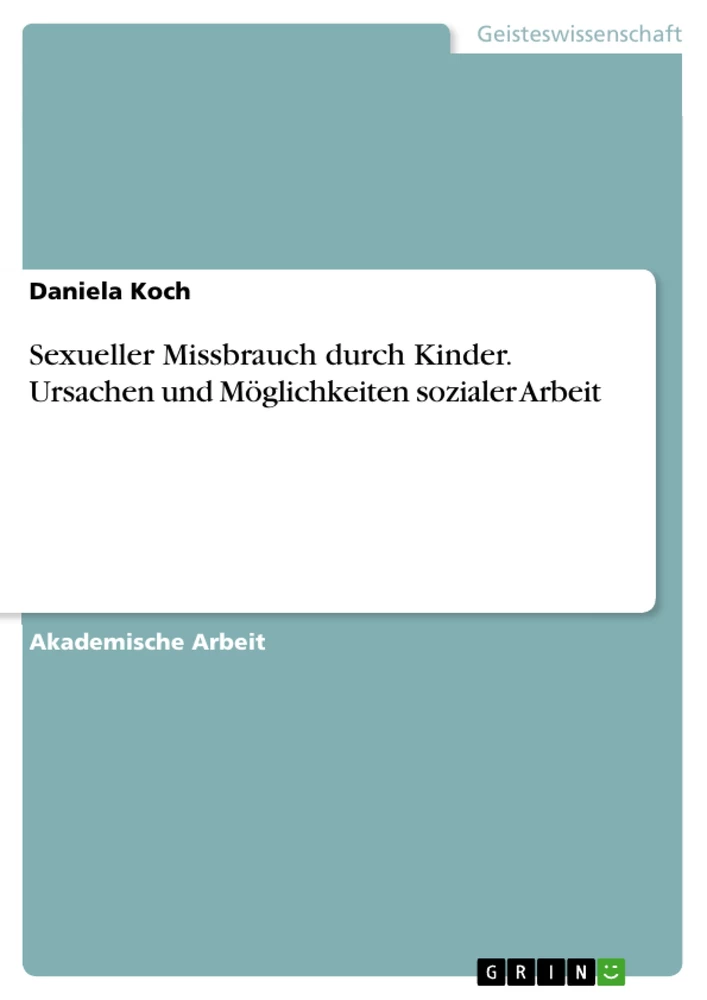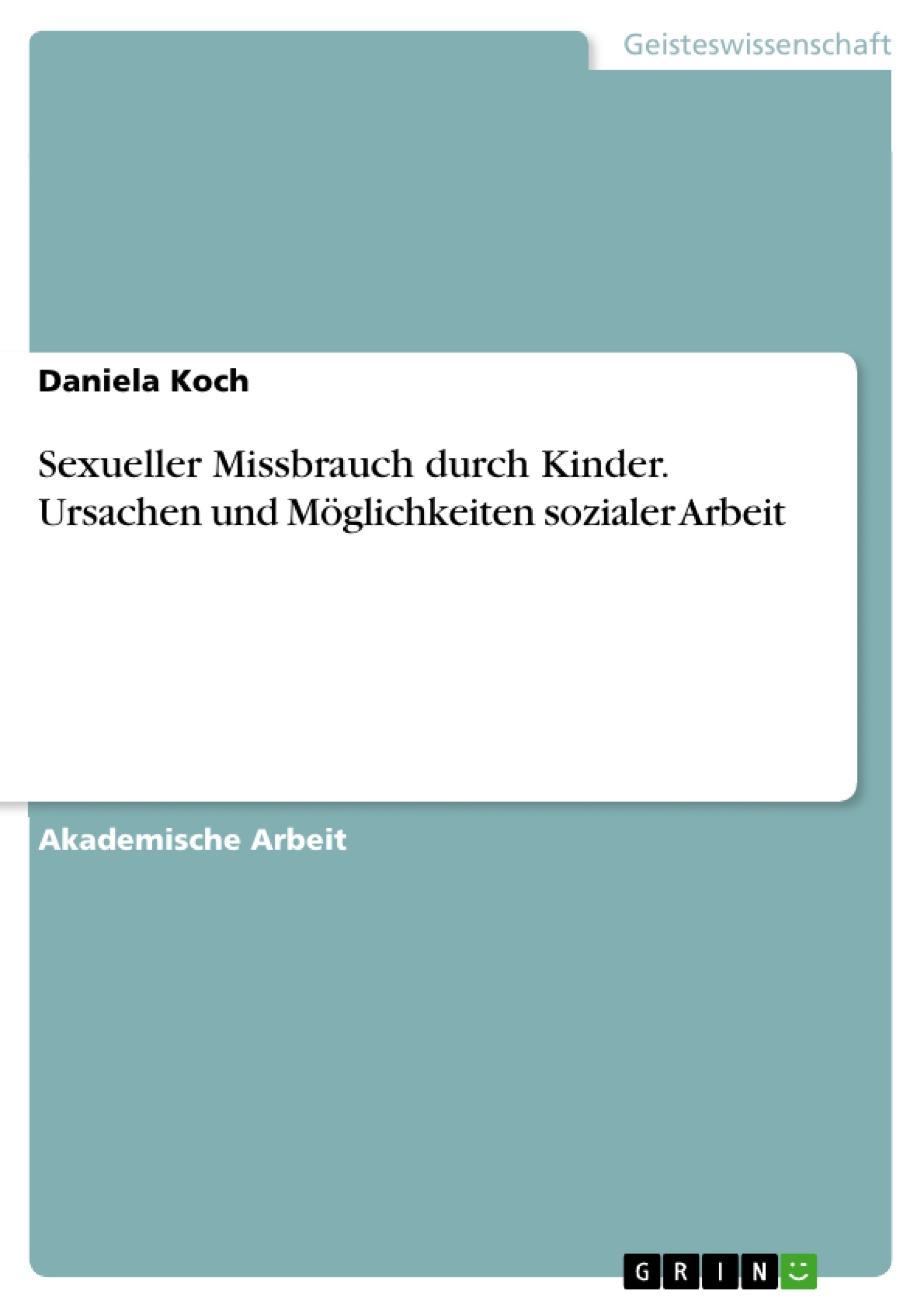Lange Zeit galten Kinder in unserer Kultur als „asexuelle“ Geschöpfe. Da jedoch die Mehrzahl jugendlicher Täter bereits als Kinder durch sexuelle Übergriffe auffallen und viele Erwachsene Missbraucher schon vor ihrem zehnten Lebensjahr deviante sexuelle Phantasien auf Kinder hatten, kann durch adäquate Interventionen und Maßnahmen zur Prävention an den Ursachen für sexuellen Missbrauch durch Kinder gearbeitet werden, um so das Ausmaß und die Auswirkungen sexueller Gewalt im Allgemeinen einzudämmen. Durch eine Analyse der Ursachen im Kindesalter kann bestimmt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um effektiv die Wahrscheinlichkeit von Täterkarrieren zu vermindern.
Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Sozialarbeit werden im letzten Abschnitt besprochen.
Aus dem Inhalt:
- Zyklische Weitergabe sexuellen Missbrauchs.
- Borderline-Syndrom des Kindesalters.
- Modell der vier Voraussetzungen des sexuellen Missbrauchs.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Ätiologie
- 2.1 Soziale Lerntheorie nach Bandura
- 2.2 Modeling Konzept der Erlernung missbräuchlichen Verhaltens nach Becker
- 2.3 Zyklische Weitergabe sexuellen Missbrauchs
- 2.4 EMASO-Modell nach Bera
- 2.5 Modell der vier Voraussetzungen des sexuellen Missbrauchs
- 3 Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit für missbrauchende Kinder
- 4 Schlussbetrachtung
- 5 Literatur- und Quellenverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema sexueller Missbrauch durch Kinder und analysiert die Ursachen und Möglichkeiten sozialer Arbeit im Umgang mit diesem Phänomen. Ziel ist es, die Entstehung sexueller Gewalt im Kindesalter zu verstehen und präventive Maßnahmen zu entwickeln, um die Wahrscheinlichkeit von Täterkarrieren zu minimieren.
- Individuelle Lebensgeschichte und familiäres Umfeld als Einflussfaktoren
- Soziale Lerntheorie und die Rolle von Modellen
- Zyklische Weitergabe sexuellen Missbrauchs und die Bedeutung der eigenen Viktimisierung
- Modell der vier Voraussetzungen des sexuellen Missbrauchs
- Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit in der Täterprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema sexueller Missbrauch durch Kinder ein und erläutert die Relevanz einer gesonderten Betrachtung dieser Thematik. Es wird betont, dass die meisten Täterkarrieren in der Kindheit beginnen und dass eine Analyse der Ursachen sexuellen Missbrauchs im Kindesalter entscheidend für die Entwicklung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen ist.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Ätiologie sexuellen Missbrauchs im Kindesalter. Es werden verschiedene Konzepte und Modelle vorgestellt, die sich mit der Entstehung sexuellen Missbrauchs beschäftigen, darunter die soziale Lerntheorie nach Bandura, das Modeling Konzept der Erlernung missbräuchlichen Verhaltens nach Becker, das Modell der zyklischen Weitergabe sexuellen Missbrauchs, das EMASO-Modell nach Bera und das Modell der vier Voraussetzungen des sexuellen Missbrauchs nach Finkelhor.
Das dritte Kapitel widmet sich den Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit im Umgang mit sexuell auffälligen Kindern. Es wird die Bedeutung der Täterprävention hervorgehoben und verschiedene Ansätze zur Prävention vorgestellt, die sich an Jungen und männliche Jugendliche richten. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer flächendeckenden Jugendarbeit betont, die alle Jungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Entwicklung erreicht und unterstützt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen sexuellen Missbrauch durch Kinder, Ätiologie, soziale Lerntheorie, zyklische Weitergabe, Modell der vier Voraussetzungen, Täterprävention, Möglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit, Borderline-Syndrom des Kindesalters. Der Text beleuchtet die verschiedenen Ursachen und Faktoren, die zur Entstehung sexuellen Missbrauchs im Kindesalter beitragen, und untersucht die Rolle der sozialen Arbeit in der Prävention und Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es sexuellen Missbrauch durch Kinder?
Ja, Entgegen dem lange Zeit vorherrschenden Bild des „asexuellen“ Kindes zeigen Studien, dass sexuelle Übergriffe bereits im Kindesalter stattfinden können und oft der Beginn späterer Täterkarrieren sind.
Was besagt die soziale Lerntheorie nach Bandura in diesem Kontext?
Sie besagt, dass Kinder missbräuchliches Verhalten durch Beobachtung und Nachahmung (Modeling) von Vorbildern in ihrem sozialen Umfeld erlernen können.
Was ist die „zyklische Weitergabe“ sexuellen Missbrauchs?
Dies beschreibt das Phänomen, dass Kinder, die selbst Opfer sexueller Gewalt wurden, dieses Trauma später agieren und selbst zu Tätern werden können, um die Opferrolle zu bewältigen.
Was ist das Modell der vier Voraussetzungen nach Finkelhor?
Finkelhor nennt vier Faktoren, die zusammenkommen müssen: die Motivation des Täters, das Überwinden innerer Hemmschwellen, das Überwinden äußerer Hindernisse und das Ausschalten des Widerstands des Opfers.
Wie kann soziale Arbeit hier präventiv wirken?
Durch gezielte Täterprävention, Aufklärung in der Jugendarbeit und frühzeitige Intervention bei sexuell auffälligem Verhalten kann die Wahrscheinlichkeit einer Täterkarriere minimiert werden.
Was ist das Borderline-Syndrom des Kindesalters?
Es beschreibt eine schwere Persönlichkeitsentwicklungsstörung bei Kindern, die oft mit emotionaler Instabilität und Impulsivität einhergeht und eine Ursache für deviantes Verhalten sein kann.
- Quote paper
- Dipl. Soz.Arb. Daniela Koch (Author), 2006, Sexueller Missbrauch durch Kinder. Ursachen und Möglichkeiten sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275160