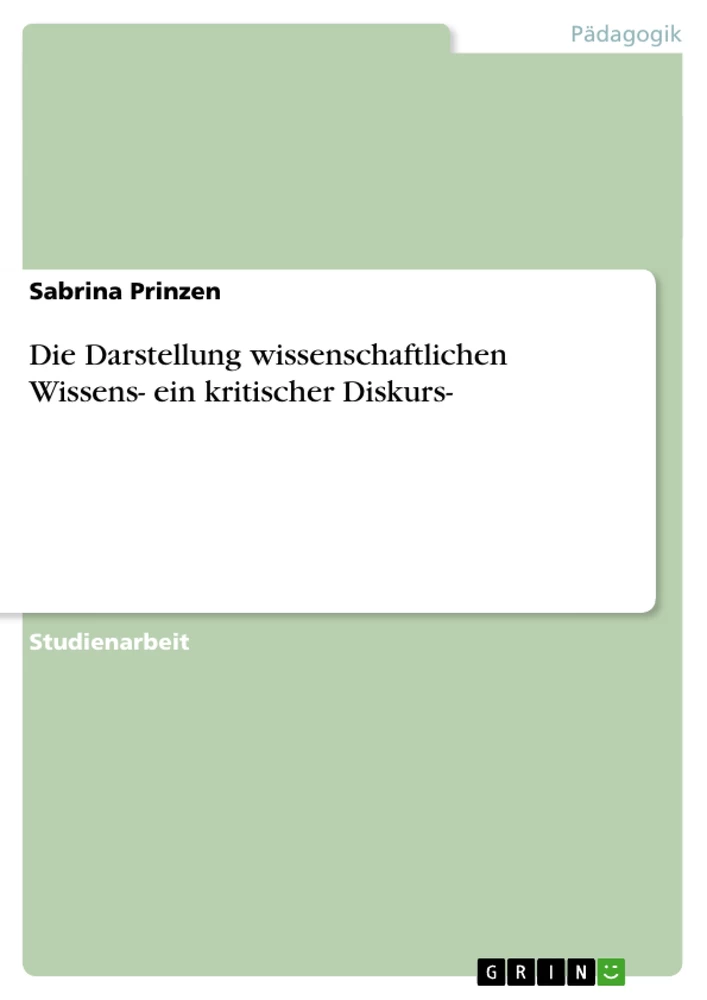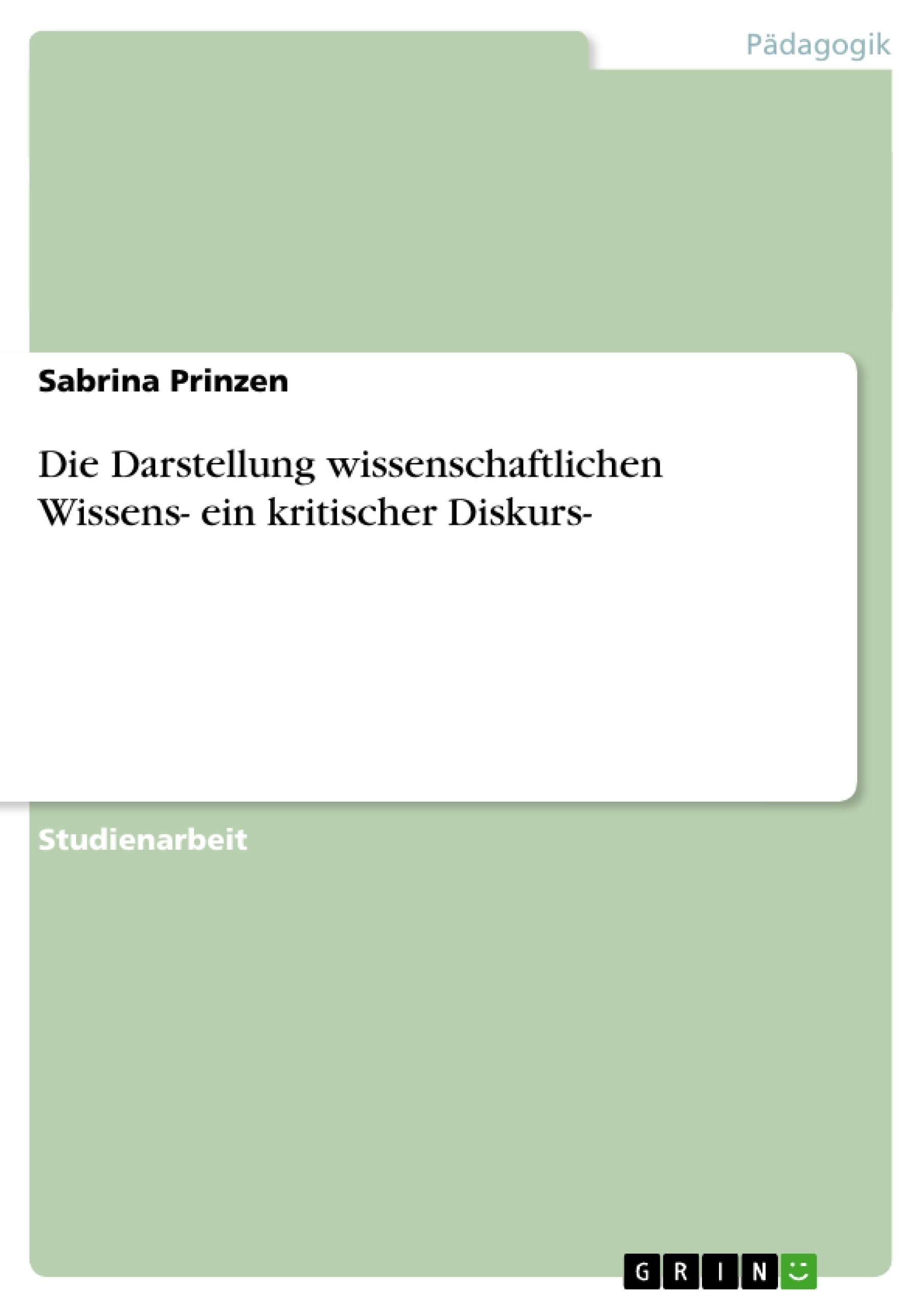Wie wird wissenschaftliches Wissen in Darstellung gebracht? Wie ist dies
möglich? Welche Faktoren spielen im Vermittlungsprozess mit ein? Wie findet
Darstellung statt?
Apel versucht sich dieser Problematik anzunehmen und bezieht sich dabei auf
das Beispiel der Vorlesung.
Er untersucht dabei die Realität der Vorlesung als akademisch-rhetorische
Lehrform und geht davon aus, dass die Vorlesung eine anregend gestaltete
Lehr-Lern-Situation darstellen sollte.
Er differenziert zwischen verschiedenen Aspekten, die eine gute Vorlesung
ausmachen, bewertet diese und versucht letztendlich, eine Art Systematik
herzustellen.
Im Folgenden werde ich auf seine Erkenntnisse seiner Beobachtungen aus der
Praxis eingehen und diese kritisch beleuchten. Apel beschäftigt sich mit dem Phänomen der Vorlesung. Dabei geht er von
seinen eigenen Beobachtungen, die er in der Praxis gemacht hat, aus. Diese
Beobachtungen versucht er systematisch zu gliedern. Er zergliedert die
Vorlesung in unterschiedliche Teilbereiche und fertigt dann ein Analyseraster
an, um eine gute Vorlesung definieren zu können.
Bei seiner Erhebung unterscheidet er zwischen mehreren Gesichtspunkten, auf
die ich im Kommenden zu sprechen kommen werde. Er versucht, die Vorlesung
differenziert zu betrachten und im Einzelnen auf bestimmte Gesichtspunkte
einzugehen. Das impliziert, dass er die Vorlesung nicht als Ganzes in seinen
Blickpunkt nimmt, sondern lediglich partiell behandelt. Inwieweit diese
Herangehensweise die Darstellung wissenschaftlichen Wissens unterstützt, ist
zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Phänomen der Vorlesung
- Merkmale einer „guten Vorlesung“
- Die Eröffnung der Vorlesung als Strategie zur Gewinnung der Zuhörer
- Die Gliederung: Klarheit und Übersicht
- Die Sprache und das Auftreten
- Darstellen und Entwickeln- Grundformen des Lehrvortrags
- Die rhetorische Seite der Vorlesung
- Darstellen und Argumentieren
- Die didaktische Seite der Vorlesung
- Strukturieren und Präsentieren
- Überzeugende Darstellung wissenschaftlichen Wissens und deren Verwirklichung
- Überzeugende Rede und akademische Bildung
- Die Mittel des Lehrvortrags
- Die Vorlesung als Lehr-Lern-Situation
- Die Vorlesung als gestaltbare Lehrform
- Die Gestaltungsformen des Lehrvortrags
- Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Darstellung wissenschaftlichen Wissens anhand des Beispiels der Vorlesung. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte einer „guten Vorlesung“ zu analysieren und zu bewerten, um eine Art Systematik für die Wissensvermittlung zu entwickeln. Der Autor bezieht sich dabei auf eigene Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Praxis.
- Analyse der Vorlesung als akademisch-rhetorische Lehrform
- Definition der Merkmale einer „guten Vorlesung“
- Untersuchung der Rolle des Dozierenden als Wissensvermittler
- Kritische Auseinandersetzung mit der Balance zwischen Information und Überzeugung in der Vorlesung
- Bewertung der Bedeutung von Gliederung, Sprache und Auftreten für die Wissensvermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Darstellung wissenschaftlichen Wissens und die Rolle der Vorlesung als Vermittlungsform in den Vordergrund. Der Autor bezieht sich dabei auf die Arbeit von Apel und kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit dessen Erkenntnissen an.
- Das Phänomen der Vorlesung: In diesem Kapitel untersucht der Autor die Vorlesung als Gegenstand der Analyse. Er beschreibt seine eigenen Beobachtungen und erläutert seine systematische Herangehensweise, die auf einer Zergliederung der Vorlesung in verschiedene Teilbereiche basiert.
- Merkmale einer „guten Vorlesung“: Der Autor widmet sich in diesem Kapitel der Definition von Merkmalen, die eine „gute Vorlesung“ ausmachen. Er beleuchtet die Bedeutung von einer eindeutigen Gliederung, der Sprache und dem Auftreten des Dozierenden.
- Die Eröffnung der Vorlesung als Strategie zur Gewinnung der Zuhörer: Der Autor untersucht die Rolle der Vorlesungs-Eröffnung als Strategie zur Gewinnung der Zuhörer. Er argumentiert, dass die Einleitung eine allgemeine Anregung, eine Ankündigung oder Angaben zum Thema beinhalten sollte. Er stellt dabei die Frage, inwieweit Humor und Abwechslung zu einer Verfälschung des zu vermittelnden Wissens führen können.
- Die Gliederung: Klarheit und Übersicht: Der Autor betont die Bedeutung einer klaren Gliederung für die kognitive Verarbeitung der Inhalte. Er diskutiert die Zielsetzung der Vorlesung als Information, Überzeugung und gelegentlich Provokation und hinterfragt die Vereinbarkeit dieser Ziele mit der reinen Darstellung wissenschaftlichen Wissens.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Darstellung wissenschaftlichen Wissens, die Vorlesung als akademisch-rhetorische Lehrform, die Merkmale einer „guten Vorlesung“, die Rolle des Dozierenden als Wissensvermittler und die kritische Auseinandersetzung mit der Balance zwischen Information und Überzeugung in der Wissensvermittlung. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Vorlesung, Wissensvermittlung, Rhetorik, Didaktik, Gliederung, Sprache, Auftreten, Information, Überzeugung, Provokation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes über die Darstellung wissenschaftlichen Wissens?
Der Text untersucht, wie wissenschaftliches Wissen am Beispiel der universitären Vorlesung vermittelt wird und welche Faktoren diesen Prozess beeinflussen.
Welchen Ansatz verfolgt der Autor Apel bei der Analyse der Vorlesung?
Apel betrachtet die Vorlesung als eine akademisch-rhetorische Lehrform und versucht, durch systematische Beobachtung ein Analyseraster für eine „gute Vorlesung“ zu entwickeln.
Welche Merkmale kennzeichnen laut Text eine „gute Vorlesung“?
Wichtige Merkmale sind eine klare Gliederung, eine angemessene Sprache, das Auftreten des Dozierenden sowie eine strategische Eröffnung zur Gewinnung der Zuhörer.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in der wissenschaftlichen Wissensvermittlung?
Die Rhetorik dient dazu, Wissen nicht nur darzustellen, sondern auch zu argumentieren und die Zuhörer zu überzeugen, wobei ein Gleichgewicht zur reinen Information gewahrt werden muss.
Warum wird die Gliederung einer Vorlesung als so wichtig erachtet?
Eine klare Gliederung sorgt für Übersichtlichkeit und unterstützt die kognitive Verarbeitung der Inhalte durch die Studierenden.
Kritisiert der Text Apels Herangehensweise?
Ja, es wird kritisch hinterfragt, ob die partielle Betrachtung einzelner Aspekte der Vorlesung anstelle einer ganzheitlichen Sichtweise die Wissensdarstellung ausreichend unterstützt.
- Citation du texte
- Sabrina Prinzen (Auteur), 2004, Die Darstellung wissenschaftlichen Wissens- ein kritischer Diskurs-, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27529