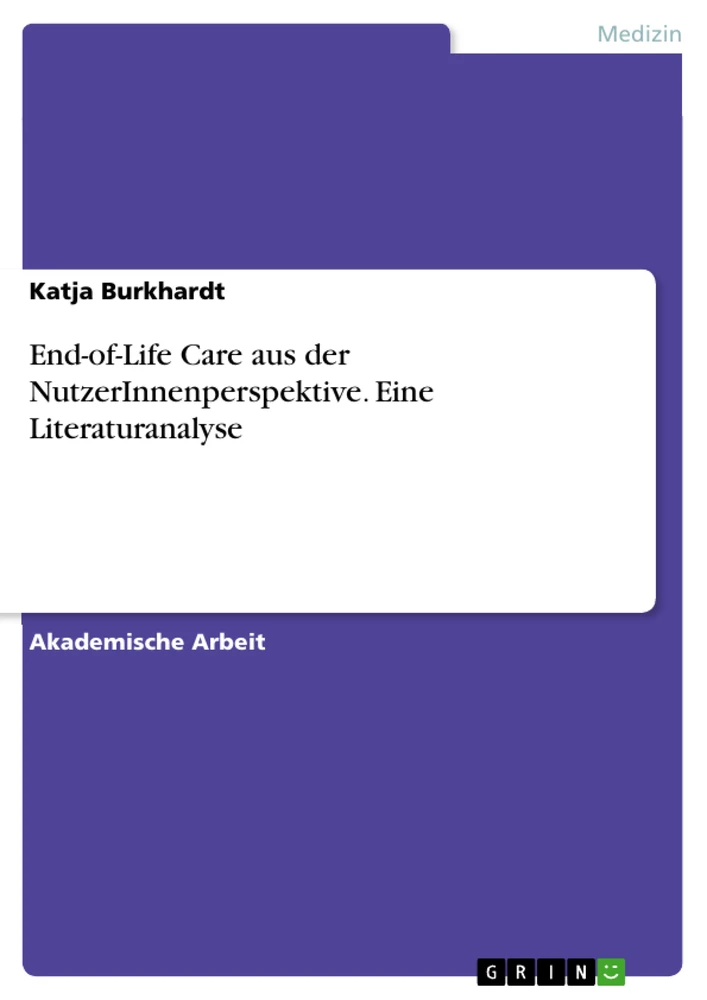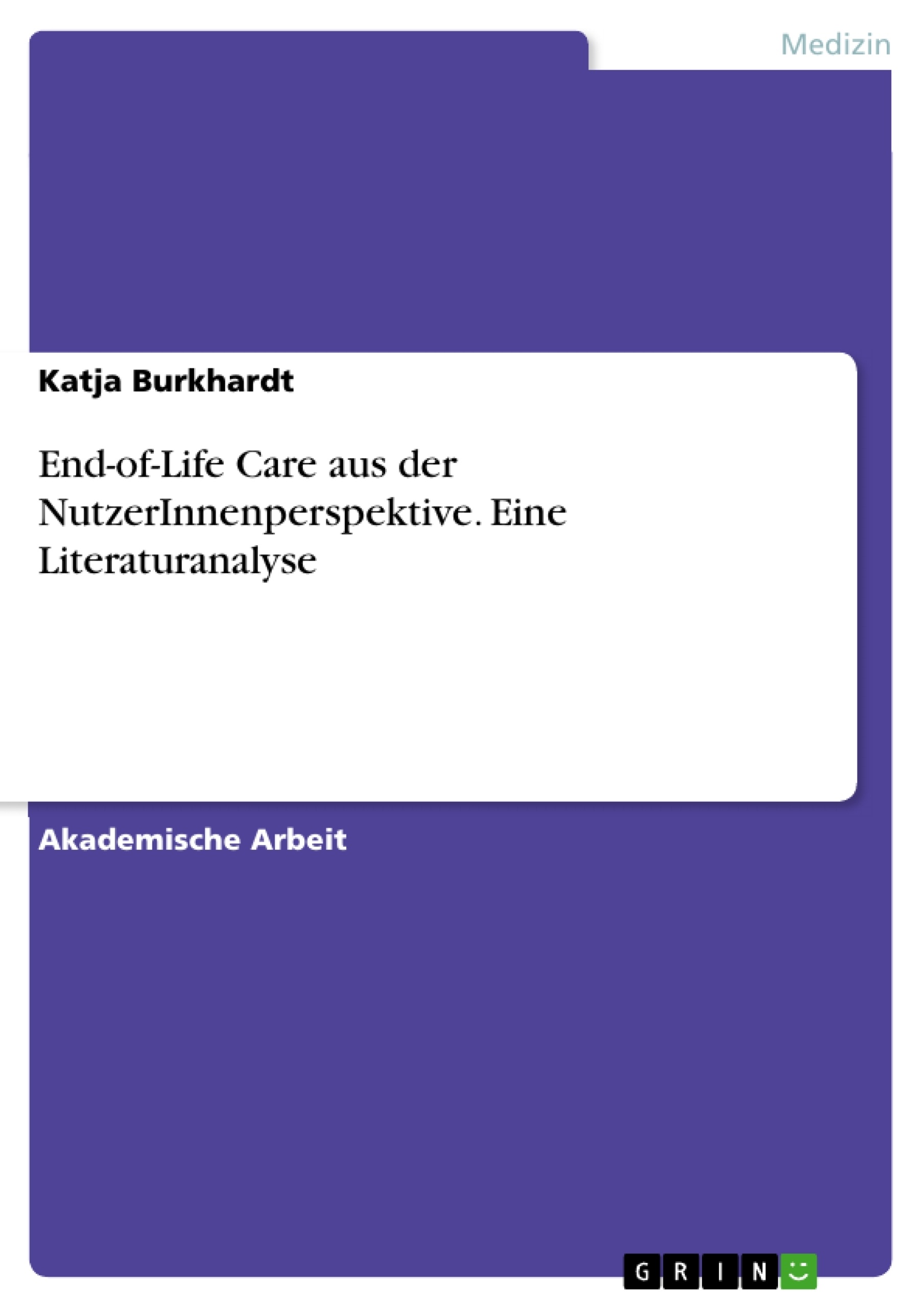Die Literaturanalyse dient der theoretischen Sensibilisierung, um von einer Idee zu einer Untersuchung mit entsprechenden Ergebnissen zu gelangen. Hier werden ausgewählte Aspekte des Themenbereiches NutzerInnenperspektive auf Palliativpflege sterbender Kinder als grober Überblick beschrieben. Hierzu werden zugleich einerseits der Problemhintergrund, der Forschungsstand und die Relevanz für Pflegewissenschaft und Public Health beleuchtet und andererseits spezifische für die Fragestellung wesentliche Aspekte hervorgehoben und kurz analysiert.
Aus dem Inhalt:
- Begriffsbestimmungen und Forschungsstand.
- Epidemiologische und statistische Daten.
- End-of-Life Care und Palliative Care.
- Beratung in der Pflege.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen und Forschungsstand
- NutzerInnenperspektive und NutzerInnenzufriedenheit
- NutzerInnenperspektive
- NutzerInnenzufriedenheit
- Zur Situation sterbender Kinder und ihrer Familien
- Epidemiologische und statistische Daten
- Todesursachen im Kindesalter
- Lebenslimitierende Erkrankungen im Kindesalter
- Auswirkung der lebenslimitierenden Erkrankung eines Kindes auf die Familie
- Epidemiologische und statistische Daten
- End-of-Life Care und Palliative Care
- End-of-Life Care
- Palliative Care
- Palliative Care im Kindesalter
- Das ambulante Versorgungssystem für sterbende Kinder
- Stationäre Versorgung sterbender Kinder und Jugendlicher
- Beratung in der Pflege
- NutzerInnenperspektive und NutzerInnenzufriedenheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Literaturanalyse befasst sich mit der NutzerInnenperspektive in der End-of-Life Care für Kinder. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema zu geben und die Relevanz des NutzerInnenperspektiven für die Gestaltung einer bedarfsgerechten Versorgung zu beleuchten.
- NutzerInnenperspektive und -zufriedenheit im Kontext der End-of-Life Care
- Epidemiologie und Statistik von Todesfällen im Kindesalter
- Die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen von Familien mit sterbenden Kindern
- Die Bedeutung von Palliative Care für Kinder und ihre Familien
- Das ambulante und stationäre Versorgungssystem für sterbende Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas End-of-Life Care im Kontext des Wandels im Gesundheits- und Sozialsystem.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Begriffsbestimmungen von NutzerInnenperspektive und -zufriedenheit. Hier wird der aktuelle Forschungsstand beleuchtet und die Bedeutung dieser Konzepte für die Gestaltung einer bedarfsgerechten Versorgung herausgestellt.
Im dritten Kapitel wird die Situation sterbender Kinder und ihrer Familien im Detail betrachtet. Hier werden epidemiologische Daten zu Todesursachen im Kindesalter präsentiert und die Auswirkungen einer lebenslimitierenden Erkrankung auf die Familien beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Konzepten von End-of-Life Care und Palliative Care. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte werden dargestellt und der Fokus auf die Bedeutung von Palliative Care für Kinder und ihre Familien gelegt.
Schließlich befasst sich das fünfte Kapitel mit dem ambulanten Versorgungssystem für sterbende Kinder. Die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse in diesem Bereich werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
End-of-Life Care, NutzerInnenperspektive, NutzerInnenzufriedenheit, Palliative Care, Kinder, Familie, Tod, Sterben, Versorgung, ambulant, stationär, Gesundheitswesen, Forschung, Epidemiologie, Statistik, Lebenslimitierende Erkrankung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "NutzerInnenperspektive" in der Palliativpflege?
Es beschreibt die Sichtweise der Betroffenen – in diesem Fall sterbende Kinder und ihre Familien – auf die Qualität und Angemessenheit der erhaltenen Pflege und Begleitung.
Was ist der Unterschied zwischen End-of-Life Care und Palliative Care?
Palliative Care ist ein umfassender Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität unheilbar Kranker, während End-of-Life Care sich spezifisch auf die Pflege in der unmittelbaren Sterbephase konzentriert.
Welche Auswirkungen hat eine lebenslimitierende Erkrankung auf die Familie?
Die gesamte Familienstruktur ist betroffen; es entstehen enorme psychische Belastungen, soziale Isolation und ein hoher Bedarf an spezialisierter Beratung und Unterstützung.
Wie sieht das ambulante Versorgungssystem für sterbende Kinder aus?
Es umfasst spezialisierte ambulante Palliativteams (SAPV), die eine medizinische und pflegerische Versorgung im häuslichen Umfeld ermöglichen, um Krankenhausaufenthalte zu minimieren.
Welche Rolle spielt die Beratung in der Pflege sterbender Kinder?
Beratung ist essenziell, um Eltern in Entscheidungsprozessen zu unterstützen, Ressourcen zu aktivieren und eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen.
- Citation du texte
- Diplom-Berufspädagogin für Pflegewissenschaft Katja Burkhardt (Auteur), 2006, End-of-Life Care aus der NutzerInnenperspektive. Eine Literaturanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275381