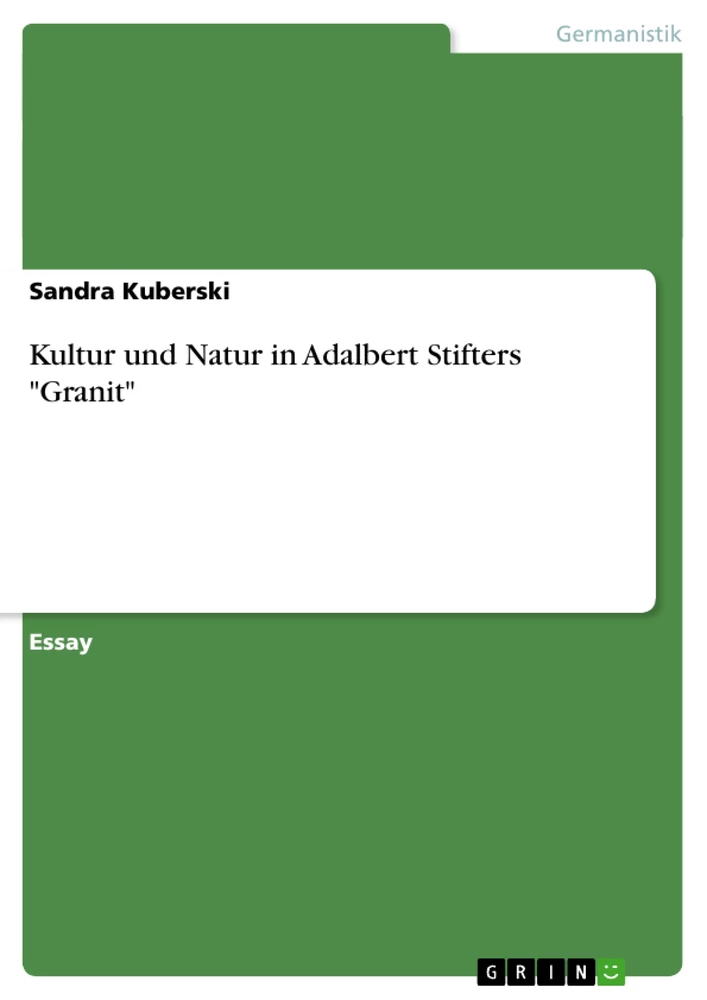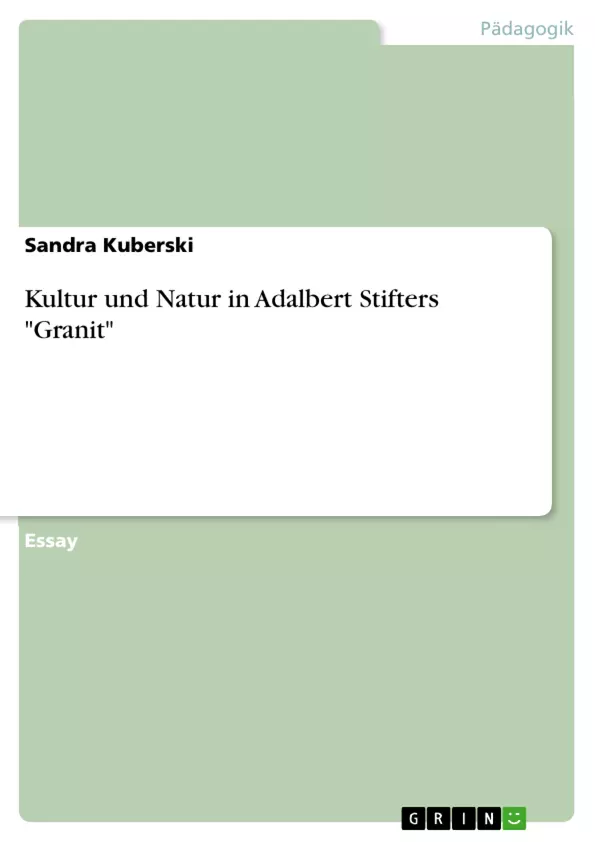Adalbert Stifter wird gerne auch als „der Walddichter“ beschrieben. In seinen Texten suggeriert er gewollt Kleinigkeit und Oberflächlichkeit. Die Abgründe allerdings lauern im Detail.
„Granit“ erschien erstmals im Jahr 1853 im Rahmen des Erzählbandes „Bunte Steine“. Als konventionell aufgebaute Novelle verfügt die Erzählung über eine äußere Rahmenhandlung, in der ein erwachsener Mann sich an ein Erlebnis in seiner Knabenzeit erinnert (innere Rahmenhandlung). Er wird als Kind von seiner Mutter dafür bestraft, mit Füßen voller Wagenschmiere in die saubere Wohnung getreten zu sein. Die Tatsache, mit seiner „teuersten Verwandten dieser Erde in dieses Zerwürfnis geraten“ zu sein, zerbricht dem Jungen beinahe das Herz. Der Großvater nimmt sich daraufhin seiner an und zusammen gehen sie auf eine Wanderung, auf der er dem Jungen die Natur um sie herum erklärt und auch die Geschichte (hier: die Binnengeschichte) einer Pechbrenner-Familie während der Zeit der Pest erzählt.
Im Folgenden soll genauer auf die erwähnte Wanderung des Großvaters und des Jungen eingegangen, und insbesondere Stifters Verhältnis zu Kultur und Natur untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Kultur und Natur in Stifters „Granit"
- Die Wanderung und die Geschichte der Pechbrenner-Familie
- Kultur in der Natur: Die Sprache und die Ordnung
- Die Binnengeschichte: Flucht aus der Kultur in die Natur
- Die Pest als göttliches Strafgericht und die gescheiterte Flucht
- Reine Natur: Ein Paradox?
- Der gescheiterte Versuch der Renaturalisierung
- Natur und Kultur: Eine nicht hintergehbare Differenz
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Adalbert Stifters Novelle „Granit" und untersucht das Verhältnis von Kultur und Natur im Kontext der Erzählung. Dabei werden die verschiedenen Ebenen der Geschichte, die Wanderung des Großvaters und des Jungen sowie die Binnengeschichte der Pechbrenner-Familie, herangezogen, um die zentrale These zu beleuchten: Stifter versucht, die Kultur in der Natur zu verorten und die moderne, entfremdete Welt zu renaturalisieren.
- Die Sprache als Ausdruck der Kultur in der Natur
- Die Binnengeschichte als Metapher für die gescheiterte Flucht aus der Kultur
- Die Pest als göttliches Strafgericht und die Ordnung der Natur
- Das Paradox der „reinen Natur" und die Unmöglichkeit einer Flucht in die Natur
- Die bleibende Differenz zwischen Natur und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Novelle „Granit" beginnt mit der Erinnerung eines erwachsenen Mannes an ein Erlebnis in seiner Kindheit. Er wird von seiner Mutter für einen Fehltritt bestraft, doch sein Großvater tröstet ihn und nimmt ihn mit auf eine Wanderung. Während der Wanderung erklärt der Großvater die Natur und erzählt die Geschichte einer Pechbrenner-Familie, die vor der Pest flüchtet. Diese Geschichte dient als Binnenerzählung und beleuchtet die Beziehung zwischen Kultur und Natur.
Der Großvater betont die Bedeutung der Sprache für die Kultur und zeigt, wie die Benennung von Gegenständen und Begriffen auf eine natürliche Grundlage zurückzuführen ist. Er erklärt die Etymologie des Wortes „Dürrschnäbel" und verdeutlicht, dass Sprache in der Natur verwurzelt ist. Durch diese Erklärung stellt er die Ordnung wieder her, ein zentrales Anliegen von Stifter.
Die Binnengeschichte erzählt von einer Pechbrenner-Familie, die vor der Pest in die Berge flüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie hinterlassen Zeichen, die ihnen Bescheid geben sollen, wenn die Gefahr vorüber ist. Doch nach vielen Jahren der Pest sind die Zeichen vergessen, und niemand kann sie mehr deuten. Der Großvater möchte dem entgegenwirken, indem er dem Jungen den Ursprung der Zeichen nicht vergessen lässt. Er lehrt ihn, die Kultur nicht als etwas Gegebenes zu sehen, sondern die Natur in der Kultur zu verstehen.
Die Flucht der Pechbrennerfamilie aus dem Dorf auf den Berg, also aus der Kultur in die Natur, ist jedoch zum Scheitern verurteilt. Die Pest wird als göttliches Strafgericht dargestellt, das die Ordnung der Natur wiederherstellen soll. Eine Flucht vor diesem Gericht ist die größtmögliche Sünde und wird bestraft.
Stifters Beschreibung der „reinen Natur" zeigt, dass auch der Wald, der für ihn die Natur repräsentiert, immer schon kulturell geprägt ist. Er beschreibt die Bäume als „Könige" und das „Volk der Gebüsche", das „unter ihnen" steht. Diese Personifizierung und Hierarchisierung der Pflanzenwelt verdeutlicht, dass in jeder Natur, die der Mensch betritt, schon Kultur vorhanden ist.
Der Versuch des Großvaters, die Kultur zu renaturalisieren, scheitert, da die Geschichte als „merkwürdige Tatsache" eingeleitet wird und mit dem Märchenanfang „es war einmal" beginnt. Es handelt sich um eine kulturelle Fiktion, um literarische und nicht natürliche Gegebenheiten. Der Großvater möchte die Kultur naturalisieren, doch in diesem Versuch kultiviert er die Natur, erreicht also genau den gegenteiligen Effekt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Verhältnis von Kultur und Natur, die Renaturalisierung der modernen Welt, die Sprache als Ausdruck der Kultur, die Binnengeschichte als Metapher für die gescheiterte Flucht aus der Kultur, die Pest als göttliches Strafgericht und die bleibende Differenz zwischen Natur und Kultur. Stifters Novelle „Granit" beleuchtet diese Themen, indem sie die Wanderung des Großvaters und des Jungen sowie die Geschichte der Pechbrenner-Familie erzählt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Adalbert Stifters Novelle „Granit“?
Das Hauptthema ist das komplexe Verhältnis von Kultur und Natur, insbesondere der Versuch des Menschen, die Natur durch Sprache und Ordnung zu kultivieren.
Was symbolisiert die Binnengeschichte der Pechbrenner-Familie?
Sie symbolisiert die gescheiterte Flucht aus der Kultur in die Natur während der Pestzeit und zeigt, dass eine Rückkehr in eine „reine Natur“ unmöglich ist.
Warum ist „reine Natur“ laut der Analyse ein Paradox?
Weil jede Natur, die der Mensch wahrnimmt oder beschreibt, bereits durch seine kulturellen Vorstellungen, Begriffe und Hierarchien geprägt ist.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Erzählung?
Der Großvater nutzt die Sprache, um die Natur zu erklären und zu ordnen. Er zeigt dem Jungen, dass Kultur in der Natur verwurzelt ist, indem er Namen und Zeichen deutet.
Wie wird die Pest in „Granit“ dargestellt?
Die Pest wird als göttliches Strafgericht interpretiert, das die natürliche Ordnung wiederherstellt. Die Flucht davor wird als zwecklos und sündhaft dargestellt.
- Quote paper
- Sandra Kuberski (Author), 2011, Kultur und Natur in Adalbert Stifters "Granit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275428