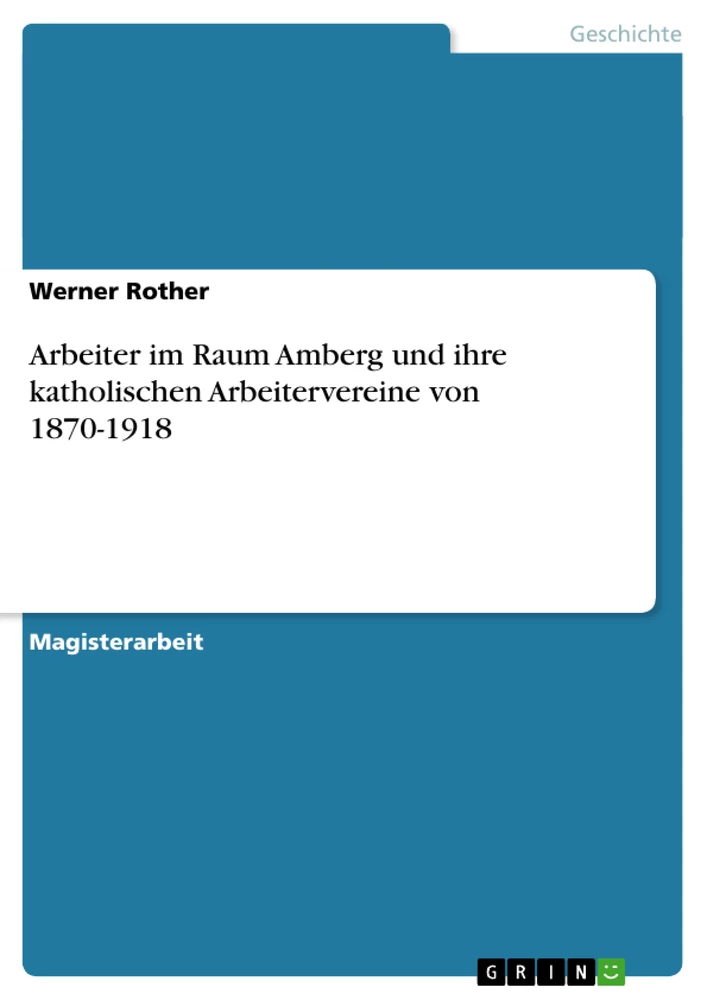Die Stadt Amberg und ihre Umgebung war im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts relativ stark industrialisiert, über 10% der Bewohner arbeiteten in einer der Fabriken, das war die vierthöchste Dichte in Bayern. Es wird oft vermutet, daß diese Arbeiter ihre Interessen durch Organisation in sozialistisch ausgerichteten „freien Gewerkschaften“ und politische Aktivität in der SPD zum Ausdruck gebracht hätten, zumal diese vom nahen Nürnberg aus emsig für sich warben.
Dies war aber keineswegs der Fall, gerade in Amberg und im benachbarten Rosenberger Stahlwerk Maxhütte konnten die Sozialisten trotz mehrfachen Bemühungen keinen Erfolg bei den Arbeitern erzielen. Diese wurden viel eher Mitglied bei den katholischen bzw. christlich-sozialen Arbeitervereinen, deren erster in Amberg 1879 gegründet wurde, zwei weitere, ein Arbeiterinnen-Verein und katholische Arbeitervereine in Rosenberg und Sulzbach folgten später. Diese Vereine sorgten für Belehrung, Geselligkeit und Unterstützung in Notlagen durch Versicherungskassen, von einer wirtschaftlichen Interessenvertretung gegenüber den Arbeitgebern kann man aber nicht reden. Allerdings förderten sie die Bildung der christlichen Gewerkschaften, die in der Region viele Mitglieder fanden und für diese auch Lohnerhöhungen erwirken konnten.
Die Geschichtsschreibung der Arbeiter und ihrer Organisationen konzentriert sich meist auf die sozialistischen Gewerkschaften und Parteien und erwähnt die religiös gebundenen Versuche, die Arbeiter zu organisieren und ihre soziale und rechtliche Stellung zu verbessern, oft nur am Rande. Ähnliches beklagt auch Michaela Bachem-Rehm in ihrer Arbeit über die katholischen Arbeitervereine im Ruhrgebiet und findet, daß dort „die hegemoniale Stellung der Sozialdemokratie ahistorisch zurückdatiert wird“ und „man gleichzeitig den Katholizismus als historische Kraft praktisch tot schweigt“.
Diese Arbeit schildert zunächst die Entwicklung der Firmen in Amberg und der nahen Umgebung, wobei der Schwerpunkt auf die Arbeitsbedingungen, die Löhne und die Führung der Betriebe gelegt wird. Danach wird versucht, aus den bekannten Löhnen und Preisen der Zeit ein Bild der materiellen Lebensbedingungen der Arbeiter zu zeichnen, um einen Anhaltspunkt für ihre Motivation, sich politisch oder sozial zu engagieren und zu organisieren zu gewinnen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Entwicklung der Industrie in Amberg
- Die Amberger Gewehrfabrik
- Die Maxhütte
- Amberger Bergwerk und Luitpoldhütte
- Die Email-Fabrik
- Die soziale Lage der Arbeiter
- Löhne
- Sparen
- Preise und Lebenshaltung
- Konsumvereine
- Arbeitszeit
- Wohnungen
- Sozialkassen
- Arbeitervereine und Gewerkschaften
- Überblick
- Katholische Sozialpolitik und Arbeitervereine
- Anfänge
- Gesellen-Vereine
- Wilhelm Emmanuel von Ketteler
- Päpstliche Enzyklika
- Die katholischen Arbeitervereine
- Der Amberger Katholikentag
- Entwicklung der Arbeitervereine in Bayern
- Der Süddeutsche Verband
- Das Vereinsleben
- Die Vereine für Arbeiterinnen
- Die Entwicklung nach 1918
- Christliche Gewerkschaften
- Arbeitervereine in der Oberpfalz
- Katholische Arbeitervereine
- Die Entwicklung der freien Gewerkschaften
- Amberger Arbeitervereine
- Arbeiter-Vereine in Sulzbach und Rosenberg
- Arbeiterverein der Maxhütte in Leonberg
- Arbeitervereinstag in Amberg
- Josef Habbel und die Amberger Volkszeitung
- „Die Sociale Frage im Lichte des Christentums"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang A
- Anhang B
- Anhang C
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Geschichte der Arbeiter im Raum Amberg und ihre katholischen Arbeitervereine in der Zeit von 1870 bis 1918. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Industrie in Amberg und die damit verbundenen Arbeitsbedingungen und Lebenslagen der Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der katholischen Arbeitervereine als Gegenpol zu den sozialistischen Gewerkschaften und Parteien. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der katholischen Arbeitervereine in Amberg und Umgebung, die Rolle der Kirche und der katholischen Sozialpolitik sowie die Beziehungen zwischen den katholischen Arbeitervereinen, den christlichen Gewerkschaften und den freien Gewerkschaften.
- Die Industrialisierung in Amberg und die Entwicklung der wichtigsten Industriebetriebe
- Die soziale Lage der Arbeiter in Amberg und Umgebung, insbesondere die Löhne, Preise, Lebenshaltungskosten und die Wohnverhältnisse
- Die Rolle der katholischen Kirche und der katholischen Sozialpolitik in der Arbeiterfrage
- Die Entstehung und Entwicklung der katholischen Arbeitervereine in Amberg und der Oberpfalz
- Die Beziehungen zwischen den katholischen Arbeitervereinen, den christlichen Gewerkschaften und den freien Gewerkschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beschreibt die Entwicklung der Industrie in Amberg und Umgebung. Es stellt die wichtigsten Industriebetriebe vor, darunter die Gewehrfabrik, die Maxhütte, das Amberger Bergwerk und die Email-Fabrik Baumann. Das Kapitel beleuchtet die Arbeitsbedingungen, die Löhne und die Führung der Betriebe.
Das dritte Kapitel widmet sich den sozialen Lebensbedingungen der Arbeiter in Amberg. Es analysiert die Löhne, Preise, Lebenshaltungskosten, die Wohnverhältnisse und die soziale Absicherung der Arbeiter anhand von Statistiken und Haushaltsbüchern.
Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehung der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegungen der Zeit. Es untersucht die Entstehung der katholischen Arbeitervereine und der christlichen Gewerkschaften und analysiert die Faktoren der katholischen Sozial- und Arbeiterpolitik.
Das fünfte Kapitel schildert die Geschichte der katholischen Arbeitervereine in Amberg und Umgebung. Es beleuchtet die Gründung und Entwicklung der Vereine sowie ihre Rolle in der Gesellschaft.
Das sechste Kapitel beleuchtet die Rolle von Josef Habbel und der Amberger Volkszeitung im Kontext der sozialen Frage. Es analysiert die Positionen Habbels und der Zeitung zu den Themen Industrialisierung, Arbeiterfrage, Sozialismus und Liberalismus.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Arbeiterbewegung, die katholische Sozialpolitik, die Arbeitervereine, die christlichen Gewerkschaften, die freie Gewerkschaftsbewegung, die Industrialisierung, die soziale Lage der Arbeiter, die Löhne, die Preise, die Lebenshaltungskosten, die Wohnverhältnisse, die Arbeitsbedingungen, die Stadt Amberg und die Oberpfalz. Der Text beleuchtet insbesondere die Rolle der katholischen Arbeitervereine als Gegenpol zu den sozialistischen Gewerkschaften und Parteien im Kontext der Industrialisierung und der sozialen Frage.
Häufig gestellte Fragen
Warum waren katholische Arbeitervereine in Amberg so erfolgreich?
In der stark industrialisierten Region Amberg boten diese Vereine Schutz, Bildung und soziale Absicherung als Alternative zu den sozialistischen Gewerkschaften.
Welche Industriebetriebe prägten den Raum Amberg?
Bedeutende Betriebe waren die Amberger Gewehrfabrik, die Maxhütte in Rosenberg, die Luitpoldhütte und die Email-Fabrik Baumann.
Wie war die soziale Lage der Arbeiter zwischen 1870 und 1918?
Die Arbeit analysiert Löhne, Preise, Wohnverhältnisse und Arbeitszeiten, um ein Bild der materiellen Lebensbedingungen dieser Zeit zu zeichnen.
Wer war Wilhelm Emmanuel von Ketteler?
Er war ein wegweisender Vertreter der katholischen Sozialpolitik, dessen Ideen die Gründung der Arbeitervereine maßgeblich beeinflussten.
Welche Rolle spielte die „Amberger Volkszeitung“?
Herausgegeben von Josef Habbel, war sie ein wichtiges Sprachrohr für die christlich-soziale Sicht auf die Industrialisierung und die „soziale Frage“.
- Quote paper
- Werner Rother (Author), 2012, Arbeiter im Raum Amberg und ihre katholischen Arbeitervereine von 1870-1918, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275453