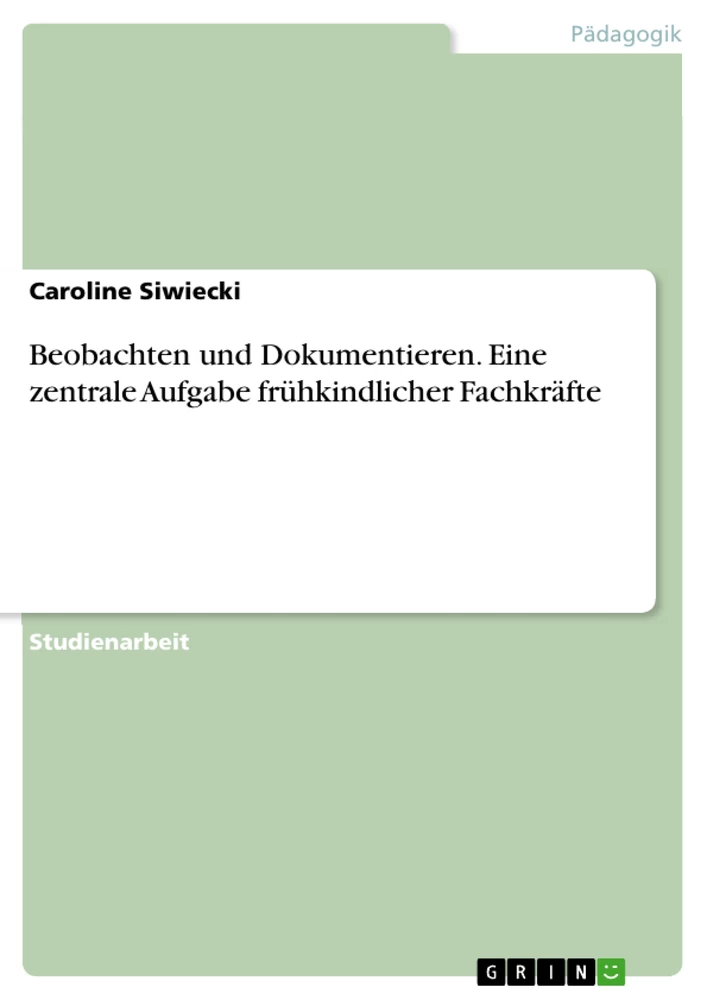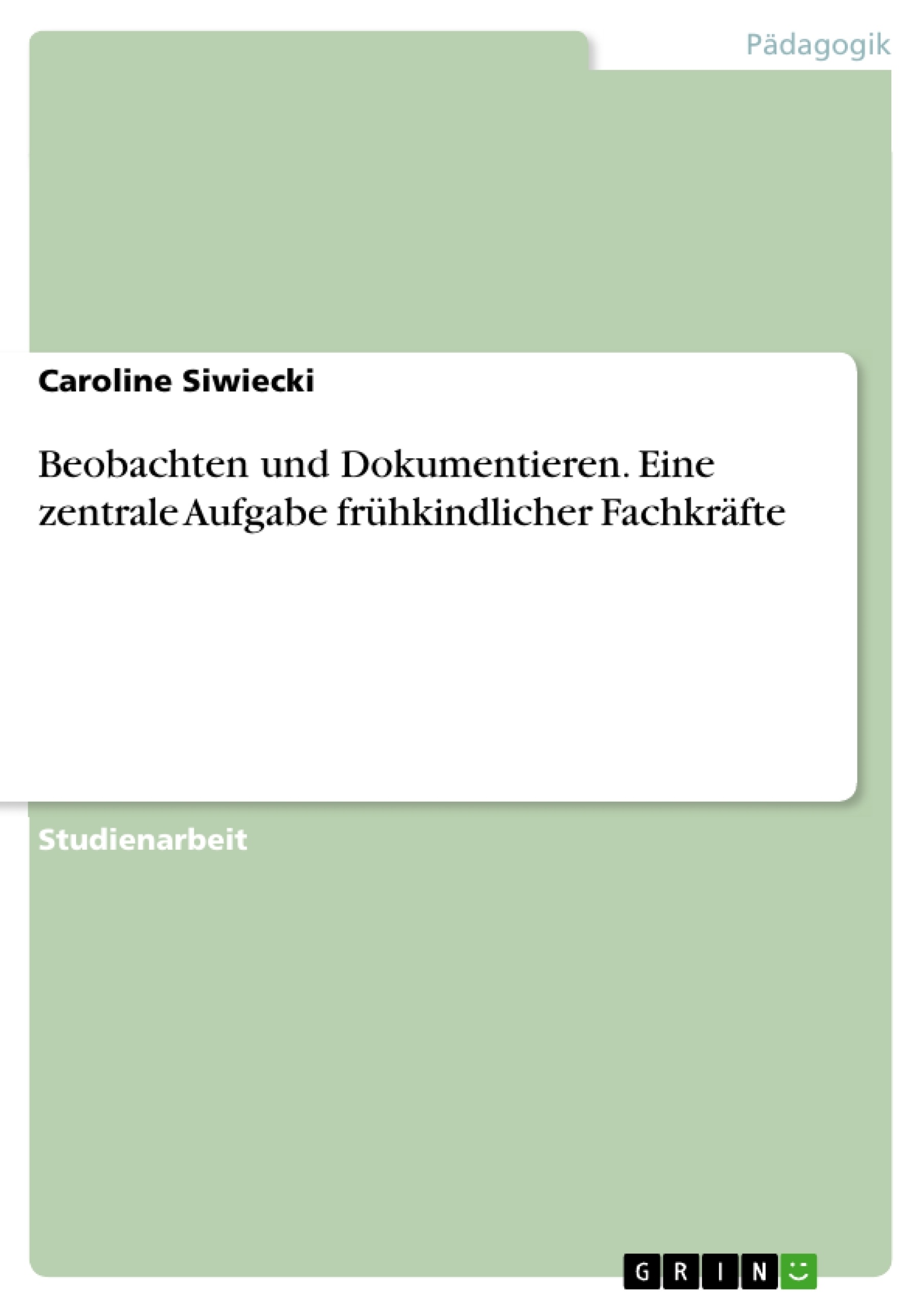Kinder in ihrem Tun zu beobachten und wahrzunehmen ist schon lange ein wichtiger Bestandteil im Handeln von frühpädagogischen Fachkräften und insofern nicht neu. Jedoch fand erst binnen des letzten Jahrzehnts die Beschreibung der Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte, in bildungspolitischen Maßnahmen und in der frühpädagogischen Praxis, eine Entsprechung. Besonders hervorzuheben sei in diesem Kontext die Publikation der ersten PISA Ergebnisse. Obwohl es sich in dieser Untersuchung um unzureichende Leistungen von Schülerinnen und Schüler handelt, trug diese maßgeblich zu einer „gesellschaftlichen Neuentdeckung der Bedeutung frühkindlicher Bildung“ bei (Leu u.a. 2007, S. 11). Seitdem entstanden neben Veröffentlichungen von Rahmen-, Orientierungs- und Bildungsplänen, auch eine Bandbreite an Maßnahmen, die kindliche Bildungsprozesse professionell unterstützen sollen - so zum Beispiel vielfältige Beobachtungs und Dokumentationsverfahren.
Es wird ein kurzer Überblick über die bunte Landschaft der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren gezeigt Anschließend wird auf die wahrnehmende Beobachtungsform nach Gerd Schäfer einzugehen. Dieses Verfahren ist für die pädagogische Praxis sehr empfehlenswert, um kindliche Bildungsprozesse nachvollziehbar zu machen und um diese im Anschluss begleitend unterstützen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in der frühpädagogischen Landschaft in Deutschland
- Vielfalt und Varianz
- Wahrnehmendes, entdeckendes Beobachten als wesentlicher Teil professioneller Kompetenz von pädagogischen Fachkräften
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der zentralen Aufgabe von frühpädagogischen Fachkräften, Kinder zu beobachten und zu dokumentieren. Sie analysiert die Bedeutung dieser Praxis im Kontext der aktuellen Bildungslandschaft und der sich wandelnden Rolle von Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte. Die Arbeit beleuchtet die Vielfalt und Varianz von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in Deutschland und stellt die Herausforderungen und Chancen der praktischen Umsetzung in den Vordergrund.
- Die Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation für die Förderung kindlicher Bildungsprozesse
- Die Vielfalt der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in der frühpädagogischen Praxis
- Die Herausforderungen der praktischen Umsetzung von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren
- Die Bedeutung einer wertschätzenden und offenen Beobachtungsform
- Die Rolle von Beobachtung und Dokumentation für die professionelle Kompetenz von frühpädagogischen Fachkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Beobachtung und Dokumentation in der frühpädagogischen Praxis ein. Es beleuchtet die aktuelle bildungspolitische Entwicklung und den wachsenden Stellenwert von Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte. Die Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation für die Unterstützung und Begleitung kindlicher Bildungsprozesse wird betont.
Das zweite Kapitel widmet sich der Vielfalt der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in der frühpädagogischen Landschaft in Deutschland. Es werden verschiedene Verfahren vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf ihre Eignung für die praktische Umsetzung in Kindertageseinrichtungen diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen gerichteter und ungerichteter Aufmerksamkeit und den unterschiedlichen Ansätzen der Verfahren.
Der zweite Teil des zweiten Kapitels beschäftigt sich mit der wahrnehmenden und entdeckenden Beobachtungsform nach Gerd Schäfer. Es wird der Grundgedanke dieser Form der Beobachtung erläutert, die auf einer konstruktivistischen Perspektive basiert und die Ganzheitlichkeit des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Die Bedeutung der Reflexion der eigenen Gefühle und Wahrnehmungen für die Qualität der Beobachtung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Beobachtung, Dokumentation, frühpädagogische Praxis, Kindertageseinrichtungen, Bildungslandschaft, Bildungsprozesse, Bildungsvereinbarung NRW, Entwicklung, Kompetenzprofil, Aktivitäten, Selbstbildungsprozesse, gerichtete Aufmerksamkeit, ungerichtete Aufmerksamkeit, wahrnehmende Beobachtung, entdeckende Beobachtung, Reflexion, professionelle Kompetenz, anthropologisches Verständnis.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Beobachtung in der Frühpädagogik heute so wichtig?
Seit den PISA-Ergebnissen werden Kitas verstärkt als Bildungsorte wahrgenommen. Professionelle Beobachtung hilft dabei, kindliche Bildungsprozesse nachvollziehbar zu machen und gezielt zu unterstützen.
Was zeichnet das Verfahren nach Gerd Schäfer aus?
Es handelt sich um eine wahrnehmende und entdeckende Beobachtungsform, die auf einer konstruktivistischen Perspektive basiert und die Ganzheitlichkeit des Kindes sowie die Reflexion der Fachkraft betont.
Was ist der Unterschied zwischen gerichteter und ungerichteter Aufmerksamkeit?
Gerichtete Aufmerksamkeit fokussiert auf bestimmte Lernziele oder Defizite, während ungerichtete Aufmerksamkeit offen für die individuellen Selbstbildungsprozesse und Interessen des Kindes bleibt.
Welche Rolle spielt die Dokumentation für pädagogische Fachkräfte?
Dokumentation ist ein wesentlicher Teil der professionellen Kompetenz. Sie dient der Reflexion des pädagogischen Handelns und ist Grundlage für Bildungsvereinbarungen (z.B. in NRW).
Wie beeinflussen bildungspolitische Maßnahmen die Praxis in Kitas?
Maßnahmen wie Bildungspläne und standardisierte Dokumentationsverfahren fordern von Fachkräften eine systematischere und professionellere Begleitung kindlicher Entwicklung.
- Citar trabajo
- Caroline Siwiecki (Autor), 2012, Beobachten und Dokumentieren. Eine zentrale Aufgabe frühkindlicher Fachkräfte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275522