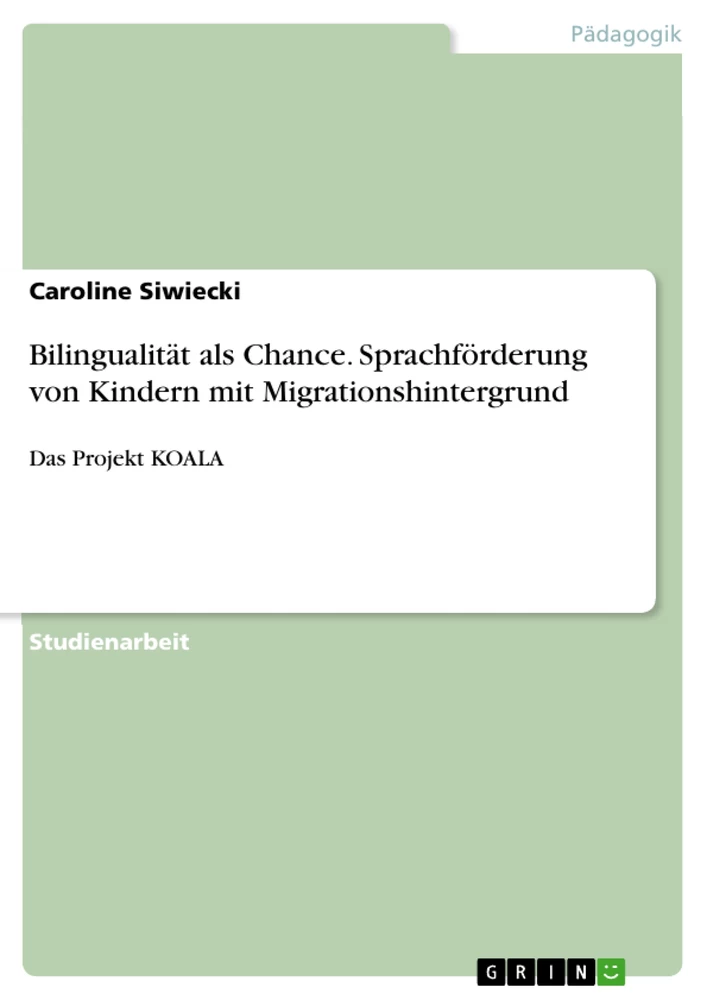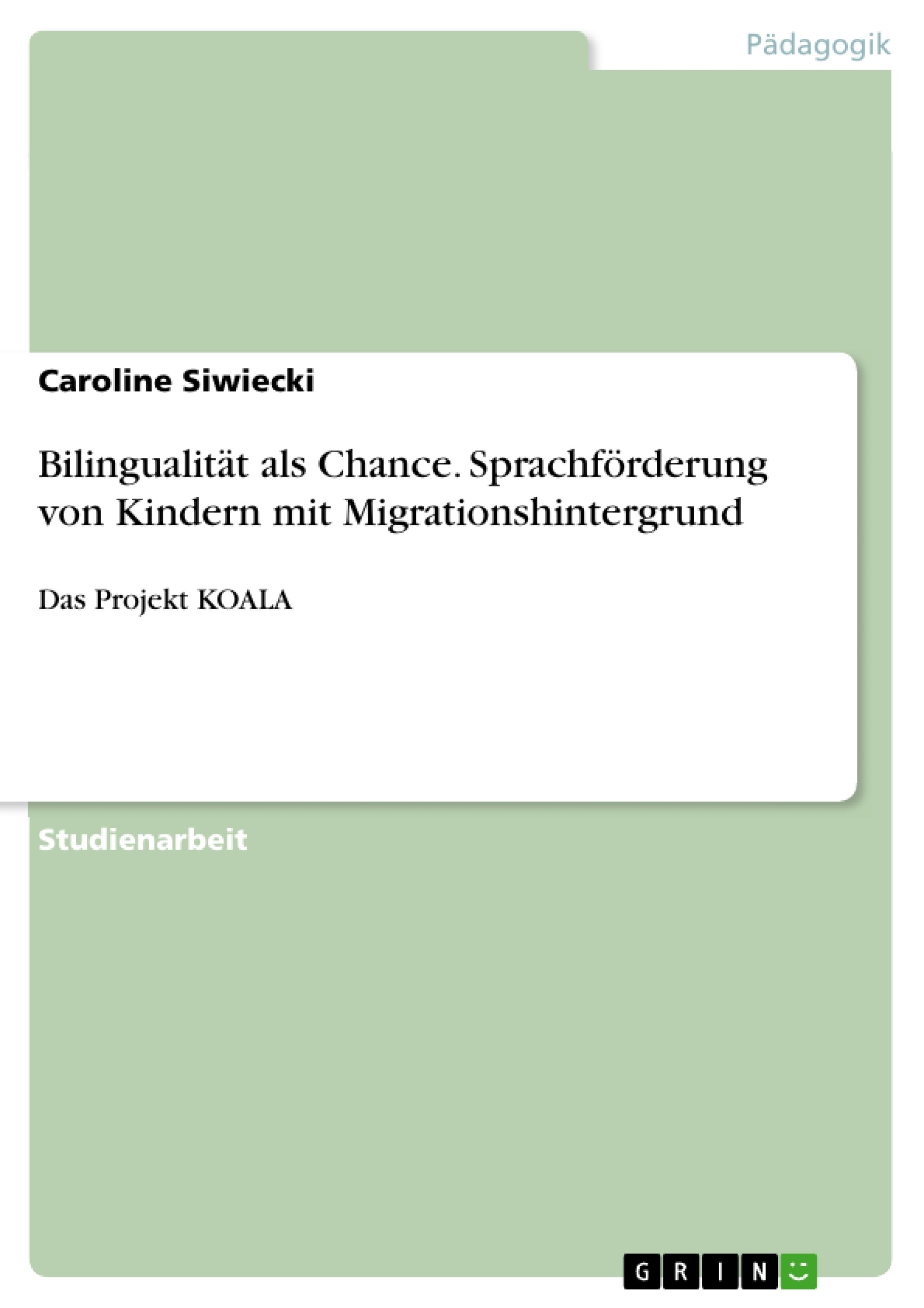Spätestens seit dem „PISA-Schock“ im Jahre 2001 wissen wir, dass
neben sozialschichtbedingten Gründen besonders die Sprachkompetenz für die Bildungslaufbahn von Kindern mit Migrationshintergrund ausschlaggebend ist. So überschritten nur knapp 50 Prozent der jugendlichen Migranten die elementare Lesekompetenzstufe 1, obwohl über 70 Prozent von ihnen eine vollständige Schullaufbahn hinter sich haben (vgl. Deutsches Pisakonsortium 2001: 374ff.).
Nicht unerheblich verantwortlich für das schlechte Ergebnis bei
Kindern mit Migrationshintergrund vergleichend mit der Gruppe
ohne Migrationshintergrund, ist der Umgang mit dem Thema
Mehrsprachigkeit und Heterogenität in unserem Bildungssystem.
Hinsichtlich der nationalstaatlichen Entwicklung herrscht immer
noch die Denkweise von einer monolingualen Homogenität in
deutschen Schulen vor. Dieses Konstrukt gilt allerdings als längst
überholt. Es genügt, sich nur einmal auf den Hof einer willkürlich
gewählten Schule zu begeben, um von der Sprachenvielfalt- und
dem unterschiedlichen Sprachenniveau der Schülerschaft überwältigt zu werden (vgl. Geißler 1992: 67).
Mehrsprachigkeit wird nur zum Teil als gesellschaftlich, ökonomisch und politisch Wertvoll gesehen. Während Sprachen wie Englisch und Französisch als Garantie für eine Bildungskarriere gelten, gibt es für Migrantensprachen wie Türkisch oder Polnisch kaum Anerkennung. Paradoxerweise steigt die Nachfrage nach diesen minder wertgeschätzten Migrantensprachen in der Wirtschaft.
Und betrachtet man den demographischen Wandel in Deutschland, so bedeutet diese Nichtanerkennung letztendlich
auch eine enorme Ressourcenverschwendung.
Vor diesem Hintergrund geht es im Folgenden allgemein darum,
geeignete Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Bil2
dungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund zu finden.
Wie sich herauskristallisiert hat, ist der Schlüssel zur Bildungskarriere die Sprachkompetenz. Besonders im Fokus steht daher auch das Projekt KOALA. Dem Ansatz zufolge wird die deutsche Sprachkompetenz effektiver gefördert, sofern die Muttersprache mitberücksichtigt und in den Unterricht eingebunden wird. Inwieweit das Förderprojekt erfolgsversprechend ist, soll hier unter anderem gezeigt werden.
Um den Umgang mit Zweisprachigkeit bei Kindern mit Migrationshintergrund zu untersuchen, ist es Naheliegend, zunächst Bilingualität zu definieren und verschiedene Ansätze kennen zu lernen [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bilingualität bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Definition Bilingualität
- Arten der Bilingualität
- Der Erwerb von Bilingualität
- Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprache
- Sprachunterricht und Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund in der Grundschule
- Anforderungen an Grundschullehrer bezogen auf die Förderung des deutschsprachigen Unterrichts
- Das Projekt KOALA
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund, insbesondere mit dem Projekt KOALA. Ziel ist es, die Bedeutung von Bilingualität für den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund zu beleuchten und die Wirksamkeit des Projekts KOALA zu bewerten.
- Bilingualität und ihre verschiedenen Formen
- Der Spracherwerbsprozess bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb
- Anforderungen an den Deutschunterricht in der Grundschule
- Das Projekt KOALA als Konzept zur Förderung der deutschen Sprachkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Sprachkompetenz für den Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund und führt in das Thema Bilingualität ein.
Das Kapitel „Bilingualität bei Kindern mit Migrationshintergrund" definiert den Begriff Bilingualität, beschreibt verschiedene Arten der Bilingualität und erläutert den Spracherwerbsprozess bei Kindern mit Migrationshintergrund.
Das Kapitel „Sprachunterricht und Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund in der Grundschule" behandelt die Anforderungen an den Deutschunterricht in der Grundschule und stellt das Projekt KOALA als ein Konzept zur Förderung der deutschen Sprachkompetenz vor.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bilingualität, Sprachförderung, Kinder mit Migrationshintergrund, Deutschunterricht, Grundschule, Projekt KOALA, Interdependenztheorie, Erstsprache, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Inklusion.
- Quote paper
- Caroline Siwiecki (Author), 2013, Bilingualität als Chance. Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275528