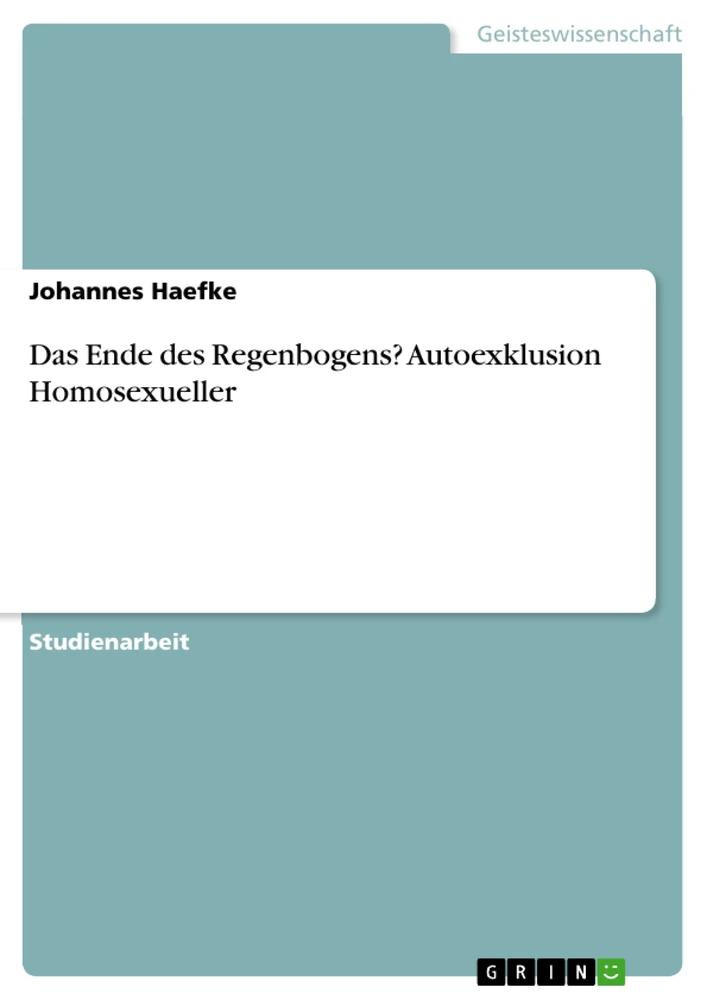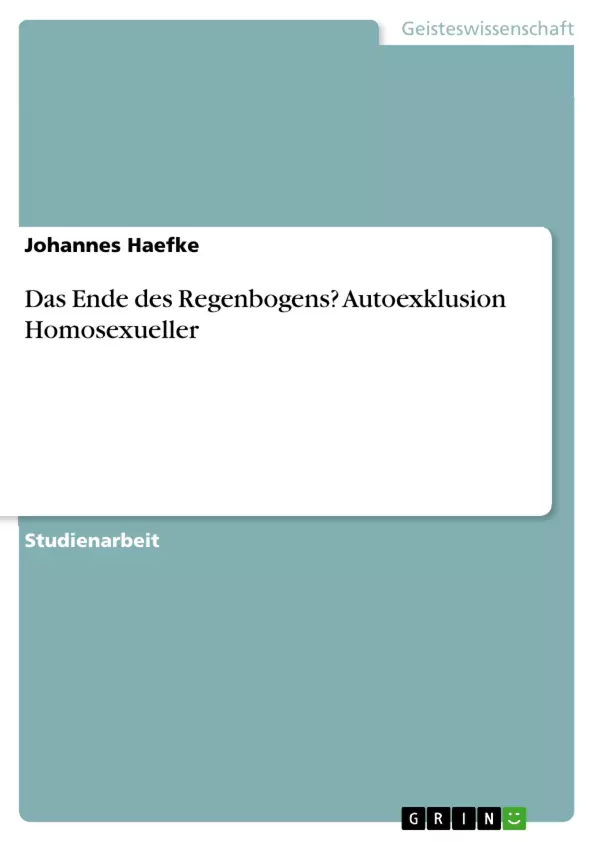Die Exklusion Homosexueller ist in unserer Gesellschaft noch immer vorhanden, wenn auch nicht mehr in einem Maße, wie es noch vor zwanzig Jahren war. Diese Arbeit will zeigen, was vor allem von Seiten der Homosexuellen noch zu tun ist, um eine echte Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu erzeugen. Dazu wird die homosexuelle Subkultur einer kritischen Betrachtung unterzogen, da davon ausgegangen wird, dass diese Resultat und Bedingung für die gesellschaftliche Exklusion darstellt. Im Hinblick auf die Soziale Arbeit werden Konsequenzen aus den Erkenntnissen gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1. Einleitung
- 2. Einstellungen zur Homosexualität und gesellschaftlicher Normalisierungsprozess
- 2.1 Stigmatisierung und Diskriminierung
- 2.1.1 Diskriminierungsaspekte der derzeitigen rechtlichen Situation
- 2.1.2 Pädophilie und Homosexualität als ansteckende Krankheit
- 2.1.3 Homosexualität und HIV
- 2.2 Ursachen für Homophobie
- 3. Exklusion von Homosexualität und deren Folgen
- 3.1 Exklusion von Homosexualität
- 3.2 Konsequenzen der Exklusion
- 3.3 Autoexklusion als spezielle Form der Exklusion
- 4. Die homosexuelle Subkultur und ihre Darstellung
- 4.1 Entstehung der Subkultur
- 4.2 Kritik an der Subkultur
- 4.2.1 Wahrnehmung der Subkultur durch die Gesellschaft
- 4.2.2 Der Christopher-Street-Day als Ausdruck der Sexualisierung
- 5. Autoexklusion durch die homosexuelle Subkultur
- 6. Inklusion und Inklusionsprozesse
- 6.1 Überwindung der Subkultur
- 6.2 Stärkung des Normalisierungsprozesses
- 7. Möglichkeiten für die Soziale Arbeit
- 7.1 Rückzug Sozialer Arbeit aus der Subkultur
- 7.3 Unterstützung des Emanzipationsprozesses Homosexueller
- 7.3 Kompetenzen in der Sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die homosexuelle Subkultur ein Ausdruck von Autoexklusion ist und welche Folgen diese für die Integration und Gleichstellung von Homosexuellen in der Gesellschaft hat. Dabei werden die Ursachen für die Diskriminierung und Stigmatisierung von Homosexuellen analysiert, die Entstehung und Kritik an der homosexuellen Subkultur beleuchtet und Möglichkeiten für die Soziale Arbeit aufgezeigt, um Inklusion und Emanzipation zu fördern.
- Diskriminierung und Stigmatisierung von Homosexuellen
- Entstehung und Kritik an der homosexuellen Subkultur
- Autoexklusion als spezielle Form der Exklusion
- Möglichkeiten für die Soziale Arbeit zur Förderung von Inklusion und Emanzipation
- Der Normalisierungsprozess und die Überwindung der Subkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Motivation für das Thema erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Einstellungen zur Homosexualität in der Gesellschaft beleuchtet, wobei Diskriminierung, Stigmatisierung und Homophobie im Fokus stehen. Kapitel 3 definiert den Begriff der Exklusion und analysiert die Folgen von Exklusion für Homosexuelle. Die Autoexklusion wird als eine besondere Form der Exklusion vorgestellt, die durch die homosexuelle Subkultur verstärkt wird. Im vierten Kapitel werden die Entstehung und die Kritik an der homosexuellen Subkultur genauer betrachtet. Kapitel 5 befasst sich mit der Frage, inwieweit die Subkultur eine Form von Autoexklusion darstellt. Kapitel 6 behandelt den Prozess der Inklusion und die Möglichkeiten, die Subkultur zu überwinden. Im siebten Kapitel werden die Möglichkeiten für die Soziale Arbeit dargestellt, um Inklusion und Emanzipation zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenfelder Homosexualität, Subkultur, Exklusion, Autoexklusion, Stigmatisierung, Diskriminierung, Homophobie, Inklusion, Emanzipation, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Autoexklusion Homosexueller?
Autoexklusion beschreibt eine Form der Selbstausgrenzung, bei der die homosexuelle Subkultur zwar Schutz bietet, aber gleichzeitig eine Barriere zur vollständigen gesellschaftlichen Inklusion bilden kann.
Warum wird die homosexuelle Subkultur kritisch betrachtet?
Die Arbeit hinterfragt, ob die starke Fokussierung auf die Subkultur und deren Sexualisierung (z. B. beim CSD) den Normalisierungsprozess in der Mehrheitsgesellschaft eher behindert.
Was sind die Ursachen für Homophobie laut dem Text?
Analysiert werden gesellschaftliche Vorurteile, Stigmatisierungen (z. B. im Kontext von HIV) und die rechtliche Situation, die Diskriminierung begünstigen.
Welche Rolle hat die Soziale Arbeit in diesem Kontext?
Soziale Arbeit sollte Inklusionsprozesse fördern, den Emanzipationsprozess unterstützen und ggf. eine kritische Distanz zur reinen Subkulturarbeit einnehmen, um echte Gleichberechtigung zu forcieren.
Was ist das Ziel der gesellschaftlichen Normalisierung?
Ziel ist eine echte Gleichberechtigung, bei der sexuelle Orientierung keine exkludierende Rolle mehr spielt und die Notwendigkeit separater Subkulturen abnimmt.
- Citar trabajo
- Johannes Haefke (Autor), 2014, Das Ende des Regenbogens? Autoexklusion Homosexueller, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275529