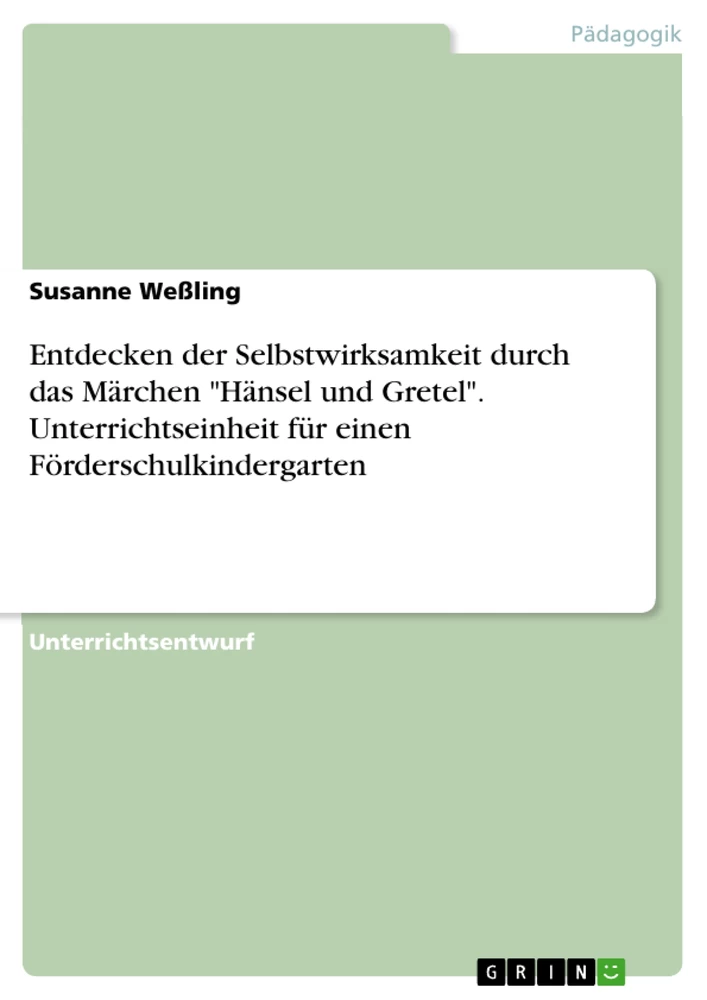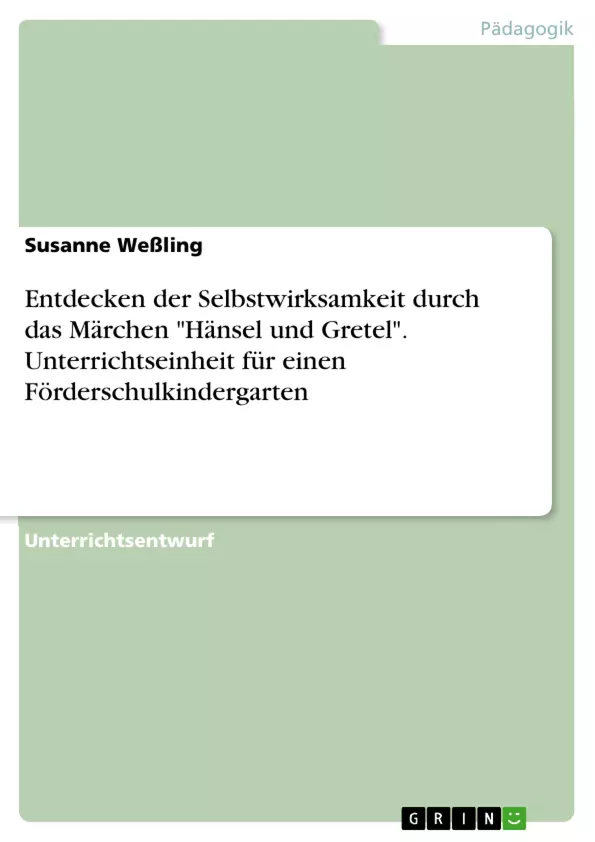Märchen entführen Kinder in eine wunderbare Traumwelt, sie beflügeln ihre Fantasie durch ihre bildhafte Sprache und sprechen besonders ihre Gefühle an.
Gerade für Kinder ist der Schatz der Märchen sehr umfangreich. Obwohl es verschiedene Formen von Literatur für Kinder gibt, sind es aus meiner Erfahrung die Märchen, die die Kinder am meisten emotional ansprechen.
Einerseits haben Kinder noch kaum Worte für Ihre Empfindungen, andererseits verstehen sie auf der Bewusstseinsebene ihrer Entwicklung schon einiges vom Leben und den Konflikten, die es auszutragen gilt. Damit es den Kindern aber heute gelingt, sich bei den vielen Angeboten und Erwartungen zurechtzufinden, brauchen sie Orientierungshilfen, d.h. sie brauchen äußere Vorbilder und innere Leitbilder, die ihnen Halt bieten. Diese Orientierungshilfen zur Bewältigung altersentsprechender Aufgaben können ihnen die Märchen bieten. Sie behandeln zwar nicht die Probleme, die Kinder in der heutigen Zeit haben können, doch lassen sich Bezüge zu den inneren Konflikten, denen sich Kinder oftmals ausgesetzt fühlen, herstellen. Das Märchen unterhält die Kinder, klärt sie über ihr Innerstes auf und fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Märchen
- 2.1. Der Begriff „Märchen“ und seine Bedeutung
- 2.2 Das Volksmärchen im Vergleich zum Kunstmärchen
- 3. Das Volksmärchen „Hänsel und Gretel“
- 3.1. Inhalt des Märchens „Hänsel und Gretel“
- 3.2. Begründung für die Wahl des Märchens "Hänsel und Gretel"
- 3.3. Der Begriff „Selbstwirksamkeit“ und seine Bedeutung
- 4. Zielsetzung aus den Vorüberlegungen
- 4.1. Begründung für die Wahl der Zielsetzung
- 4.2. Erläuterung der Zielsetzung
- 5. Lerngruppe und Rahmenbedingungen
- 5.1. Vorstellung der Lerngruppe
- 5.2. Räumliche Rahmenbedingungen
- 5.3. Personelle Rahmenbedingungen
- 6. Darstellung der Methoden und Medien
- 6.1. Methoden
- 6.2. Gelenktes Rollenspiel
- 6.3. Medien
- 7. Darstellung der Unterrichtsreihe
- 8. Exemplarische Darstellung einer Unterrichtsstunde
- 8.1. Begründung für die Wahl der Zielsetzung
- 8.2. Erläuterung der Zielsetzung
- 8.3. Begründung und Erläuterung des Inhalts
- 8.4. Lernvoraussetzungen
- 8.5. Stundenverlauf
- 8.6. Reflexion der Unterrichtsstunde
- 9. Reflexion der Themenreihe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt eine Unterrichtsreihe zum Märchen Hänsel und Gretel für hörgeschädigte Kinder im Kindergartenalter. Ziel ist es, den Kindern das Märchen näherzubringen und ihnen gleichzeitig ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln, indem sie das Verhalten der Protagonisten analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Märchen für die kindliche Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung von Konflikten und die Förderung der emotionalen Intelligenz.
- Bedeutung von Märchen für die kindliche Entwicklung
- Förderung der Selbstwirksamkeit durch Märchen
- Analyse des Märchens „Hänsel und Gretel“
- Methodische Umsetzung der Unterrichtsreihe im Förderschulkindergarten
- Reflexion der Unterrichtsreihe und deren Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Wahl des Themas „Märchen“ im Förderschulkindergarten für hörgeschädigte Kinder, unter anderem aufgrund des Mangels an häuslichem Märchenvorlesen und der Bedeutung von Märchen für die emotionale Entwicklung und Konfliktbewältigung. Die Autorin betont die Bedeutung von Märchen als Orientierungshilfe in einer von Medien geprägten Welt, die Kinder oft mit Passivität und einem Mangel an Selbstwirksamkeit konfrontiert.
2. Märchen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Märchen“ und differenziert zwischen Volks- und Kunstmärchen. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Märchens, seine Funktion als Bewahrer alter Weisheiten und Vermittler von Werten, sowie die charakteristischen Merkmale von Märchenfiguren und -handlungen. Der Fokus liegt auf der Konfliktsituation als Ausgangspunkt und der Überwindung von Hindernissen als zentrales Thema.
3. Das Volksmärchen „Hänsel und Gretel“: Dieses Kapitel analysiert den Inhalt des Märchens „Hänsel und Gretel“, begründet die Wahl dieses spezifischen Märchens für die Unterrichtsreihe und erklärt den Begriff „Selbstwirksamkeit“ im Kontext der kindlichen Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf der Relevanz des Märchens für die Zielsetzung der Arbeit.
4. Zielsetzung aus den Vorüberlegungen: In diesem Kapitel wird die Zielsetzung der Unterrichtsreihe präzise formuliert und detailliert begründet. Es wird dargelegt, warum die gewählte Zielsetzung für die Lerngruppe geeignet ist und wie diese erreicht werden soll.
5. Lerngruppe und Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe (hörgeschädigte Kinder im Kindergarten), die räumlichen und personellen Rahmenbedingungen der Unterrichtsreihe im Förderschulkindergarten. Es bietet Kontextinformationen für die methodische Gestaltung der Unterrichtsreihe.
6. Darstellung der Methoden und Medien: Hier werden die gewählten Methoden und Medien der Unterrichtsreihe vorgestellt und begründet. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung des gelenkten Rollenspiels als zentrale Methode.
7. Darstellung der Unterrichtsreihe: Ein Überblick über die gesamte Unterrichtsreihe und deren Aufbau. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Unterrichtseinheiten erfolgt im Folgekapitel.
8. Exemplarische Darstellung einer Unterrichtsstunde: Dieses Kapitel präsentiert eine exemplarische Unterrichtsstunde, einschließlich Begründung der Zielsetzung, Erläuterung des Inhalts, Beschreibung der Lernvoraussetzungen und des Stundenverlaufs, sowie einer Reflexion der Stunde. Es bietet einen detaillierten Einblick in die praktische Umsetzung der Unterrichtsreihe.
Schlüsselwörter
Märchen, Hänsel und Gretel, Selbstwirksamkeit, Förderschule, Hörgeschädigte Kinder, Kindergarten, Unterrichtsreihe, Rollenspiel, emotionale Entwicklung, Konfliktbewältigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsreihe "Hänsel und Gretel"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschreibt eine detaillierte Unterrichtsreihe zum Märchen "Hänsel und Gretel" für hörgeschädigte Kinder im Kindergartenalter. Sie umfasst eine Einleitung, eine theoretische Auseinandersetzung mit Märchen, eine Analyse des Märchens "Hänsel und Gretel", die Definition der Lernziele, die Beschreibung der Lerngruppe und der Rahmenbedingungen, die Darstellung der verwendeten Methoden und Medien, einen Überblick über die gesamte Unterrichtsreihe sowie die exemplarische Darstellung einer einzelnen Unterrichtsstunde und eine abschließende Reflexion.
Welche Themen werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die zentrale Thematik ist das Märchen "Hänsel und Gretel" und seine Bedeutung für die Entwicklung hörgeschädigter Kinder. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Förderung der Selbstwirksamkeit der Kinder durch die Auseinandersetzung mit den Protagonisten und ihren Herausforderungen, der Bedeutung von Märchen für die emotionale Entwicklung und Konfliktbewältigung sowie der methodischen Umsetzung im Förderschulkindergarten.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, den Kindern das Märchen "Hänsel und Gretel" näherzubringen und ihnen gleichzeitig ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Die Kinder sollen die Handlung analysieren und ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle in Bezug auf die Geschichte reflektieren. Die Förderung der emotionalen Intelligenz und der Fähigkeit zur Konfliktbewältigung sind ebenfalls wichtige Lernziele.
Welche Methoden und Medien werden eingesetzt?
Die Hauptmethode ist das gelenkte Rollenspiel, welches die aktive Beteiligung der Kinder und die emotionale Auseinandersetzung mit dem Märchen fördert. Zusätzlich werden weitere, im Text nicht näher spezifizierte, Medien eingesetzt, die die Unterrichtsreihe unterstützen.
Welche Lerngruppe wird betrachtet?
Die Lerngruppe besteht aus hörgeschädigten Kindern im Kindergartenalter eines Förderschulkindergartens. Die Arbeit berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Kindergruppe.
Wie ist die Unterrichtsreihe aufgebaut?
Die Unterrichtsreihe ist in mehrere Einheiten gegliedert, wobei ein Kapitel eine exemplarische Unterrichtsstunde detailliert beschreibt, inklusive Begründung der Ziele, des Inhalts, der Lernvoraussetzungen, des Stundenverlaufs und einer Reflexion.
Welche Bedeutung haben Märchen für die kindliche Entwicklung?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Märchen für die emotionale Entwicklung und Konfliktbewältigung von Kindern. Märchen bieten Orientierungshilfe und helfen Kindern, mit Herausforderungen und Gefühlen umzugehen. Sie dienen als Vermittler von Werten und als Bewahrer alter Weisheiten.
Was ist Selbstwirksamkeit im Kontext dieser Arbeit?
Selbstwirksamkeit beschreibt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Herausforderungen zu meistern und Ziele zu erreichen. In dieser Arbeit wird untersucht, wie das Märchen "Hänsel und Gretel" dazu beitragen kann, die Selbstwirksamkeit bei hörgeschädigten Kindern zu fördern.
Welche konkreten Aspekte des Märchens "Hänsel und Gretel" werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Inhalt des Märchens, um dessen Relevanz für die Zielsetzung der Unterrichtsreihe aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Konfliktsituationen und der Überwindung von Hindernissen durch die Protagonisten.
Wie wird die Unterrichtsreihe reflektiert?
Die Arbeit enthält eine Reflexion der gesamten Unterrichtsreihe und der exemplarischen Unterrichtsstunde. Diese Reflexion dient der Evaluation der Wirksamkeit der gewählten Methoden und der Anpassung der Unterrichtsreihe an die Bedürfnisse der Lerngruppe.
- Quote paper
- Susanne Weßling (Author), 2014, Entdecken der Selbstwirksamkeit durch das Märchen "Hänsel und Gretel". Unterrichtseinheit für einen Förderschulkindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275620