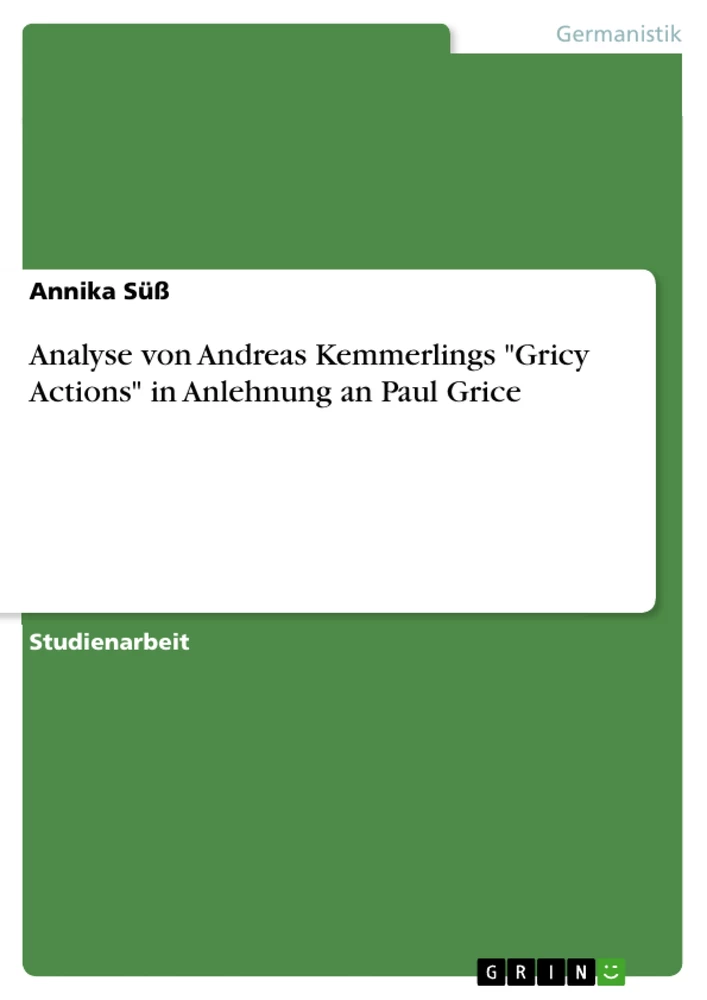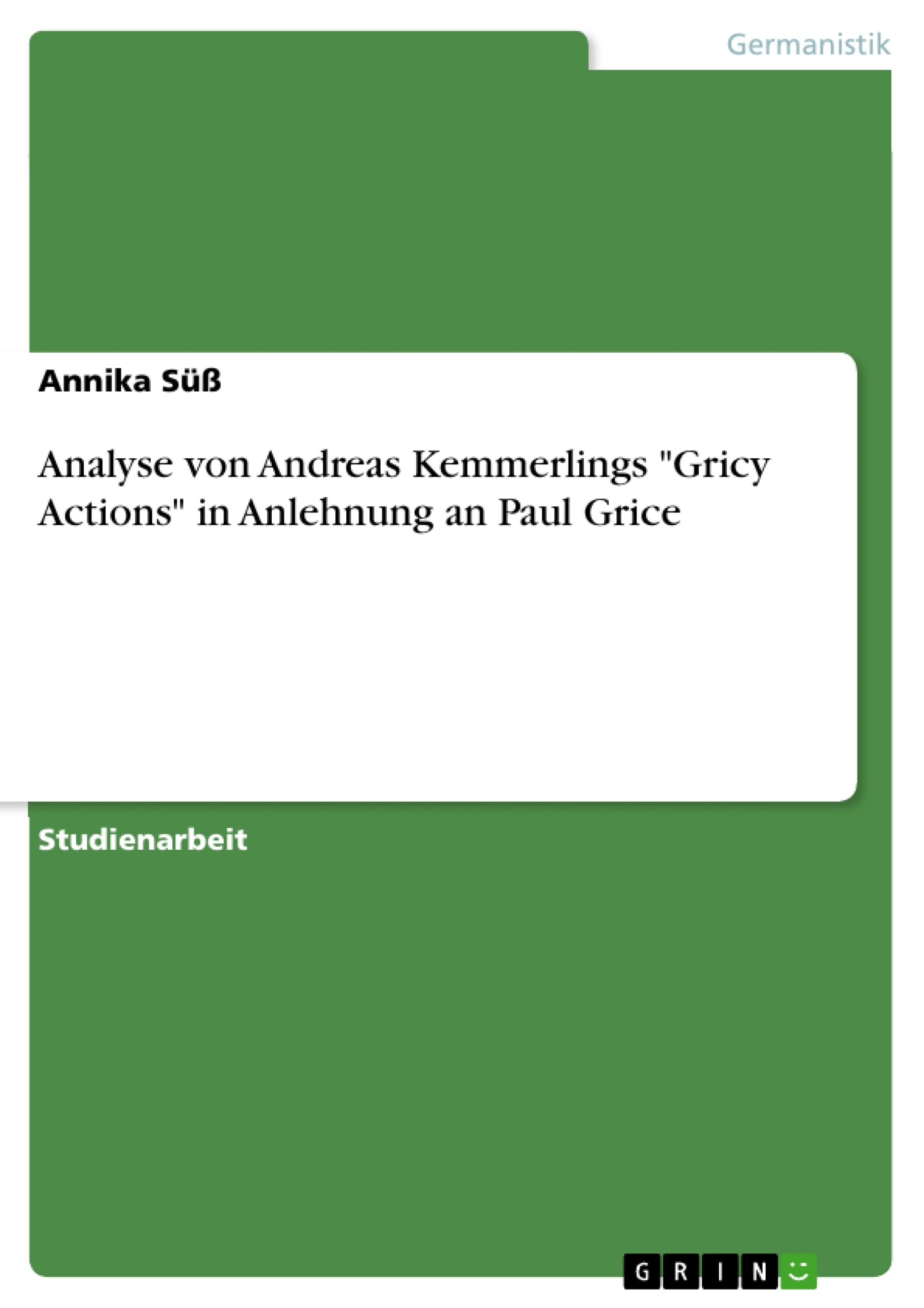Es gibt unterschiedliche Typen von Sprechakten: lokutionäre Akte, illokutionäre Akte, propositionale Akte, perlokutionäre Akte etc.
Ein weiterer Sprechakttyp sind die sogenannten „gricy actions“ nach Paul Grice, die eine weitere Art von Äußerungen wiedergeben. Die Namensgebung dieser Sprechakte beruht auf einer gleichnamigen Arbeit von Andreas Kemmerling, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Diese Arbeit befasst sich mit jenem Text, „Gricy Actions“ von Kemmerling. Diese Art von Äußerungen ist eine weitere Form von sprachlichem Vorgehen, die in dieser Arbeit erklärt und erörtert werden soll.
Kemmerlings Arbeit thematisiert jedoch nicht nur die „gricy Actions“ an sich, sondern diesem Kapitel gehen weitere Themenabschnitte der Sprechakttheorien voran, die ebenfalls, jedoch nur kurz, angerissen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ein Anriss über Grice und Austin
- 2. „Gricy actions“
- 2.1 „Gricy actions“ vs. „Non-gricy actions“
- 2.2 Sind alle zentralen illokutionären Akte „gricy actions“?
- 2.3 „Para-gricy actions“
- 2.3.1 „Failed gricy actions“
- 3. Perlokutionäre Sprechakte als „gricy actions“?
- 4. „Gricy actions“: Widersprüche
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Sprechakttyp „Gricy actions“ nach Paul Grice, wie er von Andreas Kemmerling in seinem Text „Gricy Actions“ definiert wird. Ziel ist es, die „Gricy actions“ zu erklären und zu erörtern, ihre Verwendung als Sprechakte zu beleuchten und die Frage zu beantworten, wann ein illokutionärer Akt als „gricy“ zu klassifizieren ist.
- Definition und Abgrenzung von „Gricy actions“
- Untersuchung der Intentionen des Sprechers bei „Gricy actions“
- Analyse der Wirkung von „Gricy actions“ auf den Adressaten
- Kritik und Widersprüche hinsichtlich der „Gricy actions“
- Resümee der Kernaussagen Kemmerlings und möglicher Widersprüchlichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sprechakttheorien ein und stellt die verschiedenen Typen von Sprechakten vor, darunter illokutionäre, perlokutionäre und „gricy actions“. Die Arbeit konzentriert sich auf die „gricy actions“ und untersucht, wie sie sich von anderen Sprechakten unterscheiden.
Kapitel 1 beleuchtet die Ansichten von Austin und Grice zu illokutionären Akten und zeigt auf, dass Austin in seiner Klassifizierung von illokutionären Akten als essentiell konventionell falsch lag, da die Intentionen des Sprechers eine entscheidende Rolle spielen.
Kapitel 2 definiert „Gricy actions“ und grenzt sie von „Non-gricy actions“ ab. Es wird erläutert, dass eine „gricy action“ durch die klare Absicht des Sprechers, etwas zu tun, gekennzeichnet ist, während die tatsächliche Ausführung der Handlung nicht zwingend erforderlich ist.
Kapitel 2.1 vertieft die Unterscheidung zwischen „Gricy actions“ und „Non-gricy actions“ anhand von Beispielen. Es wird gezeigt, dass Handlungen wie Salutieren „un-gricy“ sind, da sie eine sichtbare Ausführung erfordern, während das Grüßen als „gricy action“ betrachtet werden kann, da die Absicht des Sprechers, jemanden zu grüßen, bereits ausreichend ist.
Kapitel 2.2 stellt die Frage, ob alle zentralen illokutionären Akte als „gricy actions“ zu klassifizieren sind. Es werden Beispiele für illokutionäre Akte wie Auffordern, Raten, Empfehlen und Widersprechen angeführt.
Kapitel 2.3 behandelt „Para-gricy actions“, darunter „Failed gricy actions“. Es wird untersucht, warum bestimmte Handlungen, die eigentlich als „gricy actions“ gelten sollten, nicht als solche funktionieren.
Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, ob perlokutionäre Sprechakte als „gricy actions“ betrachtet werden können. Perlokutionäre Sprechakte zielen auf eine bestimmte Wirkung beim Adressaten ab, wie zum Beispiel Überzeugung oder Umstimmung.
Kapitel 4 analysiert mögliche Widersprüche und Kritikpunkte hinsichtlich der „Gricy actions“. Es werden verschiedene Argumente und Einwände gegen die Theorie der „Gricy actions“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen „Gricy actions“, illokutionäre Akte, Sprechakttheorien, Paul Grice, Andreas Kemmerling, Intentionen, Wirkung, Kritik, Widersprüche. Der Text beleuchtet die Definition und Abgrenzung von „Gricy actions“, analysiert die Intentionen des Sprechers und die Wirkung auf den Adressaten sowie mögliche Kritikpunkte und Widersprüche.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Gricy actions“?
Es ist ein Sprechakttyp nach Paul Grice, der durch die Absicht des Sprechers definiert wird, eine bestimmte Wirkung beim Hörer zu erzielen, ohne dass die Handlung physisch vollzogen werden muss.
Wie unterscheiden sich „Gricy actions“ von „Non-gricy actions“?
„Non-gricy actions“ wie Salutieren erfordern eine physische Ausführung; bei „Gricy actions“ wie Grüßen reicht oft die erkennbare Absicht aus.
Welche Rolle spielt Andreas Kemmerling in dieser Theorie?
Kemmerling prägte den Begriff in seiner gleichnamigen Arbeit und systematisierte Grice’ Ansätze innerhalb der Sprechakttheorie.
Sind alle illokutionären Akte automatisch „gricy“?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, dass es Überschneidungen, aber auch klare Abgrenzungen zu konventionellen Akten gibt.
Was versteht man unter „Failed gricy actions“?
Das sind Handlungen, bei denen die kommunikative Absicht des Sprechers vom Adressaten nicht erkannt wird oder die notwendigen Bedingungen für den Sprechakt nicht erfüllt sind.
- Quote paper
- Annika Süß (Author), 2014, Analyse von Andreas Kemmerlings "Gricy Actions" in Anlehnung an Paul Grice, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275686