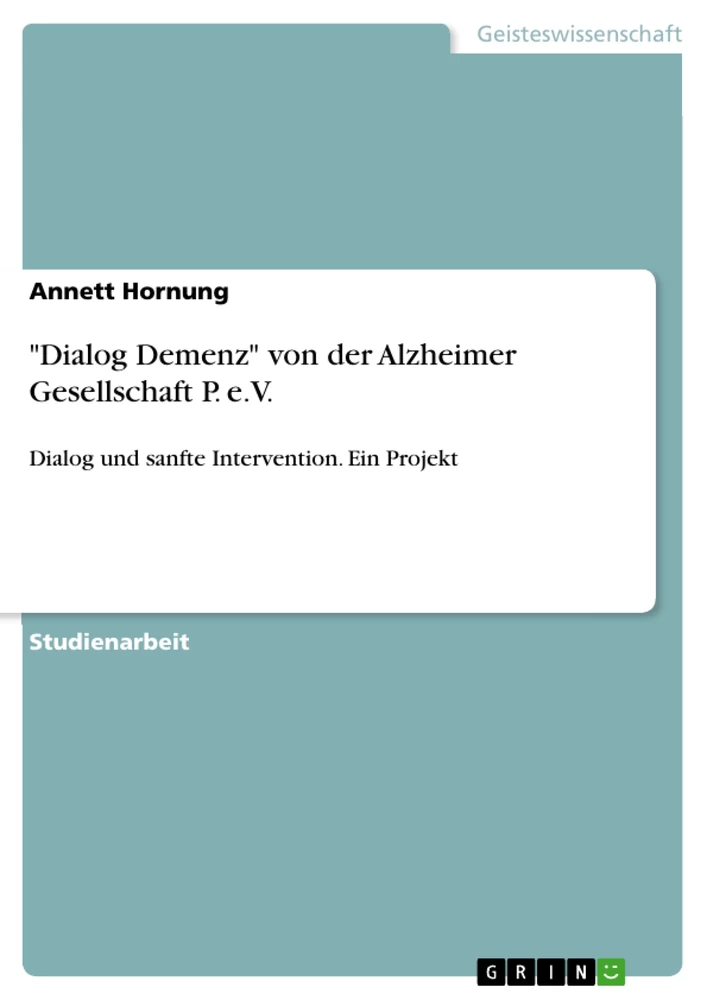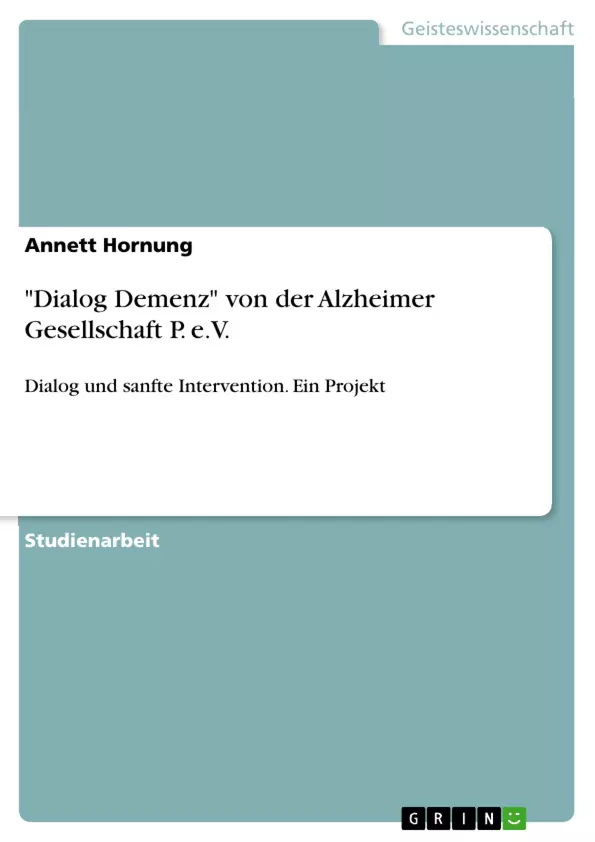Wenn vor 40 bis 50 Jahren – noch in meiner Kindheit – die Oma oder Uroma etwas vergessen hatte oder durcheinander brachte, lachte man gutmütig und meinte: „Die Oma ist auch schon tüdelig geworden.“ Das sollte besagen, dass es völlig „normal“ war, dass alte Menschen vergesslicher wurden, und auch ein Anrecht auf Berücksichtigung ihrer Eigenheiten hatten. Die heutige Gesellschaft mit ihren hohen kognitiven Ansprüchen, die auch oft junge Menschen nicht erfüllen können, wie meine tägliche Arbeit zeigt, lässt solche Defizite nicht mehr zu. Normabweichungen werden klassifiziert, stigmatisiert und nach Möglichkeit beseitigt.
„Die Demenz ist hier vor allem eine heimtückische Krankheit beziehungsweise ein Feind der Menschheit, der durch entsprechende medizinisch-medikamentös orientierte Verfahren besiegt und zum Verschwinden gebracht werden muss.“ (vgl. Wißmann 2010, S. 341)
Demenz wird im Allgemeinen als eine Krankheit betrachtet, die auch in der internationalen Klassifikation der Krankheiten, der ICD-10, als ein Syndrom definiert wird. Sie wird als eine organisch verursachte Erkrankung mit kognitiven Störungen als Leitsymptom verstanden. (ebd., S. 339) Mittlerweile haben sich jedoch in spezialisierten Kliniken Behandlungsweisen neben der Allopathie durchgesetzt, die ganzheitliche, eben nicht nur „krankheitsorientierte“ Ansätze zeigen. Man nutzt diverse Interventionsarten, z. B. pflegerische Interventionen, psychosoziale Interventionen wie SET, die Validation, die biografieorientierte Erinnerungstherapie oder Musik-, Tanz- und Maltherapie; tiergestützte sowie kognitive und physische Trainingsinterventionen (vgl. auch Ahlsdorf sowie Huxhold 2012, S. 261-290), und verbindet diese mit spezifischen Umgangs- und Kommunikationsweisen, einer demenzgerechten Gestaltung der räumlichen Umgebung sowie speziellen organisatorischen und tagesstrukturierenden Maßnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkung
- II. „Dialog Demenz“ von der Alzheimer Gesellschaft P. e.V.
- III. Partner im lebensnahen Dialog - sanfte Intervention
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Projekt „Dialog Demenz“ der Alzheimer Gesellschaft P. e.V. zielt darauf ab, das Bewusstsein für Demenz in der Bevölkerung zu stärken, präventive Maßnahmen zu fördern und die Teilhabe von Menschen mit Demenz zu verbessern. Es soll eine gesellschaftliche Mitverantwortung für diese Thematik geschaffen werden.
- Politische Sensibilisierung und Unterstützung für die Belange von Menschen mit Demenz
- Förderung der Angehörigenselbsthilfe und des freiwilligen Engagements
- Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz durch integrative Veranstaltungen und Angebote
- Entwicklung von demenzfreundlichen Gemeinden und Einrichtungen
- Stärkung der Bürgerrechte von Menschen mit Demenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkung beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung von Demenz und die Notwendigkeit, diese Krankheit nicht nur als medizinisches Problem zu betrachten, sondern auch die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen in den Vordergrund zu stellen.
Kapitel II beschreibt das Projekt „Dialog Demenz“ der Alzheimer Gesellschaft P. e.V. und seine Ziele. Es werden die verschiedenen Aktivitäten des Projekts vorgestellt, wie z. B. Vorträge, Ausstellungen und die Zusammenarbeit mit Gemeinden.
Kapitel III analysiert die Bedeutung des Dialogs und der sanften Intervention im Umgang mit Demenz. Es wird die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Veränderung im Umgang mit alten und dementen Menschen betont und die Rolle der Wirtschaft und der Pharmaindustrie in diesem Kontext kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Demenz, Alzheimer-Gesellschaft, Dialog, Intervention, Teilhabe, Angehörigenselbsthilfe, Demenzfreundliche Gemeinden, politische Sensibilisierung, gesellschaftliche Mitverantwortung, Lebensqualität, Bürgerrechte, Wirtschaft, Pharmaindustrie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projekts „Dialog Demenz“?
Das Projekt der Alzheimer Gesellschaft P. e.V. möchte das Bewusstsein für Demenz stärken, die Teilhabe der Betroffenen verbessern und demenzfreundliche Gemeinden fördern.
Wie hat sich die Wahrnehmung von Demenz gesellschaftlich verändert?
Früher oft als normales Altern („tüdelig“) akzeptiert, wird Demenz heute in einer leistungsstarken Gesellschaft oft stigmatisiert und primär als medizinischer Feind betrachtet.
Welche sanften Interventionsarten werden bei Demenz eingesetzt?
Neben Medikamenten gibt es ganzheitliche Ansätze wie Validation, Musik-, Tanz- und Maltherapie sowie tiergestützte Interventionen und Biografiearbeit.
Was macht eine demenzfreundliche Gemeinde aus?
Sie zeichnet sich durch politische Sensibilisierung, Unterstützung für Angehörige, integrative Veranstaltungen und eine angepasste räumliche Gestaltung aus.
Warum wird die Rolle der Pharmaindustrie kritisch gesehen?
Die Arbeit beleuchtet kritisch, dass oft ein rein krankheitsorientierter Fokus dominiert, der wirtschaftliche Interessen über die ganzheitlichen Bedürfnisse der Menschen stellt.
- Citar trabajo
- Annett Hornung (Autor), 2013, "Dialog Demenz" von der Alzheimer Gesellschaft P. e.V., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275700