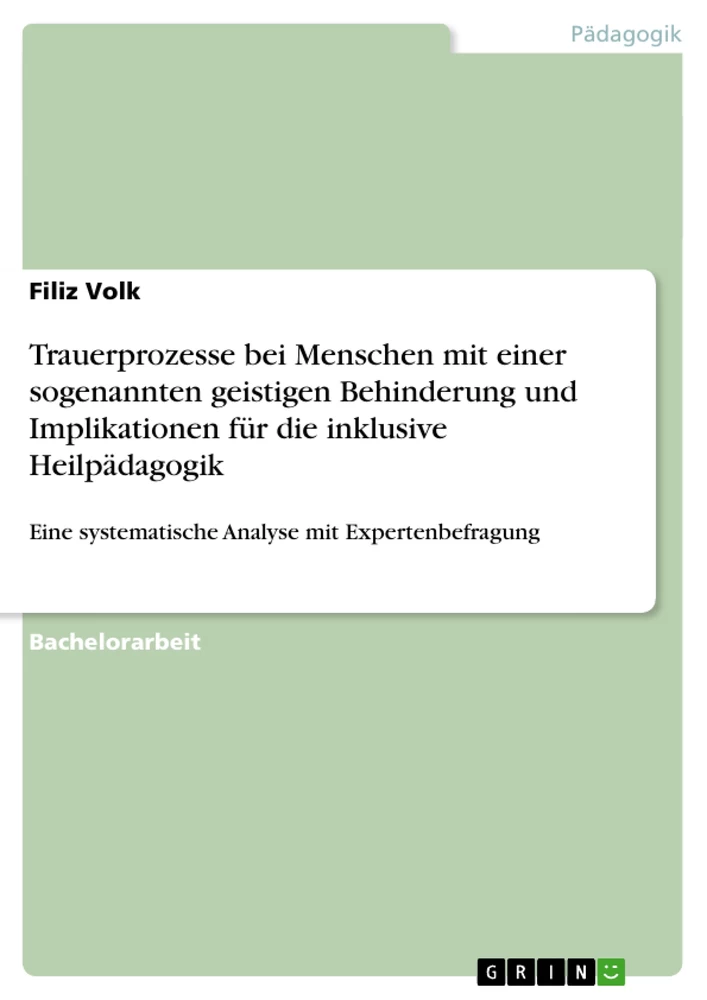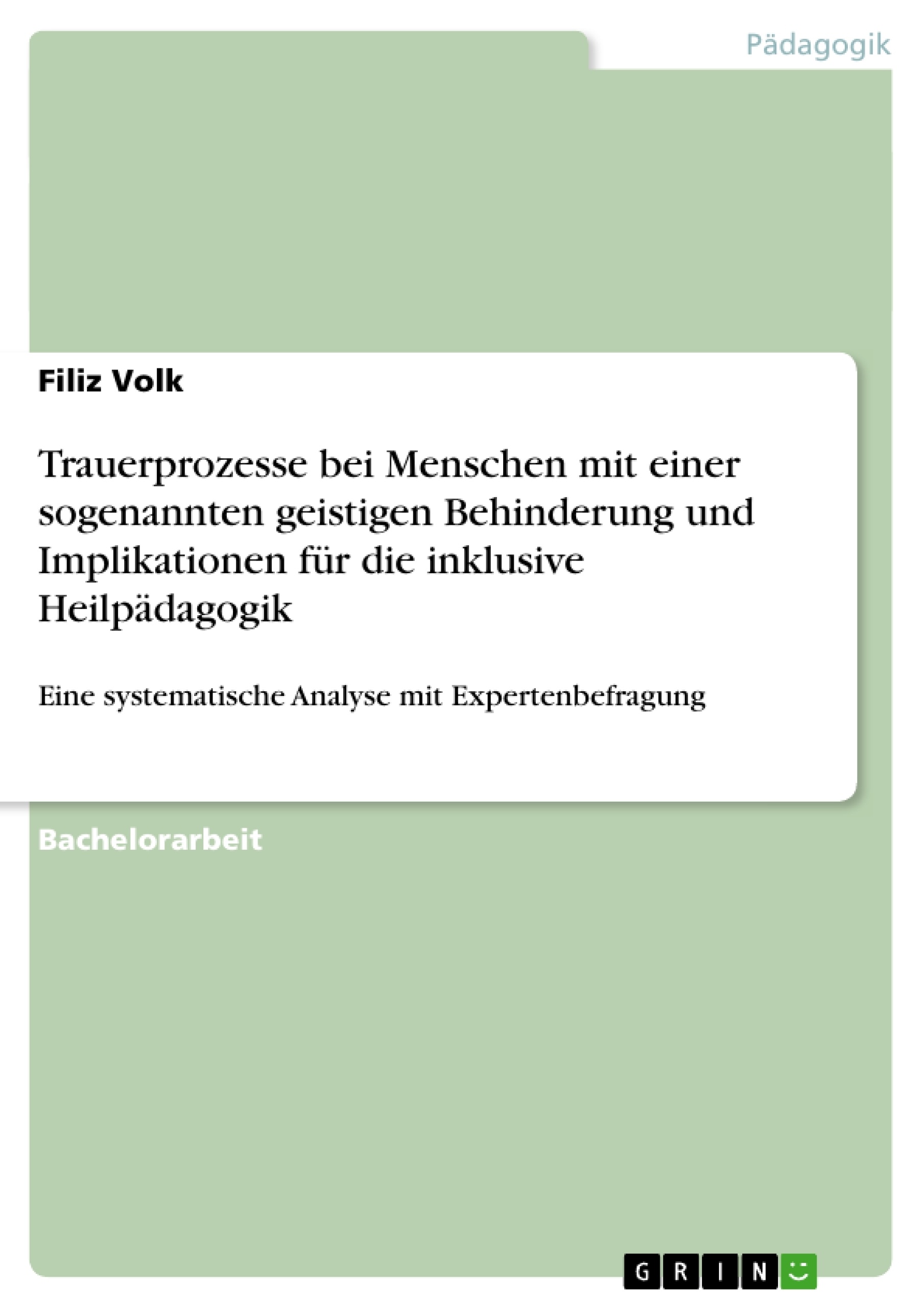Das Thema Trauer ist schwierig. Trauer geht immer mit Emotionen einher und ist damit für die Wissenschaft schwer greifbar und untersuchbar. Zum einen kann es daran liegen, dass Emotionen subjektiv empfunden werden, dass jeder Mensch Emotionen anders erlebt und zum Ausdruck bringt. Zum anderen möchten die meisten Menschen dieses Thema lieber meiden. Dies betonen Heppenheimer und Sperl (2011), denen zufolge „die Trauer in der moder-nen Gesellschaft lange tabuisiert wurde“ (Heppenheimer, Sperl, 2011, S. 9).
Über Trauer gibt es viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Suchmaschine „Sensei scholar“ findet zum Stichwort „grief“ (Trauer) über 7000 Treffer wissenschaftlicher Studien. Das Suchwort Trauer in Verbindung mit Behinderung reduziert die Trefferzahl auf 135. Dies lässt vermuten, dass über die Trauer von Menschen mit Behinderung nur wenige wissenschaftliche Studien existieren. Lange Zeit wurde Menschen mit Behinderung und speziell mit sogenannter geistiger Behinderung emotionale Kompetenz abgesprochen. Man ging davon aus, dass diese Menschen keine Trauergefühle oder -bedürfnisse haben (vgl. Heppenheimer, Sperl, 2011, S. 9).
Doch mittlerweile sind Wissenschaft und Gesellschaft der Ansicht, dass auch Menschen mit einer Behinderung emotionale Kompetenzen haben. Heppenheimer und Sperl (2011) sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Begabung der emotionalen Kompetenz“ bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung (vgl. Heppenheim, Sperl, 2011, Seite 9).
Dennoch ist das Thema Trauer und Trauerverarbeitung von Menschen mit Behinderung bisher kaum erforscht. Auch Luchtenhard und Murphy (2007) erwähnen in ihrem Buch: „ Es gibt nur wenige Untersuchungen darüber, wie erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung den Tod ihnen nahestehender Personen erleben“ (Luchtenhard, Murphy, 2007, S. 13).
Aufgrund der geringen Kenntnisse über Trauerprozesse von Menschen mit Behinderung ist der Umgang damit häufig nicht adäquat. Teilweise findet sich auch eine Tabuisierung der Trauer. Heppenheimer und Sperl (2011) belegen, wie das Thema Trauer auch in Institutionen für Menschen mit Behinderung tabuisiert wird. Heppenheimer beschreibt sein Projekt „Entwicklung einer Trauerkultur in einer Einrichtung am Beispiel Mariaberg“ (vgl. Heppenheimer und Sperl, 2011, S. 10). In Mariaberg arbeitete Heppenheimer als Pfarrer und startete dieses Projekt, um eine Trauerkultur für Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Dabei nahm er die Trauer der Bewohner sehr ernst. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation und Problemstellung
- Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
- Aufbau der Arbeit
- Trauer und Menschen mit geistiger Behinderung - Theoretische Grundlagen
- Trauer und Trauerprozesse
- Lebenssituationen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
- Trauer bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
- Methodik der Auswertung empirischer Studien zu Trauerprozessen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
- Vorgehensweise der Studienauswahl und Auswahlkriterien
- Auswertungsdesign
- Auswertung ausgewählter Studien zu Trauer und Trauerprozessen bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
- Studien zum Schwerpunkt Symptome
- Studien zum Schwerpunkt Erfahrungen der Betreuer
- Studien zum Schwerpunkt Trauerfallunterstützung
- Methodik der empirischen Analyse
- Auswahl und Begründung der Forschungsmethoden
- Auswahl der Zielgruppe / Probanden / Untersuchungsobjekte
- Darstellung und Begründung des Fragebogens
- Vorgehen der Untersuchung
- Ergebnisse der empirischen Analyse und Interpretation
- Überblick der Ergebnisse
- Darstellung wesentlicher Erkenntnisse der Analyse und Interpretation
- Einordnung der Ergebnisse in das Forschungsgebiet und weiterer Forschungsbedarf
- Vorschlag für ein Forschungsprojekt über Trauerprozesse bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
- Methodenkritik
- Zusammenfassung und Fazit mit Implikationen für die inklusive Heilpädagogik
- Anhang
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit Trauerprozessen bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und deren Implikationen für die inklusive Heilpädagogik. Ziel der Arbeit ist es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Trauer und Trauerverarbeitung bei Menschen mit geistiger Behinderung zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen für die inklusive Heilpädagogik abzuleiten. Die Arbeit untersucht die Besonderheiten von Trauerprozessen bei Menschen mit geistiger Behinderung, die Herausforderungen für die Begleitung und Unterstützung von Trauernden sowie die Bedeutung einer inklusiven Trauerkultur.
- Trauerprozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Herausforderungen für die Begleitung und Unterstützung von Trauernden
- Bedeutung einer inklusiven Trauerkultur
- Empirische Forschungsergebnisse zu Trauerprozessen bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Handlungsempfehlungen für die inklusive Heilpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Trauerprozesse bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ein und erläutert die Ausgangssituation und Problemstellung. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und die Notwendigkeit einer intensiveren Auseinandersetzung mit Trauerprozessen in der inklusiven Heilpädagogik. Die Einleitung stellt das Ziel der Arbeit und die Vorgehensweise dar, sowie den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen von Trauer und Trauerprozessen. Es werden verschiedene Modelle und Theorien zur Trauerverarbeitung vorgestellt und die Besonderheiten von Trauerprozessen bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Lebenssituationen von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Einfluss auf die Trauerverarbeitung. Es werden verschiedene Aspekte wie die Kommunikation, die soziale Integration und die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Kontext von Trauerprozessen betrachtet.
Das dritte Kapitel beschreibt die Methodik der Auswertung empirischer Studien zu Trauerprozessen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Es werden die Vorgehensweise der Studienauswahl und die Auswahlkriterien erläutert. Das Kapitel stellt das Auswertungsdesign vor und erläutert die verwendeten Methoden zur Analyse der empirischen Daten.
Das vierte Kapitel präsentiert die Auswertung ausgewählter Studien zu Trauer und Trauerprozessen bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Es werden Studien zum Schwerpunkt Symptome, Erfahrungen der Betreuer und Trauerfallunterstützung analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Ergebnisse der Studien und diskutiert deren Relevanz für die inklusive Heilpädagogik.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Analyse. Es werden die Auswahl und Begründung der Forschungsmethoden erläutert, sowie die Auswahl der Zielgruppe / Probanden / Untersuchungsobjekte. Das Kapitel stellt den Fragebogen vor und erläutert die Vorgehensweise der Untersuchung.
Das sechste Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse und Interpretation. Es gibt einen Überblick über die Ergebnisse und stellt wesentliche Erkenntnisse der Analyse und Interpretation dar. Das Kapitel ordnet die Ergebnisse in das Forschungsgebiet ein und diskutiert den weiteren Forschungsbedarf. Es enthält einen Vorschlag für ein Forschungsprojekt über Trauerprozesse bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und eine Methodenkritik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Trauer, Trauerprozesse, Menschen mit geistiger Behinderung, inklusive Heilpädagogik, Trauerkultur, empirische Forschung, Handlungsempfehlungen, Inklusion, Behinderung, Trauerbegleitung, Trauerfallunterstützung, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Kommunikation, soziale Integration, Forschungsprojekt, Methodenkritik.
- Quote paper
- Filiz Volk (Author), 2014, Trauerprozesse bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und Implikationen für die inklusive Heilpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275747