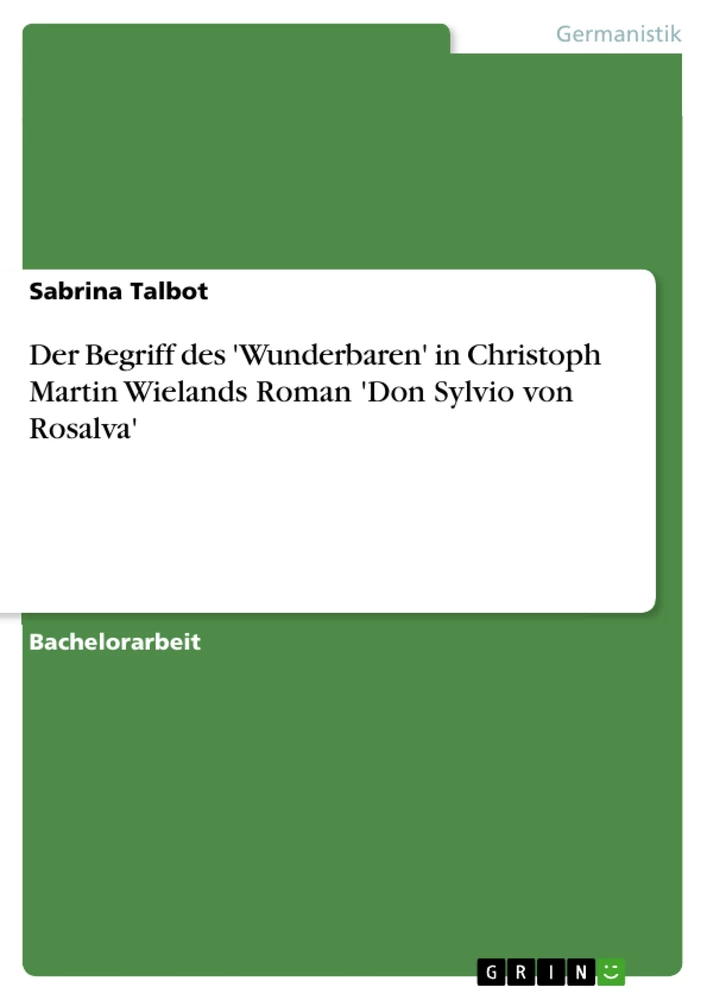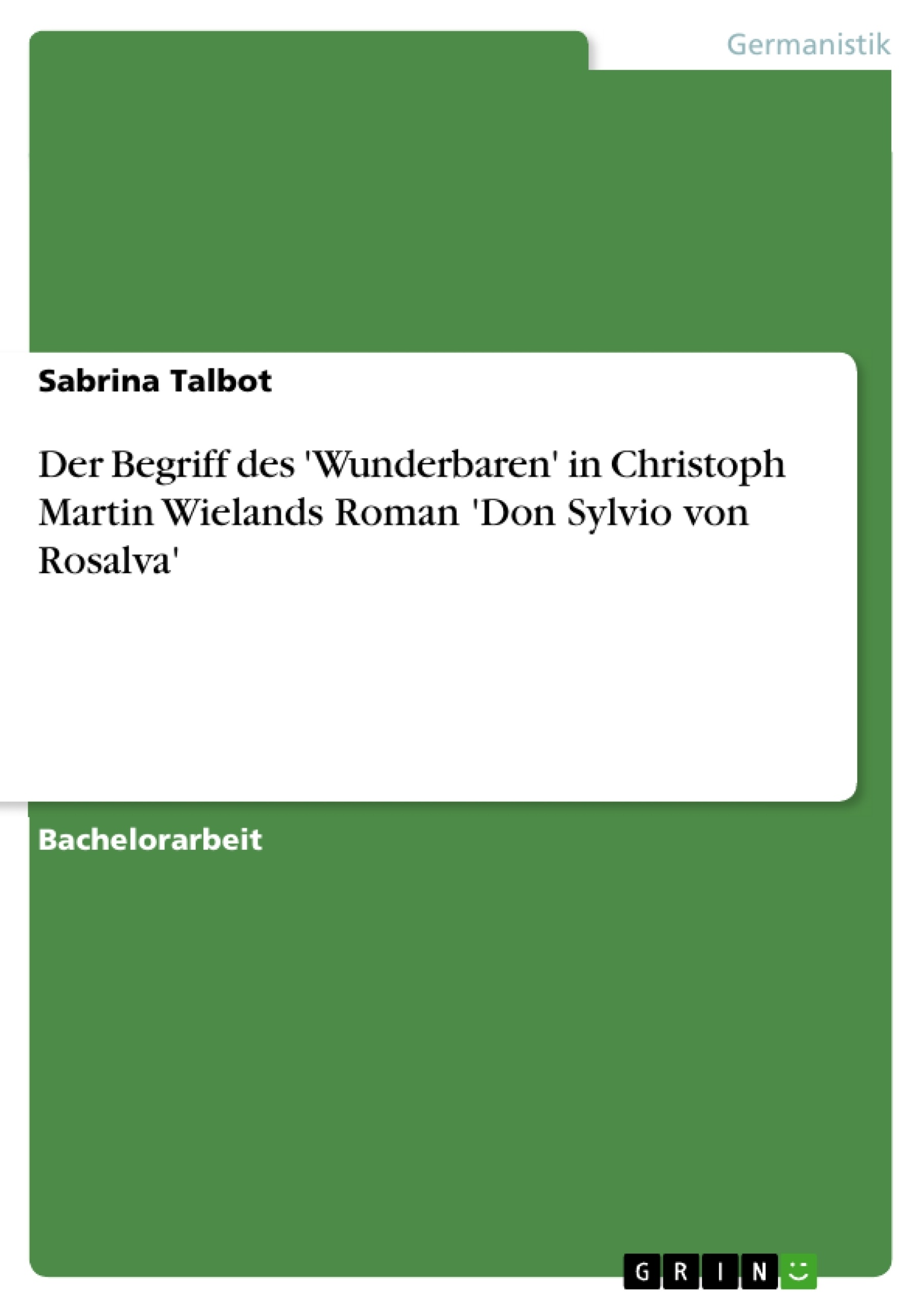Christoph Martin Wieland veranschaulicht in seinem 1764 erschienenen Roman „Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva“, welche Wirkung das Wunderbare auf die menschliche Empfindung hat. Der Protagonist Don Sylvio findet eine Sammlung Feen-Märchen, die er in schneller Geschwindigkeit liest und somit den Eindruck einer Kohärenz zwischen realer Welt und Fiktion gewinnt. Don Sylvio liest diese Märchen am liebsten im Garten oder im Wald und bezieht bald alles Gelesene auf seine Umgebung, sodass er sich einbildet, er befände sich in einer Feen-Welt. Besonders durch die Betrachtung der Natur verstärkt sich sein Eindruck, da diese nicht nur essentieller inhaltlicher Bestandteil dieses Literatur-Genres ist, sondern durch ihre beeindruckende Vielfalt und Schönheit auch selbst Wunderbares darstellt. Doch was bedeutet eigentlich Realität und wer legt fest, was wahr und wirklich ist? Die vorliegende Ausarbeitung wird in Bezugnahme auf das Modell der möglichen Welten zeigen, dass Wirklichkeit kein feststehender, allgemeingültiger Begriff ist, sondern sich auf verschiedenen Ebenen äußern kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Begriff wunderbar nach Sulzer
3. Gottsched - Bodmer - Breitinger
3.1 Gottscheds Verhältnis zum Wunderbaren in der Literatur
3.2 Die Poetologie Bodmer und Breitingers
4. Textanalyse
4.1 Wielands Position im poetologischen Diskurs
4.2 Zusammenfassung des Romans
4.3 Die Integration des Wunderbaren in „Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva“
4.3.1 Wirklichkeitsebenen
4.3.1.1 Physisch-Physikalische Ebene
4.3.1.2 Physisch-Psychische Ebene
4.3.1.3 Ebene der Fiktion
4.3.1.4 Ebene des Wahns
4.3.2 Stoffliche Ebene
4.3.3 Poetologische Ebene
4.3.3.1 Diskrepanzen zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit
4.3.3.2 Unzuverlässigkeit des Erzählers
4.3.3.3 Metafiktionale Erzählerkommentare
4.3.3.4 Relativität des Wirklichkeitsbezugs
4.3.4 Das Wunderbare in der Liebe
5. Fazit: Wielands Poetik des Wunderbaren
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wieland unter dem „Wunderbaren“?
In seinem Roman zeigt Wieland, wie das Wunderbare (z.B. Feen-Märchen) die menschliche Empfindung beeinflusst und die Grenze zwischen realer Welt und Fiktion verschwimmen lässt.
Wer ist der Protagonist Don Sylvio von Rosalva?
Don Sylvio ist ein junger Mann, der durch das übermäßige Lesen von Feen-Märchen den Bezug zur Realität verliert und sich einbildet, in einer magischen Welt zu leben.
Welche Wirklichkeitsebenen werden in der Analyse unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen der physisch-physikalischen Ebene, der psychischen Ebene, der Ebene der Fiktion und der Ebene des Wahns.
Welche Rolle spielt die Natur im Roman?
Die Natur dient als Verstärker für Don Sylvios Einbildungskraft, da ihre Vielfalt und Schönheit für ihn selbst als etwas Wunderbares und Magisches erscheint.
Was kritisiert Wieland durch die „Unzuverlässigkeit des Erzählers“?
Durch metafiktionale Kommentare und einen unzuverlässigen Erzähler hinterfragt Wieland die Relativität von Wirklichkeitsbezügen und die Macht der Literatur über den Verstand.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Sabrina Talbot (Author), 2012, Der Begriff des 'Wunderbaren' in Christoph Martin Wielands Roman 'Don Sylvio von Rosalva', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275780