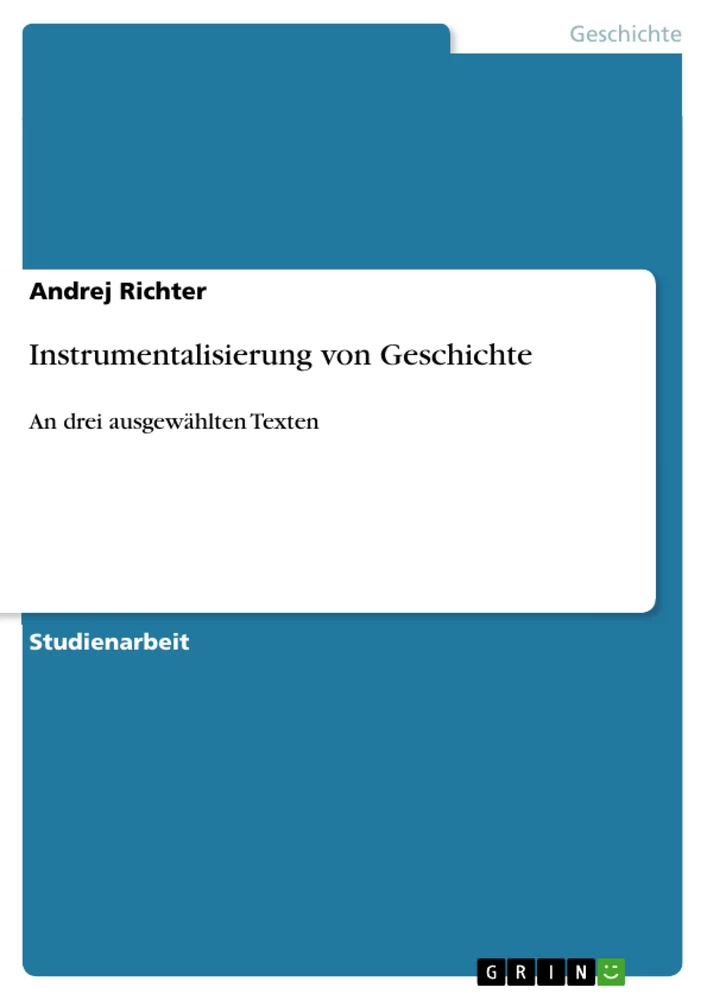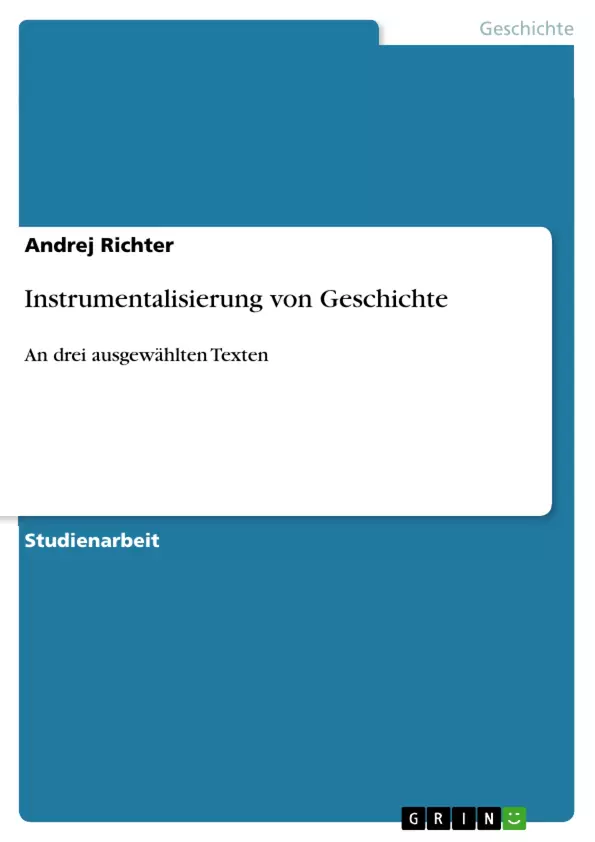„Geschichte ist nicht im gleichen Sinne offen wie die Zukunft, aber offen ist sie auch.“ Dieser Satz stammt aus einem aktuellen Artikel zur deutschen Geschichte des Magazins Der Spiegel. Weiter heisst es darin, dass man so tue „als gäbe es historische Wahrheiten, aber die gibt es nicht. Es gibt nur einen Stand der Forschung, der Lücken hat, die mit Spekulationen gefüllt werden, mit Interpretationen.“ Diese Aussage verwundert nicht. Denn seit jeher speisen sich diese Spekulationen und Interpretationen bereits aus dem Wort Geschichte, welches im Deutschen eine doppeldeutige Bedeutung aufweist: Res gestae und historia rerum gestarum. Vergangenes Geschehen und der Umgang mit diesem vergangenen Geschehen. Es bezeichnet somit „sowohl das Objekt der Darstellung wie die Darstellung des Objekts“. Diese Ambivalenz und die Schwere, gar Unmöglichkeit, das Gegenstandsobjekt, also das vergangene Geschehen, vom individuellen Erkenntnissubjekt, also dem Erzähler, loszulösen, lässt darauf schließen, dass die Geschichtswissenschaft verglichen mit der Naturwissenschaft „durch die jeweilige Gegenwart und ihre Interessen in besonderer Weise motiviert“ ist. Die Vergangenheit steht somit im steten Dialog mit der Zeit und dem Erzähler. Positiv ausgedrückt: „Die Vergangenheit lebt; sie schwankt im Lichte neuer Erfahrungen und Fragestellungen“. Negativ ausgedrückt ist die Vergangenheit jedoch tot. Sie ist vor Manipulation und Ausbeutung nicht geschützt.
Die vorliegende Arbeit versucht dieser potentiellen Manipulation von Geschichte, in diesem Falle speziell durch Politiker, näher zu kommen. Dazu werden drei ausgewählte Texte untersucht, die sich mit unterschiedlichen Zeit- und Kulturräumen befassen. Kapitel 2 stellt die Protagonisten und wichtigsten Kernpunkte dieser Texte dar. Kapitel 3 widmet sich den theoretischen Grundlagen und gibt die in den Texten auftauchenden Begrifflichkeiten und Theorien wie den Historismus, Strukturalismus, Poststrukturalismus, die Hermeneutik, Semiotik, die linguistische Wende und die Historische Diskursanalyse knapp wieder. Auch werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Theorien aufgezeigt. Auf Basis dessen wird in Kapitel 4 folgenden zwei Leitfragen nachgegangen:
1. Wie lassen sich die drei vorliegenden Texte wissenschaftstheoretisch einordnen?
2. Existiert ein roter einigender Faden in den Grundaussagen dieser Texte?
Kapitel 5 gibt schließlich eine kurze Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- Instrumentalisierung von Geschichte
- Geschichte im steten Dialog mit dem gegenwärtigen Individuum…
- Instrumentalisierung der Geschichte anhand dreier Beispiele
- Der Sinn der tschechischen Geschichte.
- Zur Instrumentalisierung historischen Wissens in der politischen Diskussion…
- „Kolumbus des Kosmos“ – Der Kult um Jurij Gagarin
- Sprache und Individuum in den geschichtswissenschaftlichen Theorien
- Mangelnde Objektivität bei Sprache und Individuum…
- Historismus und Strukturalismus
- Poststrukturalismus und Historische Diskursanalyse…
- Vergleichende kritische Analyse.
- Wissenschaftstheoretische Einordnung der drei Texte..
- Einigender roter Faden und konzeptionelle Unterschiede innerhalb der drei Texte.....
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Instrumentalisierung von Geschichte durch Politiker anhand dreier ausgewählter Texte. Sie analysiert, wie die Vergangenheit in der Gegenwart genutzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Dabei werden die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Texte sowie die in ihnen auftauchenden Theorien und Begrifflichkeiten beleuchtet.
- Die Problematik der Instrumentalisierung von Geschichte für politische Zwecke
- Die Rolle von Sprache und Individuum in der Geschichtswissenschaft
- Die verschiedenen Theorien zur Interpretation von Geschichte
- Die wissenschaftstheoretische Einordnung der analysierten Texte
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik der Instrumentalisierung von Geschichte durch die Analyse der Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und dem Erzähler. Das zweite Kapitel stellt die drei ausgewählten Texte vor, die sich mit der Instrumentalisierung von Geschichte in unterschiedlichen Zeit- und Kulturräumen befassen. Es werden die Protagonisten und wichtigsten Kernpunkte dieser Texte dargestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen der Texte und beleuchtet die in ihnen auftauchenden Theorien und Begrifflichkeiten wie den Historismus, Strukturalismus, Poststrukturalismus, die Hermeneutik, Semiotik, die linguistische Wende und die Historische Diskursanalyse. Das vierte Kapitel analysiert die drei Texte wissenschaftstheoretisch und untersucht, ob ein roter Faden in den Grundaussagen dieser Texte existiert.
Schlüsselwörter
Instrumentalisierung von Geschichte, Geschichtswissenschaft, Historismus, Strukturalismus, Poststrukturalismus, Hermeneutik, Semiotik, linguistische Wende, Historische Diskursanalyse, politische Diskussion, Tschechische Geschichte, Jurij Gagarin.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Instrumentalisierung von Geschichte"?
Es bezeichnet den gezielten Einsatz historischer Ereignisse oder Interpretationen durch Politiker oder Gruppen, um gegenwärtige politische Ziele zu legitimieren.
Warum ist Geschichte im Deutschen ein doppeldeutiger Begriff?
Das Wort bezeichnet sowohl das vergangene Geschehen selbst (res gestae) als auch die Darstellung dieses Geschehens (historia rerum gestarum), also die Erzählung darüber.
Welche Rolle spielt Jurij Gagarin in diesem Kontext?
Gagarin wird als "Kolumbus des Kosmos" oft als Kultfigur instrumentalisiert, um nationale Überlegenheit oder spezifische ideologische Fortschrittsnarrative zu stützen.
Was ist die "linguistische Wende" in der Geschichtswissenschaft?
Sie betont, dass wir keinen direkten Zugriff auf die Vergangenheit haben, sondern diese immer durch Sprache und Diskurse vermittelt und konstruiert wird.
Kann Geschichte jemals objektiv sein?
Die Arbeit zeigt auf, dass Geschichte immer im Dialog mit der Gegenwart steht und durch die Interessen des Erzählers beeinflusst wird, was eine reine Objektivität erschwert.
- Arbeit zitieren
- Andrej Richter (Autor:in), 2014, Instrumentalisierung von Geschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275810