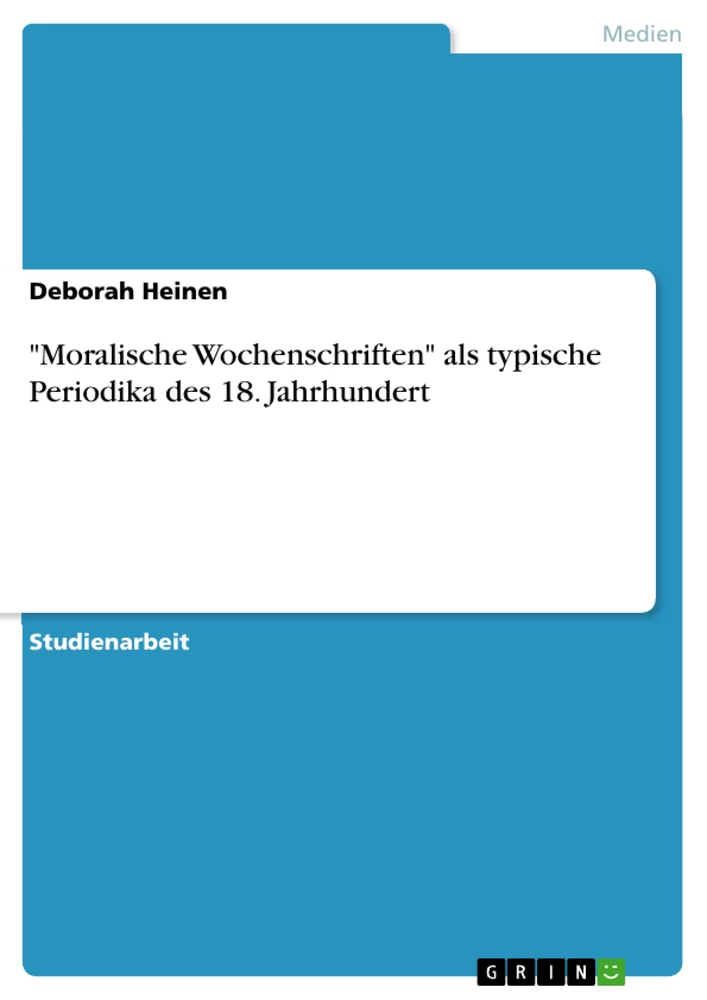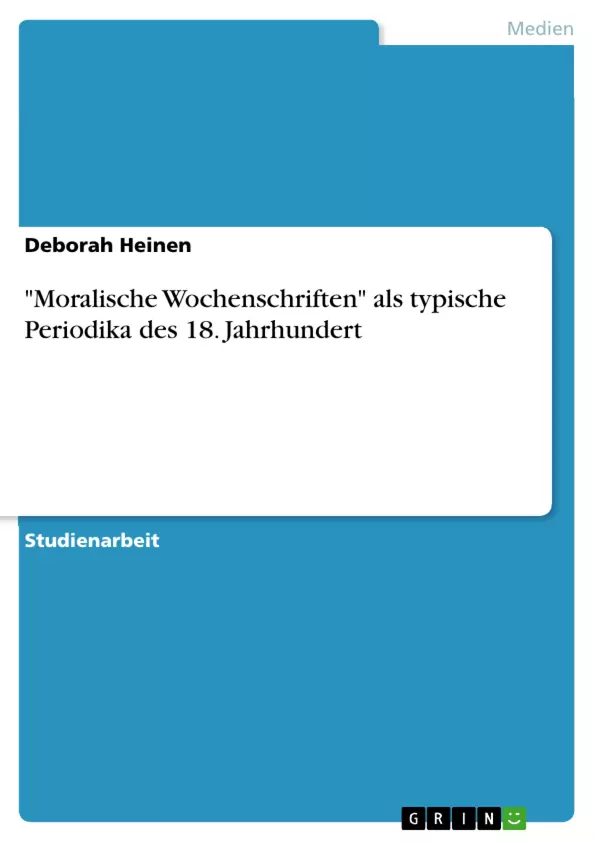"Die Moralischen Journale verbreiteten eine Weltanschauung, die sich nicht primär aufs Jenseits bezog, sondern die Möglichkeit propagierte, den Lebenssinn durch handelnde Bewährung in der Gesellschaft selbst, das heißt also: weltimmanent zu verwirklichen."
Mit dieser Aussage betont Jürgen Jacobs die multidimensionalen Auswirkungen der Moralischen Wochenschriften als führende Zeitschriftengattung des 18. Jahrhunderts und bringt dadurch zum Ausdruck, dass ihnen viel mehr Bedeutung beigemessen werden muss, als einem gewöhnlichen Wochenblatt. Denn die Moralischen Wochenschriften markierten nicht nur einen Umbruch in der deutschen Pressegeschichte im Kontext der Aufklärung, sondern beeinflussten die Gesellschaft der damaligen Zeit maßgeblich.
Im Jahre 1761 erschien die erste Liste mit einer Übersicht der deutschen Moralischen Wochenschriften, welche bis dahin erschienen sind, unter Beck, welche 1931 von J. Kirchner unter dem Titel "Gesamtbibliographie des deutschen Zeitschriftenwesens bis 1790" ergänzt und vervollständigt wurde . In den folgenden Jahren wurden dann stetig seperate Bereiche untersucht, wie z.B. die Eigenheiten der Sprache Moralischer Wochenschriften oder die Darstellung des Frauen- und Familienbildes in ihnen . Die erste gründliche Erforschung der Moralischen Wochenschriften in ihrer Gesamtheit sieht Jacobs in der 1968 erschienen Arbeit von Wolfgang Martens, welcher sich unter anderem auch mit der Verbreitung, den Themen und der Funktion deutscher Moralischer Wochenschriften beschäftigte .
Die vorliegende Arbeit soll dem Leser einen Gesamteindruck und eine Vorstellung von den Moralischen Wochenschriften als Genre geben. Dazu wird in Kapitel 2 zunächst die Entstehung der Periodika thematisiert, sowie ihre Themen vorgestellt und die typischen Gattungsmerkmale mit Bezug auf die Herausgeber und deren Ziele analysiert. Des Weiteren wird auf die Verbreitung der Schriften in Deutschland eingegangen und das Publikum, sowie ihr Interesse an den Schriften erläutert. In Kapitel 3 wird der "Patriot" als bedeutsamste Moralische Wochenschrift Deutschlands vorgestellt und als exemplarisches Beispiel aufgeführt. Zuletzt wird in Kapitel 4 die zentrale Leitfrage nach den Erfolgsgeheimnissen der Periodika, sowie deren Beitrag zur Prägung der Gesellschaft und Pressegeschichte Deutschlands beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung, Inhalt, Charakteristika, Verbreitung und Rezipienten der Moralischen Wochenschriften
- Entstehung, Inhalt und Charakteristika der Moralischen Wochenschriften
- Die Verbreitung und Rezipienten der Moralischen Wochenschriften in Deutschland
- Der "Patriot" als die bedeutsamste Moralische Wochenschrift Deutschlands
- Fazit - Der Erfolg der Moralischen Wochenschriften und ihr Beitrag zum Zeitschriftenwesen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Moralischen Wochenschriften als prägender Zeitschriftengattung des 18. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Entstehung, den Inhalt, die Verbreitung und die Rezeption dieser Periodika zu beleuchten und ihren Beitrag zur Entwicklung des Zeitschriftenwesens und der Gesellschaft im Kontext der Aufklärung zu analysieren.
- Die Entwicklung der Moralischen Wochenschriften als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen im 18. Jahrhundert
- Die Rolle der Moralischen Wochenschriften als Instrument der Aufklärung und der Verbreitung von moralisierenden Ideen
- Die Themenfelder der Moralischen Wochenschriften, die sich von Bildung und Erziehung bis zu gesellschaftlichen Normen und Verhaltensweisen erstreckten
- Die Rezeption und Verbreitung der Moralischen Wochenschriften in Deutschland und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Lesepublikums
- Der Einfluss der Moralischen Wochenschriften auf die deutsche Sprache und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik der Moralischen Wochenschriften und stellt ihre Bedeutung im Kontext der Aufklärung heraus. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung, den Inhalt und die Charakteristika der Moralischen Wochenschriften, sowie ihre Verbreitung und Rezeption in Deutschland. Kapitel 3 widmet sich dem "Patriot" als exemplarischem Beispiel für eine bedeutsame Moralische Wochenschrift. Abschließend werden in Kapitel 4 die Erfolgsfaktoren der Moralischen Wochenschriften und ihr Beitrag zur Entwicklung des Zeitschriftenwesens und der Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Moralische Wochenschriften, Aufklärung, Zeitschriftenwesen, Pressegeschichte, Deutschland, 18. Jahrhundert, Bildung, Erziehung, Gesellschaft, Kultur, Rezeption, Verbreitung, "Patriot", Tugend, Sittenverfall
Häufig gestellte Fragen
Was waren die „Moralischen Wochenschriften“?
Es war eine führende Zeitschriftengattung des 18. Jahrhunderts, die moralische und aufklärerische Ideen in der Gesellschaft verbreitete.
Welches Ziel verfolgten die Herausgeber dieser Schriften?
Das Ziel war die Erziehung des Lesers zu Tugendhaftigkeit, Vernunft und einer handelnden Bewährung innerhalb der Gesellschaft (Weltimmanenz).
Welche Themen wurden in den Wochenschriften behandelt?
Die Themen reichten von Bildung und Erziehung über das Frauen- und Familienbild bis hin zur Kritik an gesellschaftlichem Sittenverfall.
Was war die bedeutendste Moralische Wochenschrift in Deutschland?
Der „Patriot“ gilt als das wichtigste und erfolgreichste Beispiel dieser Gattung im deutschsprachigen Raum.
Wer war das typische Publikum dieser Schriften?
Die Schriften richteten sich an das aufstrebende Bürgertum, das ein großes Interesse an Selbstreflexion und gesellschaftlicher Verbesserung hatte.
Welchen Beitrag leisteten sie zur Pressegeschichte?
Sie markierten einen Umbruch, indem sie die deutsche Sprache prägten und den Zeitschriftenmarkt für breitere Bevölkerungsschichten öffneten.
- Citar trabajo
- Deborah Heinen (Autor), 2013, "Moralische Wochenschriften" als typische Periodika des 18. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275860