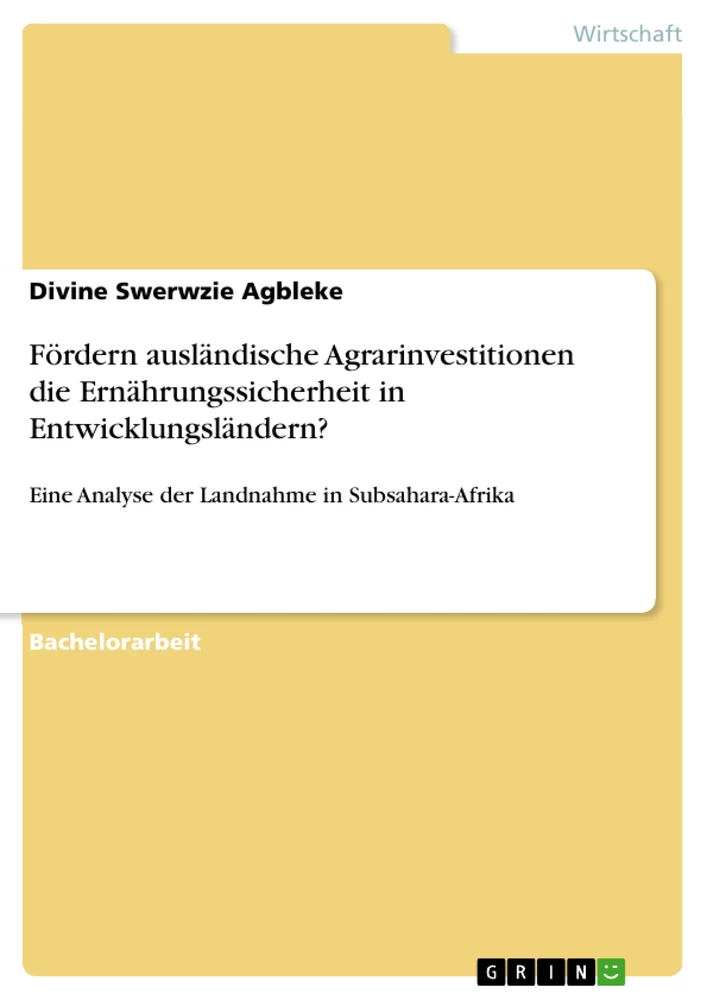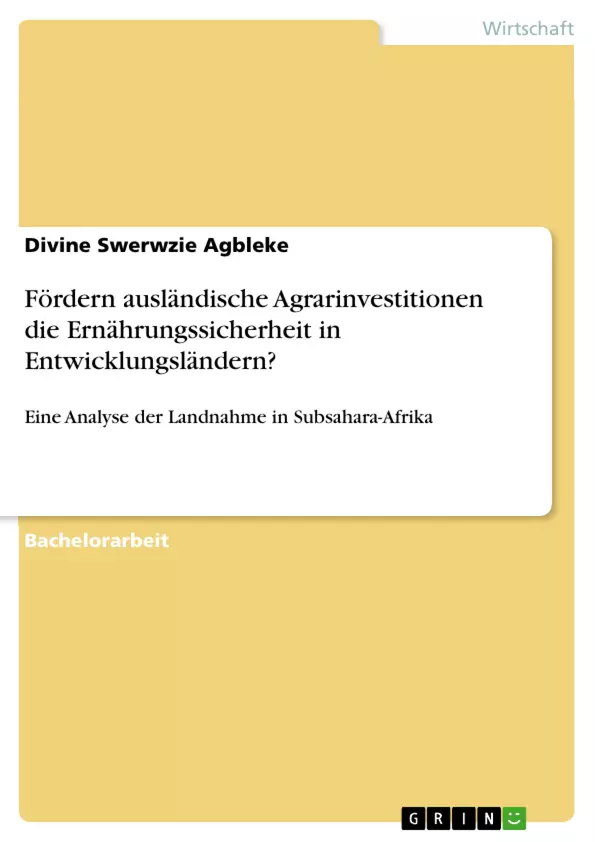Das Streben nach Kapital und damit verbunden nach ausländischen Direktinvestitionen hat weltweit stark an Bedeutung gewonnen. Die noch herrschende globale Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Werben um grenzüberschreitendes Kapital erheblich erschwert. Zudem führte die Liberalisierung der Güter- und Dienstleistungsbranche, inklusive des Finanzmarktes, zu hohen Volatilitäten auf den Finanzmärkten. Dieses Phänomen – die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und des Handels der letzten Jahre, insbesondere in SSA – hat dazu geführt, dass Investoren ihr Kapital unabhängig von der Lage in einem bestimmten Land umschichten konnten: sowohl in Ländern wie der Demokratischen Republik (DR) Kongo, welche als politisch unsicher gelten, aber hohe Ertragsaussichten aus dem Agrarsektor aufweisen, als auch in Ländern, die trotz einer niedrigeren Rendite als sicher angesehen werden. Traditionsbedingt werden jedoch bis heute noch politische Entscheidungen und Maßnahmen umgesetzt, die zur Anlockung ausländischer Direktinvestitionen in den industriellen Branchen und beim Abbau von Rohstoffen und seit einiger Zeit von Nahrungsmitteln für den Export dienen. Diese Trendbeschreibung stellt eine Eigenschaft dar, die durchaus charakteristisch für den Agrarsektor in den Entwicklungsländern in Subsahara-Afrika ist. Dennoch haben sich in den letzten Jahren neue Trends herauskristallisiert bzw. entwickelt. Der Wettbewerb zwischen Investoren um Agrarflächen in Entwicklungsländern, vor allem in Subsahara-Afrika (SSA), beschreibt die neuen Trends des 20. Jahrhunderts ausländischer Direktinvestitionen. Ausschlaggebend für diese Investitionen sind unter anderem die neusten Preisanstiege für Nahrungsmittel im Jahr 2008 und die Produktion von Rohstoffen, wie z. B. Korn bzw. Mais und der Jatrophapflanze für die Herstellung von Biokraftstoff angesichts der hohen, fossilen Kraftstoffpreise.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu untersuchen, inwieweit die neuen Trends der ausländischen Agrarinvestitionen die Ernährungssicherheit angesichts wiederkehrender Nahrungsmittelknappheit in Subsahara-Afrika fördern. Dabei werden die Agrarinvestitionen als eine traditionelle ausländische Direktinvestition gleichgestellt, um die Effekte bezüglich der Ernährungssicherheit in SSA zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung in den Forschungsstand
- Was ist unter ausländischen Direktinvestitionen zu verstehen?
- Ausgewählte-Theorie der ausländischen Direktinvestitionen
- Direktinvestitionszuflüsse nach SSA 2001-2011
- Untersuchungen bezüglich des Agrarsektors in den Entwicklungsländern
- Das,,Landnahmen-Phänomen“ in SSA
- Was ist unter Landnahmen zu verstehen
- Die Akteure
- Die Motive
- Überblick über das Ausmaß der Landnahmen in SSA
- Ernährungsunsicherheit
- Konzept der Ernährungssicherheit
- Formen der Ernährungsunsicherheit
- Chronische Ernährungsunsicherheit
- Temporäre Ernährungsunsicherheit
- Landnahme und Ernährungssicherheit
- Effekte auf die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln
- Effekte auf den Zugang zu Nahrungsmitteln
- Effekte auf die Stabilität und die Nutzbarkeit von Nahrungsmitteln
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob ausländische Agrarinvestitionen die Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern fördern. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Landnahme in Subsahara-Afrika (SSA). Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Landnahme auf die Verfügbarkeit, den Zugang und die Stabilität von Nahrungsmitteln in SSA.
- Ausländische Direktinvestitionen im Agrarsektor in SSA
- Landnahme als Phänomen in SSA
- Ernährungssicherheit in SSA
- Die Auswirkungen von Landnahme auf die Ernährungssicherheit
- Mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in SSA
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und führt die Forschungsfrage ein. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand zu ausländischen Direktinvestitionen, insbesondere im Agrarsektor in SSA. Es werden verschiedene Theorien zu ausländischen Direktinvestitionen vorgestellt und die Entwicklung der Direktinvestitionszuflüsse nach SSA in den Jahren 2001-2011 analysiert. Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen der Landnahme in SSA. Es werden die Akteure, die Motive und das Ausmaß der Landnahme in SSA beleuchtet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Konzept der Ernährungssicherheit und verschiedenen Formen der Ernährungsunsicherheit. Im fünften Kapitel werden die Auswirkungen der Landnahme auf die Verfügbarkeit, den Zugang und die Stabilität von Nahrungsmitteln in SSA analysiert. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern ausländische Direktinvestitionen, Landnahme, Ernährungssicherheit, Subsahara-Afrika, Agrarsektor, Nahrungsmittel, Entwicklung, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Landnahmen-Phänomen“?
Es bezeichnet den großflächigen Erwerb oder Pacht von Agrarflächen in Entwicklungsländern durch ausländische Investoren (Land Grabbing).
Warum investieren Firmen vermehrt in Agrarflächen in Subsahara-Afrika?
Motive sind steigende Nahrungsmittelpreise sowie die Produktion von Rohstoffen für Biokraftstoffe wie Mais oder Jatropha.
Fördert Landnahme die Ernährungssicherheit vor Ort?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und analysiert die Effekte auf die Verfügbarkeit und den Zugang zu Nahrungsmitteln für die lokale Bevölkerung.
Was ist der Unterschied zwischen chronischer und temporärer Ernährungsunsicherheit?
Chronische Unsicherheit ist ein dauerhafter Mangel, während temporäre Unsicherheit durch kurzzeitige Krisen oder Preisschwankungen ausgelöst wird.
Welche Rolle spielen ausländische Direktinvestitionen (FDI)?
Agrarinvestitionen werden als FDI betrachtet, die zwar Kapital ins Land bringen, aber oft exportorientiert sind und die lokale Versorgung schwächen können.
- Quote paper
- MA/MSc Divine Swerwzie Agbleke (Author), 2013, Fördern ausländische Agrarinvestitionen die Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275876