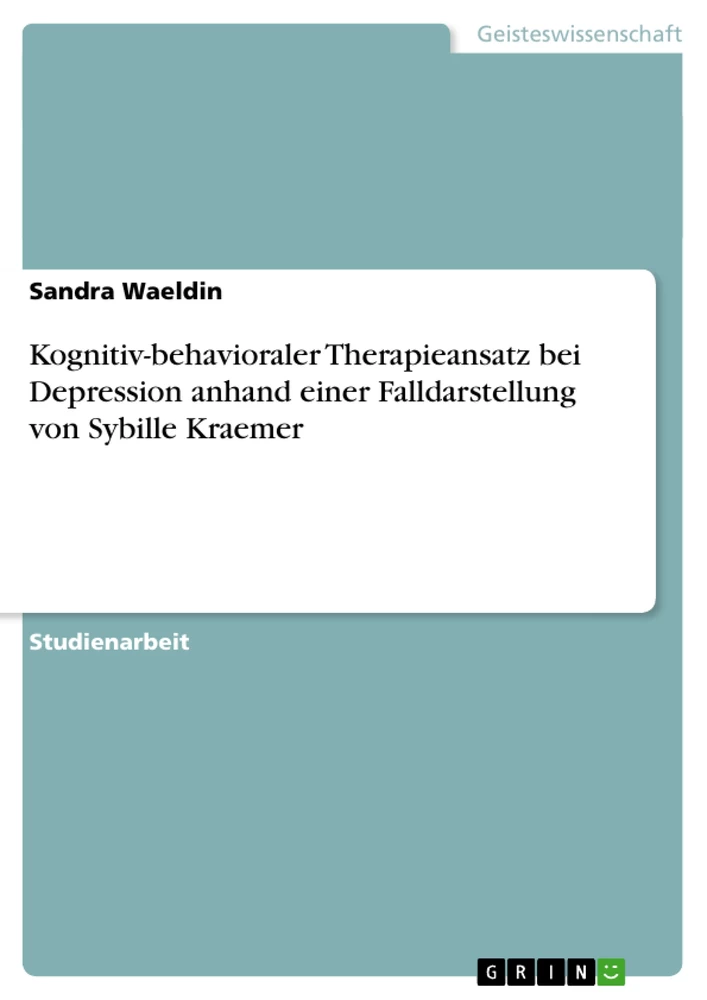Meist entsteht eine depressive Erkrankung nicht plötzlich, sondern entwickelt sich und verstärkt sich schließlich sogar selbst. Neben Stimmungseinbrüchen und sozialem Rückzug sind nicht zuletzt somatische Beschwerden Grund, eine Depression zu behandeln. Verhaltenstherapie hat sich als geeignetes Mittel gezeigt, um diese psychische Krankheit erfolgreich zu überwinden. Hierzu bedient sie sich mehrerer Ansatzpunkte die hauptsächlich das Lösen von Problemen, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression verantwortlich, sind im Blickpunkt haben.
Inhalt
1. Psychotherapie
1.1. Formen der Hilfe
2. Verhaltenstherapie
2.1 Anfänge
2.2. Heute
2.3 Wirksamkeit
3. Kognitiv-behaviorale Einzeltherapie bei depressiven Störungen
3.1 Krankheitsbild
3.2 Entstehung
3.3 Vorgehen
4. Falldarstellung einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Depressionsbehandlung (Kraemer, 2002)
4.1 Patientenvorstellung
4.2 Behandlungsziele und -planung
4.3 Psychoedukation
4.4 Videosequenzen
4.5 Fragebögen
4.6 Diskussion
5. Rückblick und Ausblick
6. Literatur
Eine Krankheit bedeutet eine vorhandene oder bevorstehende Einschränkung in unterschiedlichsten Fähigkeiten um lebensrelevante Situationen zu bewältigen. Da davon häufig nicht zuletzt das eigene Wohlbefinden betroffen ist, suchen kranke Menschen in aller Regel einen Arzt oder vergleichbar fachkundige Perso- nen auf, um Hilfe zu erhalten. Eine Ausnahme ist, wenn man selbst in der Lage ist sich zu helfen, bzw. erwartet, dass der Mediziner die Krankheit nicht schneller oder besser beseitigen kann, als man selbst. Das Behandeln von somatischen Erkrankungen sowie deren Therapie erfährt demnach eine breite Akzeptanz. Häufig wird sie sogar als notwendig erachtet. Gleichwohl scheint dies nicht im gleichen Maße auf körperliche wie auf psychische Störungen zuzutreffen. Es pas- siert häufig, dass die Arbeit eines Psychotherapeuten von Außenstehenden mit Vorbehalt betrachtet wird. Auf diese Tatsache deutet beispielsweise auch hin, dass laut Meyer, Richter, Grawe, von Schulenburg & Schulte (1991) nur etwa drei Prozent der Menschen mit psychischen Störungen eine Psychotherapie in Anspruch nehmen.
1. Psychotherapie
Um das Abheilen einer Krankheit zu ermöglichen oder beschleunigen kann man sich in Therapie begeben. Die Psychotherapie kann demzufolge als „Seelenheil- kunde“ betrachtet werden. Um die Genesung zu fördern bedient sie sich der geis- tigen Beeinflussung. Hierbei stellt diese „geistige Beeinflussung“ keinen undurch- sichtigen Prozess dar, sondern baut auf nonverbaler und verbaler Kommunikati- on auf, die sich, wie die Psychologie auch, auf das Denken, Erleben, Fühlen und Verhalten der Menschen bezieht. Psychotherapie ist also im Grunde eine Interak- tionsform, bei der einige Besonderheiten gelten. Hier sei beispielsweise genannt, dass der Therapeut professionell, respektive bewusst, zielgerichtet und mittels bestimmter Regeln und Strukturen arbeitet. Außerdem ist der Patient leidend und erwartet eine positive Veränderung durch die Behandlung. Allerdings be- schreiben erst die unterschiedlichen Ansätze und Denkrichtungen, die unter dem Oberbegriff Psychotherapie zu finden sind, die genaue Vorgehensweise. Wichtig ist dabei, dass die Wirksamkeit bezüglich vieler Therapiemethoden und Techni- ken in unterschiedlichen Studien „hinreichend belegt“ wurde (s. z. B. in Margraf, Methoden und Ablauf anhand einer Falldarstellung 2000) und zu einem großen Teil auf der aus den Interaktionsprozessen entstandenen Beziehung gründet.
Auch, wenn die Psychotherapie soeben als „einfache“ Kommunikation beschrieben wurde, so wird eine Einflussnahme durch sie meist nur als gerechtfertigt betrachtet, wenn die vorliegenden psychischen Symptome als „Störung mit krankheitswert“ (5. SGB) gelten. Sie dient also, wie im Grunde jede Therapie, in erster Linie der Versorgung Kranker.
Natürlich kann eine Psychotherapie auch, ohne, dass eine Veränderung als not- wendig angesehen wird, zur persönlichen Weiterentwicklung genutzt werden. In diesem Fall wird man jedoch feststellen, dass von den Krankenkassen nur die Behandlung von ebendiesen “behandlungsbedürftigen psychischen Krankheiten“ (Kanfer, 2005, S. 18) und auch nur mittels empirisch als wirksam belegten The- rapieformen bezahlt wird.
Damit eine Psychotherapie eine wünschenswerte Veränderung bewirken kann sollte die Einschätzung ihrer Möglichkeiten sowohl des Patienten als auch des Therapeuten realistisch sein. Es erscheint gleichwohl schwieriger vorhandene Er- wartungen zu übertreffen oder sie zu widerlegen als sie zu erfüllen. Obwohl ba- nal, sollte deshalb bewusst sein, dass sie weder alle Störungen heilen kann, noch den Lauf der Realität verändern oder Menschen gegen ihren Willen auf den „rechten Weg“ führen kann (da es diesen für die Psychotherapie so ohnehin nicht gibt). Sie kann jedoch helfen individuelle Lösungen für spezifische Probleme und Ängste in persönlichen oder zwischenmenschlichen Konfliktsituationen oder auch in Bereichen des Alltags zu finden. Die Chancen für einen günstigen Wandel sol- cher Gegebenheiten sind individuell verschieden und werden bestimmt von der Person selbst sowie ihrer sozialen, kulturellen und materiellen Umwelt. Diese Grenzen muss der Therapeut, aber häufig insbesondere auch der Patient akzep- tieren (lernen).
1.1. Formen der Hilfe
Neben der in diesem Text beschriebenen kognitiven Verhaltenstherapie gibt es noch weitere Zweige der Psychotherapie und Formen von Hilfsangeboten, welche dem psychischen Wohlergehen dienen sollen.
Die kognitiv-behaviorale Therapie und die Psychoanalyse sind die einzigen psychotherapeutischen Ansätze, die von den Krankenkassen bisher als wirk- sam anerkannt wurden. Grob umrissen ist das Ziel der tiefenpsychologischen Verfahren für die aktuelle Problemlage relevante und unbewusste Konflikte aus der Vergangenheit, bzw. Kindheit zu finden und diese zu bewältigen. Au- ßerdem wird ebenfalls Gesprächspsychotherapie angeboten, die hauptsächlich durch eine empathische Haltung des Therapeuten Veränderungen beim Pati- enten ermöglichen will oder die Gestalttherapie, die dies durch ein (achtsam- keitsbasiertes) ganzheitliches Erleben des Augenblicks erreichen will. Die Wir- kung der Systemtherapie soll daraus resultieren, dass die Effekte sozialer Systeme ausfindig gemacht und beachtet werden. So sollen vorhandene Mus- ter in Interaktionen bewusst gemacht und auf Funktionalität hin überprüft werden. Hierbei können möglicherweise neue Ressourcen geschaffen werden. Auszugsweise sind weitere Methoden in Stichworten die Hypnotherapie, z. B. nach Milton Erickson, die Körpertherapie, das Psychodrama, die Transaktions- analyse oder die Logotherapie wie sie Viktor Frank vorschlägt. Darüber hin- aus existieren noch einige alternative Methoden, wie beispielsweise Akupres- sur, Alexander-Technik, Aroma-, Atemtherapie, Ayurveda, Bach-Blüten, bio- dynamische Therapie, Enneagramm, Farbtherapie oder Rolfing. Allerdings kann sich der Hilfesuchende hier meist nur auf eine subjektive Erfolgskontrol- le verlassen und mögliche Effekte sind zudem oft von kurzlebiger Erschei- nungsdauer (Kanfer, 2005). Trotz der zu Anfang genannten Skepsis gegen- über Psychotherapie zeichnet sich daneben eine Zunahme an solchen oder vergleichbaren mehr oder weniger professionellen „Heilverfahren“ ab. Not- wendigerweise gibt es ein breites Spektrum von Hilfs- und Beratungsangebote welche teilweise überaus sinnvoll sind und auch von keiner Psychotherapie er- setzt werden können. Andererseits gibt es einige Verfahren, die zwar dem Namen nach an eine Psychotherapie erinnern, jedoch eher als Selbsterfah- rung - in unterschiedlicher Tiefe - dienen können. Will man unter dem vor- liegenden Angebot eine effektive Methode auswählen, so kann man sich daran orientieren, dass eine gute Therapie in einem professionellen Rahmen statt- findet. Zudem ist sie wissenschaftlich gestützt und die Kompetenzen des The- rapeuten werden im Zuge einer individuellen Problemlösung eingesetzt. Über- dies sollen die so geförderten Veränderungen letztendlich unabhängig von der Therapie bestehen bleiben zum Selbstmanagement führen. Aus dieser Forderung lässt sich die Konsequenz ableiten, dass das angestrebte Ziel im Grunde die Selbsthilfe ist. Sofern diese nicht vorhanden oder nutzbar ist soll das Angebot diese Kompetenz ausbauen und so zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit verhelfen.
2. Verhaltenstherapie
2.1 Anfänge
Der Grundstein der Verhaltenstherapie liegt ausgehend von den 1950er Jah- ren in verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnissen der psychologischen Grundlagenforschung, insbesondere in Lern- und Verhaltenstheorien. Dem- nach gibt es verschiedene Ansätze in dieser Therapierichtung. So kann man sie zu dieser Zeit etwa bei Burrhus F. Skinner in der operanten Konditionie- rung finden. Genauso kann man jedoch wesentliche Bausteine bei Joseph D. Wolpe, der sich, aufbauend auf C. Hull und der klassischen Konditionierung nach Iwan P. Pawlow, kurz vor den 60er Jahren mit der systematischen De- sensibilisierung befasste. Danach folgte nur wenig später Hans J. Eysenck, der die Verhaltenstherapie prägte indem er die Lerntheorien in dem Mittel- punkt stellte. Von der Psychoanalyse grenzt sie sich durch ein mehr verhal- tensbezogenes Konzept ab, welches ebenso wirtschaftlich, wirksam wie auch wissenschaftlich sein soll.
In den 1960ern wurde die zunächst rein behavioristische Sicht um die Aspek- te der Gedanken und Gefühle ergänzt. Nachfolgend wurden die entstandenen Problemlösetechniken in den Rahmen einer positiven therapeutischen Bezie- hung integriert.
2.2 Heute
„Verhaltenstherapie ist ein Ansatz zur Beschreibung, Erklärung und Veränderung menschlichen Leidens.“ (Reinecker, 2005, S. 7)
Die gegenwärtige Verhaltenstherapie hat ihre Ursprünge beibehalten und be- schreibt und erklärt dieses Leiden folglich immer noch mittels allgemeiner psychologischer Modelle. Sie hat jedoch mittlerweile zur Lenkung von Verän- derungen sehr differenzierte Techniken. Daher ist die zentrale Richtlinie wei- terhin, dass das menschliche Verhalten wie auch Gefühle und Gedanken in großen Teilen erlernt sind und somit auch ver- oder umgelernt werden kön- nen. Auch, wenn das auslösende Ereignis in der Vergangenheit liegt, so kön- nen aktuelle positive und somit korrigierende Erfahrungen den Leidensdruck mindern. Zumindest sollen sie zu einem besseren und eigenständigem Umgang damit verhelfen und daher auch auf zukünftige Krisen vorbereiten. Als Ergänzung enthält die Verhaltenstherapie nun ebenfalls eine funktionale Betrachtungsweise auf unterschiedlichen Ebenen. Genauer gesagt wird neben prägenden bzw. vorausgehenden auch nach begleitenden und nachfolgenden Bedingungen sowohl auf Ebenen des Verhaltens, der Kognitionen als auch biologischen Merkmalen gesucht.
Insgesamt baut sie also auf einem bio-psycho-sozialen Verhaltensbegriff auf, der sichtbar behaviorale, wie auch lediglich erschließbare kognitive und emo- tionale Elemente hat, die zum großen Teil erlernt sein sollen. Innerhalb einer vertrauensvollen, verständnisvollen Beziehung, die auf dieser wissenschaftli- chen Basis gründet, sollen Veränderungen bewirkt werden. Diese sollen die Fähigkeiten des Patienten zur Selbstregulation fördern und ebenfalls durch ei- ne positive Orientierung das (Wieder-)Entdecken von persönlichen Qualitäten unterstützen.
Gestaltet man diese Darstellung weiter aus, so ermöglicht unter Umständen paradoxerweise nicht eine änderungsorientierte Sicht in der Therapie eine Besserung, sondern eine, die zunächst den Ist-Zustand vorbehaltlos akzeptiert. Durch eine Annahme der Umstände kann es möglich werden, die momentane Situation als Chance zu sehen und Potentiale für ein systematisches Lösen des Problems zu finden (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).
2.3 Wirksamkeit
Wie anfangs genannt ist die Wirksamkeit vieler psychotherapeutischer Metho- den bei einigen psychischen Störungen belegt worden. Allerdings ist ein „Wir- kungsnachweis“ in solch einer komplexen Situation natürlich nicht unproble- matisch. Zum einen lassen bereits die drei Merkmalsbereiche Patient, Störung und Therapeut - ganz unabhängig von den Merkmalen der Therapieform - ei- ne sehr große Anzahl an möglichen Variablen und deren Kombinationen zu. Deshalb kann ihre Berücksichtigung nur selektiv und in geringem Umfang er- folgen. Darüber hinaus ist die Frage, was eine erfolgreiche Therapie ist, an si- tuationsspezifische Kriterien gebunden, die nicht einmal innerhalb eines Stö- rungsbildes als absolut festgelegt werden können. Weitab davon, welches Merkmal oder welche Technik effektiver ist, gibt es sogar noch grundlegenderes zu klären. Letztendlich ist nämlich zweifelhaft, ob eine (Psycho-)Therapie überhaupt (allein) für eine Änderung verantwortlich ist, oder, ob die Ursache außerhalb der Therapie zu suchen ist.
Für ein klareres Bild über die Wirkungsweise von Psychotherapien ist es not- wendig wirksame Faktoren zu identifizieren. Insbesondere hat sich z. B. Klaus Grawe bereits 1984 (1994, 95) in einer umfangreichen Metaanalyse mit den Wirkfaktoren von Psychotherapien beschäftigt (s. auch Frank, 1985, Preuss 1986). Als Grundlage hat er die Beziehung zwischen Therapeut und Patient bestimmt. Diese soll nach Asay & Lambert (2001) in Abhängigkeit von ihrer Qualität bis zu 30% einer erwünschten Veränderung bestimmen. Hauptsäch- lich spielen empathisches Zuhören, eine nicht wertende Akzeptanz, Verständ- nis, eine fachliche Haltung und Vertrauen eine wichtige Bedeutung. Durch diese Eigenschaften sollen Patienten einen Raum finden, in dem sie sich öff- nen können und zu Veränderungen ermutigt und werden.
Daneben zählen Grawe, Donati und Bernauer (1994) weitere Faktoren auf, die im Sinne einer allgemeinen Psychotherapie als wirksame Bestandteile einer Therapie gelten können. Hierzu gehören die Aktivierung von Ressourcen und Problemen. Ergänzend soll der Patient durch eine um Klärung bemühte Haltung schließlich zu Einsicht und Selbsterkenntnis gelangen und fähig sein, die Problemstellungen aktiv zu bewältigen.
Asay & Lambert (2001) unterstellen jedoch den spezifischen Techniken und Methoden einer Psychotherapie lediglich dieselbe Aufklärungsleistung, wie einem Placeboeffekt, nämlich 15% der Erfolgsvarianz. Mit anderen Worten entspricht das dem Einfluss, der allein durch die Erwartungen der Patienten zu einem erfolgreichen Wandel beitragen soll. Den größten Einfluss (40%) sprechen sie der Wirkung von ohnehin schon existierenden Strukturen im jeweiligem sozialem Umfeld oder der Persönlichkeit des Patienten zu. Auf diese kann der Therapeut folglich nur geringfügig einwirken.
Dieses Modell der gemeinsamen psychotherapeutischen Faktoren nach Asay & Lambert (2001) kann wohl als Mahnung an Therapeuten verstanden werden, den eigenen Einfluss nicht zu überschätzen und dennoch in dem vorgegebe- nen Rahmen bestmögliche Voraussetzungen für positiv verändernde Effekte zu schaffen. Gleichzeitig kann es aber vielleicht auch als Entlastung betrachtet werden. Bei allen Wirkungen, die eine Psychotherapie haben kann, ist estrotzdem nur möglich innerhalb der, durch den Patient vorgegebenen Struktu- ren und Voraussetzungen zu arbeiten. Beispielhaft lässt sich ergänzen, dass gemäß Wolfersdorf & Heindl (2004) zirka zehn Prozent der Patienten mit De- pression als „therapieresistent“ gelten. Das bedeutet zwar nicht, dass eine Psychotherapie bei diesen Patienten zwecklos ist, wohl aber, dass sie erwar- tungsgemäß nicht die übliche Wirkung hat. In diesem Fall kann sie den Pati- ent immer noch darin unterstützen, die Krankheit als nächstes anzunehmen und dann weitestgehend in den Alltag zu integrieren und mit ihr umzugehen.
In der Literatur (z. B. Nathan & Gorman, 2002) wird die kognitive Verhaltens- therapie als eine der am besten empirisch validierte Therapieform angesehen. Bis auf wenige Einzelfälle, in denen ebenfalls andere Therapieformen mindes- tens ebenso wirksam zu sein scheinen, kann sie in einem sehr breiten Spekt- rum psychischer Störungen angewendet werden. „Aushängeschilder für die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischen Vorgehens sind die Behandlung von Ängsten, Zwängen, Depressionen, sozialer Unsicherheit, Kontakt- oder Kom- munikationsproblemen, psychosomatischen Krankheiten, Schlaflosigkeit, Schmerzen, Süchten/ Abhängigkeiten, Essstörungen, Partnerschaftsproble- men, Sexualproblemen, Stressbewältigung, Verhaltensauffälligkeiten bei Kin- dern und Jugendlichen, Erziehung allgemein, Elterntrainings, Arbeit mit schi- zophrenen Personen und deren Angehörigen. Dementsprechend ist die Verhal- tenstherapie in den 80er Jahren in Deutschland zu einem anerkannten „Richt- linienverfahren“ geworden.“ (Kanfer, 2005, S. 25f)
3. Kognitiv-behaviorale Einzeltherapie bei depressiven Störungen
Meist entsteht eine depressive Erkrankung nicht plötzlich, sondern entwickelt sich und verstärkt sich schließlich sogar selbst. Neben Stimmungseinbrüchen und sozialem Rückzug sind nicht zuletzt somatische Beschwerden Grund eine Depres- sion zu behandeln. Verhaltenstherapie hat sich als geeignetes Mittel gezeigt um diese psychische Krankheit erfolgreich zu überwinden. Hierzu bedient sie sich mehrerer Ansatzpunkte die hauptsächlich das Lösen von Problemen, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression verantwortlich, sind im Blick- punkt haben.
3.1 Krankheitsbild
Unter den affektiven Störungen ist die unipolar verlaufende Depression die am weitest verbreitete Krankheit. Ebenfalls ist ihre Auftretens- wahrscheinlichkeit angesichts eines Lebenszeitrisikos, das sich für Männer auf 11-16% und für Frauen auf 20-26% verläuft, sehr hoch. Allerdings werden dennoch über 65% der erkrankten Personen nicht behandelt. Gründe hierfür sind unter anderem, dass sie selbst keine Hilfe in Anspruch nehmen oder, weil darüber hinaus in etwa der Hälfte der Fälle die Depression nicht richtig diag- nostiziert wird.
Martin Hautzinger (z. B. 2000), als einer der bekanntesten Autoren, die sich mit Verhaltenstherapie und speziell mit Depression auseinander gesetzt ha- ben, beschreibt folgende Symptomatik: Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit, Interesseverlust, Hoffnungslosigkeit, Antriebsmangel, häufig Ängstlichkeit, körperliches Unwohlsein, erhöhte Ermüdbarkeit, Verlust von Interesse an fast allen Aktivitäten, Mangel an Reagibilität auf üblicherweise angenehme Reize, Morgentief, frühmorgendliches Erwachen und erhebliche somatische Sympto- me wie z. B. Gewichtsverlust. Häufig sind auch Suizidgedanken oder
-Handlungen zu finden. Typisch für eine Depression sind neben diesen psychischen und somatischen Symptomen auch kognitive Verzerrungen. Besonders erscheinen Schlussfolgerungen willkürlich, systematisch negativ getönt und als stabil und internal begründet (Laux & Möller, 2008).
Diagnostiziert wird sie nach dem ICD-10 als leichte, mittelgradige, schwere oder psychotisch depressive Episode. In einigen Fällen ist die Depression außerdem rezidivierend. Eine Depression kann postpartal, altersbedingt, saisonal oder atypisch wie auch chronisch als Dysthymie oder als Anpassungsstörung, bzw. depressive Reaktion auftreten. Die depressive Störung hat eine hohe Komorbidität mit schizophrenen und zwanghaften Krankheiten, Persönlichkeits- und Angststörungen, sowie somatischen Erkrankungen wie Hypertonie, Hirnblutungen, Diabetes und Infektionen. Häufig gehen diese zeitlich einer Depression voran (Schauenburg & Zimmer, 2005).
3.2 Entstehung
Die Entstehung einer depressiven Erkrankung wird in der Verhaltenstherapie als multifaktoriell determiniert betrachtet. Als Erklärung wird vorrangig das Vulnerabilitäts-Stress-Modell heran gezogen. Es setzt sich aus den drei Vulnerabiltätsbereichen der (Neuro-)Biologie, der Persönlichkeitsstruktur und Ereignissen in der persönlichen Umwelt also insbesondere Stressoren zusam- men. Angenommen wird, dass stets mehrere Faktoren zusammen wirken müssen um eine Depression auszulösen. Werden keine Maßnahmen getroffen und diese Umstände verändert kann eine chronische Depression (ICD-10: Dysthymie) auftreten, die meist kein sehr starkes Stimmungstief hat, jedoch häufig über zwei Jahre anhält.
Als Risikofaktoren gelten auszugsweise vorangegangene eigene oder auch familiäre depressive Erkrankungen, weibliches Geschlecht, frühe Verlusterfahrungen, Missbrauch oder Substanzabhängigkeit.
Um möglichst viele Facetten des Entstehungsmodells mit einzubeziehen wer- den neben situativen Umständen, die das Verhalten, Denken und Fühlen be- einflussen insbesondere verstärkungstheoretische und kognitionspsychologi- sche Ansätze betrachtet. Das kognitiv-verhaltenstheoretische Störungskon- zept nimmt auf der einen Seite an, dass ein Mangel an positiven Verstärkern und ein Überwiegen an negativen Reizen den Beginn und Verlauf einer De- pression prägen. So treten depressive Verhaltensweisen häufig auf Grund von sozialen oder kommunikativen Defiziten auf, die einer positiven und somit verstärkenden Interaktion abträglich sind. Darüber hinaus unterstützt ein da- durch provoziertes helfendes und empathisches Verhalten Dritter das Beibehalten dieser unpassenden Verhaltensmuster. Auf der anderen Seite kann die Erkrankung durch belastende Situationen und Erfahrungen von Hilflosigkeit ausgelöst werden. Daraufhin begünstigen selektive, negative und einseitige Wahrnehmungen das Aufrechterhalten dieser depressiven Gedankenmuster.
3.3 Vorgehen
Nach Hautzinger (1997) kann man bei der Behandlung von depressiven Stö- rungen mittels kognitiv-behavioraler Einzeltherapie fünf Schritte unterschei- den. Ihre Techniken beziehen sich demnach vorzugsweise auf die Korrektur dysfunktionaler Gedankenstrukturen und Verhaltensmuster. Die Grundlage einer Psychotherapie bildet in der Regel der Überblick über die Probleme des Patienten und die therapeutische Beziehung. Ziel ist es, dass dringliche, wichtige und auch veränderbare Probleme bestimmt werden, um sie spezifisch angehen zu können. Gleichzeitig soll der Therapeut durch akti- ves Zuhören, ein zunächst vollständiges Akzeptieren der Situation und ein kompetentes Auftreten ein therapeutisch wirksames Arbeitsbündnis zum Pati- enten aufbauen.
Anschließend soll der Therapeut dem Patienten das therapeutische Modell vermitteln und das sich gegenseitig beeinflussende Trias zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten erläutern. Dies soll möglichst anhand von eigenen Erfahrungen des Patienten geschehen und auf diesen sollte ebenso die Planung für das Vorgehen der Therapie aufbauen.
Die folgenden drei Phasen stellen die Schwerpunkte des therapeutischen Vorgehens dar (Hautzinger, 2000) und werden je nach depressionsrelevanten Problemen unterschiedlich gewichtet.
Einen Teil bildet die Steigerung der Aktivität der Patienten, z. B. nach Lewinsohn. Da man davon ausgehen kann, dass depressives Verhalten unter anderem mit einem zurückgezogenen und meist inaktiven Verhalten gleichzusetzen ist, haben viele Patienten ein Defizit an angenehmen Erlebnissen. Positive Verstärker, die individuell gefunden und stufenweise zunehmend in den Tagesablauf eingeplant werden, sollen (Erfolgs-)Erlebnisse bewirken, die sich auf das Erleben der Patienten positiv niederschlagen. Der Zusammenhang zwischen der Möglichkeit das Handeln zu steigern und damit die Stimmung zu beeinflussen soll erfahrbar gemacht werden.
Neben diesem Rückzug kann man bei Menschen, die an Depression erkrankt sind außerdem ggf. nur gering ausgeprägte soziale Kompetenzen finden. Deshalb befasst sich eine weitere Phase der Therapie mit der Förderung in- strumenteller Fertigkeiten, welche zufrieden stellende soziale Kontakte er- möglichen, die Selbstsicherheit erhöhen und somit zum Wohlbefinden beitra- gen. Hierzu sind Rollenspiele und andere Übungen, Bearbeitung konkreter Probleme, Rückmeldungen über konkrete Verhaltensweisen oder Verstärken kompetenter Interaktionsarten möglich. Vorschläge zur genauen Vorgehens- weise kann man bei Ullrich & de Muynck oder Hinsch & Pfingsten finden.
Ergänzend werden in der Regel schließlich kognitive Therapiemethoden einge- setzt um systematisch verzerrte Wahrnehmungs- und Denkfehler aufzude- cken und durch funktionale Kognitionen zu ersetzen. Typischerweise tragen diese automatischen, übergeneralisierten und selektiv negativen Gedanken- muster zu dem negativen Empfinden während einer Depression bei und ver- ändern ebenso Erwartungen wie Erinnerungen. Diese gilt es zu erfassen um sie dann überprüfen und verändern zu können. Mittel sind hierbei etwa die Kognitionen an der Realität zu testen, ihre Kriterien zu prüfen, Alternativen und Reattributionen zu erarbeiten, zu Übertreiben und Entkatastrophisieren sowie die Vor- und Nachteile von Einstellungen zu beleuchten. Auch bei dieser Technik dient - dem bereits beschriebenen Dreieck aus Fühlen, Denken und Handeln entsprechend - die Veränderung der Gedanken der Verbesserung des Empfindens. Mit diesen kognitiven Therapiemethoden hat sich zum Bei- spiel A. T. Beck oder A. Ellis in seiner rational-emotiven Therapie beschäftigt.
4. Falldarstellung einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Depressionsbehandlung (Kraemer, 2002)
In „Psychotherapie für die Praxis“ (Kraemer & Huber, 2002) findet man nachfolgenden Fall einer depressiven Patientin, die von Frau Kraemer in den Jahren 1999 / 2000 mit einer kognitiv-behavioralen Therapie behandelt wurde.
4.1 Patientenvorstellung
Anamnese
In der Anamnese werden zunächst die wichtigsten Merkmale der Patientin vorgestellt: ihre vergangenen und aktuellen familiären, beruflichen wie per- sönlichen Umstände sowie Probleme, Schicksalsschläge und bisherige Thera- pien. Unvollständigerweise sind hier einige der zentralen Punkte, die Frau Kraemer aus dem Leben der Patientin berichtet, erwähnt: als allein stehende, angestellte Frau hat sie in ihrer Kindheit zusammen mit den Geschwistern viel Angst durch einen strengen Vater und einer labilen Mutter, die Scheidung der Eltern und den Tod des Vaters erleben müssen. Sie wurde in dieser Zeit viel kritisiert und eingeengt. Als Erwachsene hat die Patientin eine schwere kör- perliche Erkrankung mit anhaltenden Folgen, eine Scheidung und mehrere depressive Erkrankungen erfahren. Depressive Symptome sind bisher offen- bar bei mehreren Familienmitgliedern aufgetreten. Ein Teil der Problemberei- che hat sie bereits in einer Gesprächstherapie bearbeitet.
Ziel ist es zunächst einen Einblick zu erhalten und auf Grund der vorliegenden Informationen die zentralen Probleme zu identifizieren. Unter den möglichen Ansatzpunkten gilt es denjenigen zu finden, der für die Patientin akut ist und am dringlichsten bearbeitet werden soll. Darüber hinaus wird in dieser Phase des Kennenlernens und Datensammelns eine therapeutische Beziehung aufgebaut. Zunächst werden alle Ansichten der Patientin vorbehaltlos akzeptiert und ihr wird Hilfe in dem therapeutischen Rahmen angeboten. Zusammen mit aktivem Zuhören, einer empathischen Haltung der Therapeutin sowie der entstandenen Erwartung und Handlungsbereitschaft der Patientin soll eine (veränderungs-) förderliche Basis gebildet werden.
Makroebene
Anschließend werden aus den vorhandenen Angaben wesentliche Aspekte in der Entwicklung der Patientin betrachtet. Diese sollen, nach Einschätzung der Therapeutin, zu dem aktuellen problemhaften Verhalten geführt haben. Als zentral betrachtet Frau Kraemer den Erziehungsstil, durch den die Patien- tin sich möglicherweise nicht richtig entfalten konnte, sowie die zusätzlichen belastenden Ereignisse, die offenbar Frustration und somit mehrfach einen Verlust an positiven Verstärkern zur Folge hatten. Ihrer Vermutung nach wirkt der starke Zusammenhalt mit den Schwestern bei gleichzeitiger Fokussierung auf die negativen Aspekte der Vergangenheit als Verstärkung ebendieses dys- funktionalen Verhaltens. Außerdem entwickelte die Patientin auf Grund der Erlebnisse „Autonomie und perfektionistischen Leistungsehrgeiz, auch sehr viel Verantwortlichkeit“ (Kraemer, 2002, S. 92).
Die hypothetische Funktion der Depression vermutet die Therapeutin darin, dass die Krankheit der Patientin es ihr ermöglichte Konsistenz in ihrer perfektionistischen, pflichtbezogenen Einstellung und der negativen Sicht auf die Vergangenheit zu wahren und sich doch gleichzeitig zurückzuziehen um „Zuwendung (zu) erhalten“ (Kraemer, 2002, S. 94).
Frau Kraemer hält schließend fest, dass die Patientin sich selbst mehr Aufmerksamkeit und Liebe widmen sollte um so eine gute Beziehung zu sich selbst und später auch zu anderen aufbauen zu können.
Mikroebene und SORC-Modell
Um einen weiteren diagnostischen Zugang zu erhalten analysiert die Therapeutin beispielhaftes Verhalten der Patientin nach dem SORC-Modell. Diese Verhaltensanalyse soll anhand einer möglichst charakterisierenden Situation für die Patientin geschehen. Hierbei versucht das Modell zu beschreiben, wie die auslösende Situation auf einen Organismus in einem biopsychosozialen System trifft. Dieser zeigt daraufhin eine problematische Reaktion auf kognitiver, emotionaler und behavioraler Ebene welche wiederum zu einer kurzoder langfristigen Konsequenz führt.
Die ausgewählte Beispielsituation ist gleichzeitig die zweite der in der Thera- pie aufgezeichneten und unten knapp vorgestellten Videosequenzen. Wobei das dargestellte Thema sich mit der Abgrenzung zu der Schwester der Patien- tin beschäftigt. Die auslösende Situation ist, dass sich diese nicht mit dem Psychiater zufrieden ist, an den sie die Patientin vermittelt hat. Diese Gege- benheit passt jedoch nicht zu dem perfektionistischen Bild, das die Patientin von sich hat und lässt sie um die Anerkennung fürchten. Ihre Reaktion auf kognitiver Ebene sind daraufhin Gedanken, wie, dass sie verantwortlich für das Wohlergehen der Schwester sei, jedoch versagt hat. Außerdem entwickelt sie auf emotionaler Ebene Schuldgefühle und hat Angst vor Ablehnung und vermeidet folgend die Auseinandersetzung mit der Schwester. Kurzfristig ver- spürt die Patientin so Erleichterung, letztendlich wirkt dieses Verhalten jedoch selbstbestrafend und verstärkt ihre Motivation übermäßig hilfreich, unabhän- gig und perfekt zu sein um anerkannt zu werden.
Durch die Analyse dieser Situation bestätigt die Therapeutin ihre Absicht, die Patientin zu mehr Selbstachtung und auch Selbstsicherheit anleiten zu wollen.
Zusammenfassend ist der Zweck der ersten Sitzungen demnach mittels der Angaben der Patientin die Auslöser ihrer (wichtigsten) Probleme zu erkennen, diese zu erörtern und anschließend gemeinsam Schritte zu ihrer Lösung zu finden.
4.2 Behandlungsziele und planung
Nachdem die zentralen Problembereiche umschrieben sind, legen Therapeutin und Patientin nun gemeinsam fest, welche Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühle verändert werden sollen. Hierzu kann versucht werden Alternativen zu finden oder bestehende Muster umzustrukturieren.
Laut der Einschätzung von Frau Kraemer hat die Patientin einen starken Drang, sich perfektionistisch und hilfreich zu verhalten um überwiegend Aner- kennung zu erfahren. Aus diesem Grunde soll die Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit der Patientin durch Üben von Spontaneität, Verstärken des Selbst, Rollenspiele und imaginative Verfahren zur Perspektivenänderung durchgeführt werden. Da dieses Selbstbild in Zusammenhang mit Furcht vor Ablehnung und Verlassen werden assoziiert ist, soll sie zudem ein Entspannungs- und Genusstraining wahrnehmen und lernen Gefühle und Äußerungen zu differenzieren. Zusammen mit einer kognitiven Umstrukturierung zugunsten von konstruktiven Gedanken sollen so auch die selbstbestrafenden Denkvorgänge wie auch Ängste reduziert werden.
Die Patientin ist mit einer rezidivierenden depressiven Episode diagnostiziert, wobei sie gegenwärtig eine leichte Episode hat. Darüber hinaus erwähnt die Therapeutin leicht zwanghafte und histrionische Züge. Infolge einiger vorhandener Ressourcen, einer hohen Motivation und Differenziertheit der Patientin, sowie offenbar ein guter Zugang zur Therapeutin schätzt sie eine Besserung als gut erreichbar ein.
Sowohl die Ziele und Schritte in der Therapie, wie auch die (vorläufige) Diagnose, eine Einschätzung der Prognose und eine Beziehungsanalyse stellt die Therapeutin vor Beginn der ambulanten Einzeltherapie. Dies dient der Bestandsaufnahme genauso, wie es zielführend sein soll und eine rückwirkende Verzerrung verhindern soll. Ebenfalls legt sie der Patienten verschiedene Fragebögen vor, um eine Veränderung während der Therapie feststellen zu können. Diese sind weiter unten genauer beschrieben.
4.3 Psychoedukation
Die Patientin hat neben den Einzelgesprächen zugleich die Psychoedukations- Gruppe des Krankenhauses besucht. Laut Angaben soll sie von dieser Gruppe profitiert haben und überdies berichtet die Patientin in der Falldarstellung selbst positiv davon. Psychoedukation kann als „zielorientierte und struktu- rierte Vermittlung präventiv relevanter Informationen von Professionellen an Patienten, kombiniert mit den psychotherapeutischen Wirkfaktoren einer Gruppentherapie verstanden“ werden (Pitschel-Walz, Bäuml & Kissling, 2003, S. 3). Sie soll also nicht nur durch Informationen aufklären, sondern hat als weiteres Ziel die emotionale Entlastung der Patienten. Insbesondere, wenn die Gruppen nicht nur einmalig, sondern, wie auch in dem vorgestellten Fall, längerfristig stattfinden nimmt die Bedeutung der gruppentherapeutischen Wirkung zu. Nach Grawe, Donath & Bernauer (1994) zählen hierzu die Beiträ- ge einer Klärung und Einsicht in das Verhalten, ein Zugewinn an Kompeten- zen durch Wissen, wie auch die Interaktion mit dem Therapeuten und in der Gruppe. Fiedler (1996) bezeichnet die Psychoedukation sogar als störungs- spezifische Verhaltenstherapie. Indem das krankheitsbezogene Wissen erhöht wird soll auch die Compliance, im engeren Sinne also die Einnahme der Medi- kamente, und die allgemeine Lebensqualität der Patienten erhöht werden. Kritiker wenden gerade bei diesen Argumenten ein, dass Psychoedukation le- diglich dazu dient, Patienten zu belehren und ihnen eine langfristige Medika- menteneinnahme schmackhaft zu machen. Tatsächlich ist das Interesse der Patienten an krankheitsbezogenen Erklärungen jedoch hoch und etwa 79% der Befragten wünschen sich ergänzend Informationen über Medikamente (Görnitz, 2002). Überdies ist Noncompliance, also das frühzeitige Absetzen, Nicht-Einnehmen oder eine zu geringe Dosierung von Medikamenten mit ei- nem ungünstigen Krankheitsverlauf assoziiert (Guscott & Taylor, 1994).
Im vorliegenden Fall hat sich die psychoedukative Gruppe unter der Leitung von Frau Pitschel-Walz über acht wöchentliche Treffen mit jeweils etwa zwölf Patienten erstreckt. Der Inhalt bezieht sich auf die Symptome der Depression, ihre Ursachen sowie Behandlungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann über das Vulnerabilitäts-Stress-Modell, Reizübertragung, medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung, Selbsthilfe, Möglichkeiten zur Aktivitätssteigerung, Abschwächen von negativen Gedankenmustern, Veränderung der Einstellung, Entspannungsmöglichkeiten, Verbesserung sozialer Kompetenzen und den Aufbau eines Krisenplans gesprochen werden.
In einer Sequenz, in der die Patientin mit der Therapeutin spricht, beschreibt die Patienten die Gruppe als „hochinteressant“ (Kraemer, 2002, S. 99) und unterstreicht die Wichtigkeit, Informationen über die eigene Krankheit zu erhalten. Sie fühlt sich durch die Psychoedukationsgruppe ermutigt mit Mitpatienten auszutauschen, gezielt nachzufragen und schildert es als angenehm zu erfahren, dass andere sich für ihre Probleme interessieren.
In ihren Zielen ähnelt die Psychoedukation demnach der kognitiv- verhaltenstherapeutischen Depressionsbehandlung. Beide Ansätze sehen ei- nen wesentlichen Bestandteil im Erarbeiten und Üben alternativer kognitiver und verhaltensbezogener Reaktionen. Im Gegensatz zur Psychotherapie ar- beitet die Psychoedukation jedoch weitgehend unabhängig von der individuel- len Problemstellung hauptsächlich auf der Basis von Informationen.
4.4 Videosequenzen
Die Falldarstellung der Patientin wird von Frau Kraemer im Folgenden Ab- schnitt anhand von drei Sequenzen, die auf Video aufgezeichnet sind, vertieft. Sie stellen beispielhafte Ausschnitte aus der verhaltenstherapeutischen Be- handlung dar.
Erste Sequenz
In der ersten kurzen, aufgezeichneten Sitzung geht es um selbstabwertende Kognitionen der Patientin. Die Therapeutin weist darauf hin, dass diese „Mus- ter (der) Selbstbestrafung“ bereits bei „geringen Schwierigkeiten“ auftreten (Kraemer, 2002, S. 102). Nachdem sie eine Nacht mit einem Mann, den sie zuvor kennen gelernt hat, verbrach hat beschreibt die Patientin in der Se- quenz, dass sie sich unwohl fühlt. Dies geschieht laut ihrer Schilderung, da sie sich „wieder irgendwelche Zwänge auf(erlege)“ (siehe ebenda) und ihrer Be- kanntschaft äußerst zuvorkommend sein will. Rückblickend empfinde sie das jedoch als Fehler. Daraufhin reflektiert Frau Kraemer ihr Verhalten und ver- sucht sie darauf hinzuweisen, was diese Gedanken, die sie währenddessen und im Nachhinein hat, bei der Patientin auslösen. Sie scheint ihr verdeutli- chen zu können, dass sie durch ihre Gedankenmuster mehrmals negative Ge- fühle bei sich bewirkt.
Zweite Sequenz
Die zugrunde liegende Situation dieser Sequenz mit dem Thema der Abgrenzung zu der Schwester der Patientin ist bereits weiter oben nach dem SORCModell aufgeschlüsselt geschildert.
In diesem Abschnitt des Gesprächs gibt die Patientin wieder, wie sie diese Er- lebnisse einschätzt und was sie, ihrer Meinung nach, hätte anders machen können. Vor allem erwähnt sie Schuldgefühle, die sie habe, da ihre Anstren- gung bei ihrer Schwester letztendlich keinen Erfolg haben. Währendessen lenkt die Therapeutin das Gespräch wiederholt auf zentrale und augenschein- lich problematische Aspekte des Verhaltens der Patientin. Sie versucht sie da- rauf aufmerksam zu machen, dass sie in dieser Situation, wie auch im Laufe der Sitzung, statt ihrer eigenen Probleme wiederholt die Anliegen und Probleme anderer (hier: ihrer Schwester(n)) bespricht. Deshalb fordert Frau Kraemer die Patientin auf „Reden sie mal über sich.“ (Kraemer, 2002, S. 104) um sie zu ermutigen, sich selbst mehr als Mittelpunkt zu sehen. Indem das Verhalten auch in dieser Situation analysiert und reflektiert wird und anschließend funktionales Denken geübt wird, sollen die Schuldgefühle reduziert und durch eine förderlichere Sichtweise ersetzt werden.
Dritte Sequenz
Das letzte Video der vorliegenden Falldarstellung beschreibt nach Frau Krae- mer die Nachbesprechung „so eine(r) Art Schlüsselstunde“ (Kraemer, 2002, S. 104). In dem vorherigen Gespräch verspürte die Patientin bei Betrachten eines Familienalbums starke positive Gefühle, auch gegenüber ihrem bis da- hin entschieden abgelehnten Vater. Durch diese emotionale Reaktion war ihr eine Veränderung der Sicht auf die Vergangenheit möglich. Frau Kraemer ver- sucht nun durch ein Wiederholen des Erlebten diese zu festigen. Darüber hin- aus beabsichtigt sie eine Vertiefung und Übertragung auf andere Bereiche, wie das Selbstbild der Patientin. Diese schließt damit, dass sie den positiven Dingen nun mehr Raum geben wolle und auch an sich mehr Positives sehen will.
Die grundlegenden Mittel der Therapeutin sind in diesen Sequenzen das Nachfragen, das die Patientin zum Denken und Erkennen anregen soll um sie so zu einer kognitiven Umstrukturierung zu bewegen, eine kontinuierliche Analyse der Problemlage und der Motivation der Patientin sowie wiederholtes Verdeutlichen vereinbarter Ziele. Außerdem gibt sie Rückmeldungen über Veränderungen und stabilisiert diese durch positive Äußerungen.
4.5 Fragebögen
Wie vorangehend angedeutet kann man, um einen Zugewinn an Objektivität bezüglich der Wirksamkeit der Therapie zu erhalten, Fragebögen von Patien- ten ausfüllen lassen. Frau Kraemer legte der Patientin hierzu im November 1999 und im Mai 2000 eine Symptomliste, einen Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen (IPC, Krampen, 1981), einen Weiteren zur Selbstaufmerksamkeit (SAM, Filipp & Freudenberg, 1989) und einen Fragebogen irrationaler Einstellungen nach Klages (1989) vor.
Zum ersten Zeitpunkt kreuzte die Patientin 16 Symptome an, wie z. B. Alpträume, Kopfschmerzen, Depressionen, Müdigkeit, Angst und Schlaflosigkeit. Zehn davon ließ sie beim zweiten Zeitpunkt aus.
Nach den Werten der Fragebögen zu schließen hat die Patientin, mit unwe- sentlichen Veränderungen, eine durchschnittliche Selbstverantwortung und einen geringe Überzeugung an externaler Kontrolle beibehalten. Post schien sie die private Selbstaufmerksamkeit (vergleichbar mit Selbstreflexion) zuge- nommen zu haben, bei gleich gebliebener öffentlicher Selbstaufmerksamkeit (also die Aufmerksamkeit, die sie Meinungen anderer schenkt). Der Fragebo- gen zu irrationalen Einstellungen deutet auf die stärksten Veränderungen hin. Insbesondere die Internalisierung von Misserfolgen und die negative Selbst- abwertung scheinen auf einen durchschnittlichen Wert gesunken zu sein.
Diskutabel ist hierbei natürlich, inwieweit soziale Erwünschtheit, angesichts der meist offensichtlichen Fragen, diese Veränderung beeinflusst.
4.6 Diskussion
Den Schluss der Falldarstellung bilden Anmerkungen aus dem Auditorium und eine Diskussion unter den Anwesenden über die vorgestellte Behandlungs- technik.
Hauptsächlich wird in dieser Runde thematisiert, dass sowohl die Patientin ei- ne positive, offene Art mit vielen stärkenden Rückmeldungen zeigt, wie, dass auch der Umgang mit Frau Kraemer positiv ist und auf einer emotionalen Gemeinsamkeit basiert. Weiter wird angemerkt, dass es auf dieser Grundlage offensichtlich gut möglich ist positive Verstärker aufzubauen und, dass die Therapeutin im Gespräch eine Perspektivenänderung durch eine kognitive Distanzierung erreichen wollte. Aufgrund der weitgehend stabilen Affektivität der Patientin ist das Bearbeiten der dysfunktionalen Kognitionen der wichtigs- te Aspekt der Therapie.
Auf eine Frage hin erläutert Frau Kraemer außerdem, dass es bei Patienten mit einer reaktanten Haltung gegenüber der Therapie oder dem Therapeuten ratsam ist konfrontativ vorzugehen. So kann häufig die aversive Haltung zu Nutze gemacht werden indem der Therapeut darauf eingeht, dass Patienten eine Veränderung ablehnen um Kontrolle zu erhalten.
Von den „drei psychologischen Antidepressiva Aktivitäten, Sozialkontakte und der Beck’sche(n) kognitiven Triade“ (also der Einstellung zu sich selbst, der Umwelt und gegenüber der Zukunft) (Kraemer, 2002, S. 112) ist bei der Pati- entin sicherlich letztgenanntes der zentrale Ansatz der Therapie. Wobei die Therapeutin versucht, statt einer Steigerung der Aktivität, sogar eher Ruhe- phasen umzusetzen.
5. Rückblick und Ausblick
Letztendlich scheint die kognitive Verhaltenstherapie bei vielen Störungen eine wirksame Methode zu sein um Symptome zu lindern und wohl auch, um im begrenzten Rahmen die Ursachen zu verändern. Dies trifft offenbar nicht nur auf depressive Störungen zu, wie in der Falldarstellung von Frau Kraemer abgebildet. Trotz aller positiven Aussichten und mehr oder weniger starken Belegen bleibt es dem ungeachtet lohnenswert den Blick auf die Grenzen der kognitiv-behavioralen Therapie und allgemein psychotherapeutischer Verfahren zu richten. Eine optimistische Erwartung bezüglich der Genesung der Patientin von Frau Kraemer soll dennoch nicht außer Acht lassen, dass diese bereits eine längere Psychotherapie hinter sich hat und trotzdem erneut depressiv wurde.
Erst dort, wo Beschränkungen sichtbar sind kann man beginnen diese zu erweitern oder möglicherweise auch zu überschreiten. Vielleicht kann dies auf einem Weg sein, der sich der Form einer allgemeinen Psychotherapie nach der Idee von Grawe annähert. Vielleicht können dieser Forderung auch (noch) spezifischere Techniken bereits bestehender Verfahren gerecht werden.
Wenn es auch fragwürdig ist, inwieweit Ansichten, Verhaltensweisen oder Gedankengänge eines Menschen überhaupt beeinflusst werden sollten, so gibt es zukünftig vielleicht eine (psychotherapeutische) Methode, die wie ein individuelles Allzweckwerkzeug angewendet werden kann.
Gewissermaßen kann man den Gedanken von Frau Kraemer hierzu als Idee betrachten, die in diese Richtung weist:
„Und es geht ja nicht darum, in der (ambulanten) Therapie nur eine akute De- pression zu behandeln, sondern den Boden für weitere Depressionen nicht mehrso fruchtbar sein zu lassen (…), dass sie (…) damit anders umzugehen lernt.“ (Kraemer, 2002, S.112)
6. Literatur
Asay T P & Lambert M (2001). Empirische Argumente für die allen Therapien ge- meinsamen Faktoren: Quantitative Ergebnisse. In M A Hubble, B L Ducan & S L Miller (Hrsg.). So wirkt Psychotherapie. Empirische Ergebnisse und praktische Forderungen (S. 41-82). Dortmund: Verlag modernes lernen.
Fiedler P (1996). Verhaltenstherapie in und mit Gruppen. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Frank J D (1985). Die Heiler. München: dtv Klett-Cotta.
Görnitz A (2002). Ratgeber-Literatur zu depressiven Erkrankungen: Beschreibung des aktuellen Bücherangebotes, empirische Untersuchung zu genutzten Infor- mationsquellen, krankheitsbezogenem Wissen und Erwartungen von Betroffe- nen, deren Angehörigen und professionellen Helfern im Vergleich. Dissertation an der TU München.
Grawe K, Donati R & Bernauer F (1994). Psychotherapie im Wandel. Göttingen: Hofgrefe.
Grawe K (1995). Grundriss einer Allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 40, 130-145.
Grawe K (2005). Wie kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksa- mer werden? Psychotherapeutenjournal, 5, 4-11.
Hautzinger M, Depression. In Jürgen Margraf (Hrsg.) (2000). Lehrbuch der Verhal- tenstherapie (2. Aufl., S 123-135). Berlin: Springer-Verlag.
Hautzinger M (1997). Kognitive Verhaltenstherapie bei Depression (4. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Hautzinger M (1998). Depression. Göttingen: Hofgrefe.
Hayes S G, Strosahl K & Wilson K G (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behaviour change. NY: Guilford Press.
Hoffmann N (2005). Psychotherapie, Verhaltenstherapie und Therapietechniken. In M. Linden & M. Hautzinger (Hrsg.). Verhaltenstherapiemanual (5. Aufl.). Hei- delberg: Springer.
Kanfer F H (2005). Das weite Feld der Psychotherapie: Ein Blick in die Landschaft. In F H Kanfer & D Schmelzer (2. Aufl.) Wegweiser Verhaltenstherapie: Psycho- therapie als Chance. Berlin: Springer
Kraemer S (2002). Falldarstellung einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen De- pressionsbehandlung. In Kraemer S & Huber D (Hrsg.). Psychotherapie für die Praxis: Depression. Aktuelle psychodynamische und verhaltenstherapeutische Konzepte (S. 91-113). München: CIP-Medien.
Laux G & Möller H J (2008). Memorix Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.
Margraf J (Hrsg., 2000). Lehrbuch der Verhaltenstherapie (2. Aufl.). Berlin: Sprin- ger-Verlag.
Meyer A E, Richter R, Grawe K, von Schulenburg J M & Schulte D (1991). For-
schungsgutachten zu Fragen eines Psychotherapeutengesetzes. Bonn: Gesundheitsministerium.
Nathan P E & Gorman J M (Eds., 2002). A guide to treatments that work (2nd Ed.). NY: Oxford University Press.
Pitschel-Walz G, Bäuml J & Kissling W (2003). Psychoedukation Depressionen. Manual zur Leitung von Patienten- und Angehörigengruppen. München, Jena: Urban & Fischer.
Preuss, Ch (1986). Zur Beurteilung von Prozess und Ergebnis von Psychotherapie aus der subjektiven Sicht von Klienten. Diplomarbeit: Universität Bamberg.
Reinecker H (2005). Grundlagen der Verhaltenstherapie (3. Aufl.). Weinheim, Ba- sel: Beltz.
Schaenburg H & Zimmer F T (2005). Depression. In: Senf W & Broda M (Hrsg.). Praxis der Psychotherapie (3. Aufl., S. 120-132). Stuttgart: Thieme.
Senf W & Broda M (2005). Was ist Psychotherapie? In W. Senf & M. Broda (Hrsg.). Praxis der Psychotherapie: Ein integratives Lehrbuch (3. Aufl., S. 2-9). Stutt- gart: Thieme.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Psychotherapie und welche Formen der Hilfe gibt es?
Psychotherapie ist eine "Seelenheilkunde", die sich der geistigen Beeinflussung bedient, um die Genesung zu fördern. Sie basiert auf nonverbaler und verbaler Kommunikation und bezieht sich auf das Denken, Erleben, Fühlen und Verhalten von Menschen. Neben der kognitiven Verhaltenstherapie gibt es weitere Zweige der Psychotherapie und Formen von Hilfsangeboten, wie Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, Systemtherapie, Hypnotherapie und viele andere.
Was ist Verhaltenstherapie und wie hat sie sich entwickelt?
Verhaltenstherapie ist ein Ansatz zur Beschreibung, Erklärung und Veränderung menschlichen Leidens. Sie hat ihre Ursprünge in der psychologischen Grundlagenforschung der 1950er Jahre und basiert auf Lern- und Verhaltenstheorien. Ursprünglich behavioristisch, wurden später Aspekte der Gedanken und Gefühle integriert. Die aktuelle Verhaltenstherapie betrachtet Verhalten, Gefühle und Gedanken als erlernt und somit veränderbar. Sie baut auf einem bio-psycho-sozialen Verhaltensbegriff auf.
Wie wirksam ist Verhaltenstherapie?
Die Wirksamkeit vieler psychotherapeutischer Methoden, einschließlich der Verhaltenstherapie, ist bei einigen psychischen Störungen belegt. Wesentliche Wirkfaktoren sind die Beziehung zwischen Therapeut und Patient (empathisches Zuhören, Akzeptanz, Verständnis, Vertrauen), die Aktivierung von Ressourcen und Problemen, das Erlangen von Einsicht und Selbsterkenntnis sowie die aktive Bewältigung von Problemstellungen.
Was ist kognitiv-behaviorale Einzeltherapie bei depressiven Störungen?
Die kognitiv-behaviorale Einzeltherapie ist eine Form der Psychotherapie, die sich als wirksam bei der Behandlung von depressiven Störungen erwiesen hat. Sie zielt darauf ab, dysfunktionale Gedankenstrukturen und Verhaltensmuster zu korrigieren, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Depression verantwortlich sind. Sie beinhaltet u.a. die Steigerung der Aktivität, die Förderung instrumenteller Fertigkeiten und kognitive Therapiemethoden.
Wie sieht das Krankheitsbild einer Depression aus?
Typische Symptome einer Depression sind Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit,Interesseverlust, Hoffnungslosigkeit, Antriebsmangel, häufig Ängstlichkeit, körperliches Unwohlsein, erhöhte Ermüdbarkeit, Verlust von Interesse an fast allen Aktivitäten, Mangel an Reagibilität auf üblicherweise angenehme Reize, Morgentief, frühmorgendliches Erwachen und erhebliche somatische Symptome wie z. B. Gewichtsverlust. Häufig sind auch Suizidgedanken oder -Handlungen zu finden. Auch kognitive Verzerrungen sind typisch.
Wie entsteht eine Depression?
Die Entstehung einer depressiven Erkrankung wird in der Verhaltenstherapie als multifaktoriell determiniert betrachtet. Ein Erklärungsmodell ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell, das Neurobiologie, Persönlichkeitsstruktur und Stressoren in der Umwelt berücksichtigt. Risikofaktoren können vorangegangene depressive Erkrankungen, weibliches Geschlecht, frühe Verlusterfahrungen, Missbrauch oder Substanzabhängigkeit sein.
Welche Schritte werden bei der kognitiv-behavioralen Therapie von Depressionen unternommen?
Die Behandlung umfasst in der Regel die Vermittlung des therapeutischen Modells, Steigerung der Aktivität des Patienten, die Förderung instrumenteller Fertigkeiten, und kognitive Therapiemethoden zur Korrektur verzerrter Wahrnehmungs- und Denkfehler.
Was ist das Ziel der Falldarstellung einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Depressionsbehandlung (Kraemer, 2002)?
Die Falldarstellung von Kraemer (2002) illustriert die Anwendung kognitiv-behavioraler Therapie bei einer depressiven Patientin. Sie umfasst Anamnese, Makro- und Mikroebene der Analyse, Festlegung von Behandlungszielen und -planung, Psychoedukation, die Verwendung von Videosequenzen zur Analyse und Bearbeitung von Problemen sowie den Einsatz von Fragebögen zur Messung von Veränderungen.
Was ist Psychoedukation?
Psychoedukation ist eine zielorientierte und strukturierte Vermittlung relevanter Informationen an Patienten, kombiniert mit den psychotherapeutischen Wirkfaktoren einer Gruppentherapie. Sie dient der Aufklärung über die Krankheit, der emotionalen Entlastung und der Steigerung der Compliance (z.B. Medikamenteneinnahme) und der Lebensqualität.
Welche Fragebögen werden zur objektiveren Messung eingesetzt?
Zur objektiveren Messung der Wirksamkeit der Therapie können Fragebögen eingesetzt werden, wie z. B. Symptomlisten, Fragebögen zu Kontrollüberzeugungen (IPC), Fragebögen zur Selbstaufmerksamkeit (SAM) und Fragebögen irrationaler Einstellungen.
- Citation du texte
- Sandra Waeldin (Auteur), 2008, Kognitiv-behavioraler Therapieansatz bei Depression anhand einer Falldarstellung von Sybille Kraemer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275896