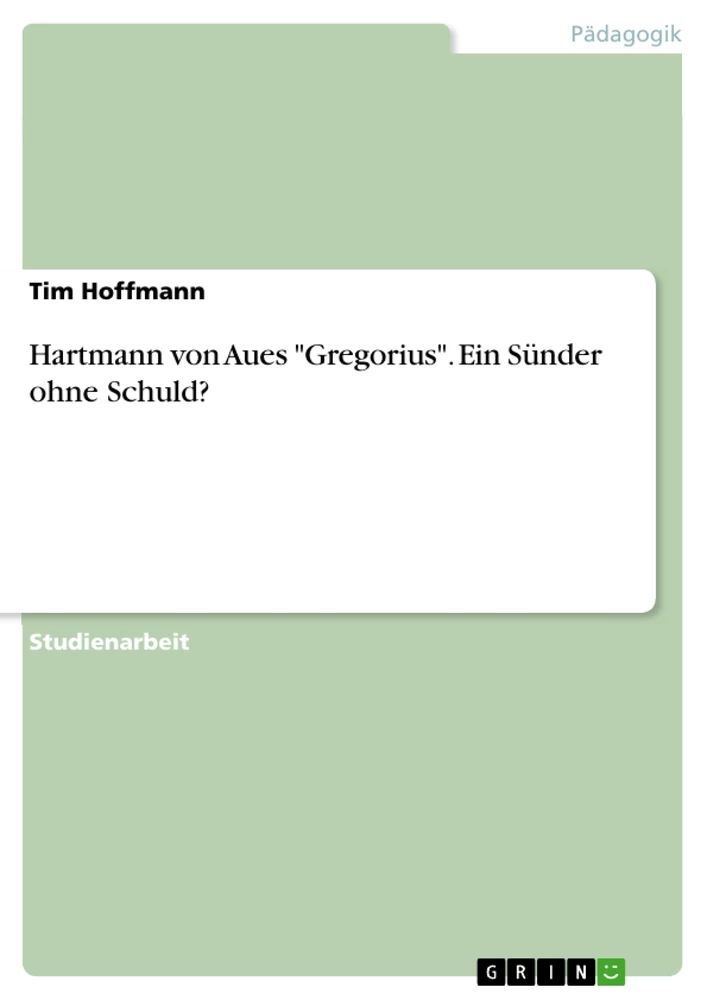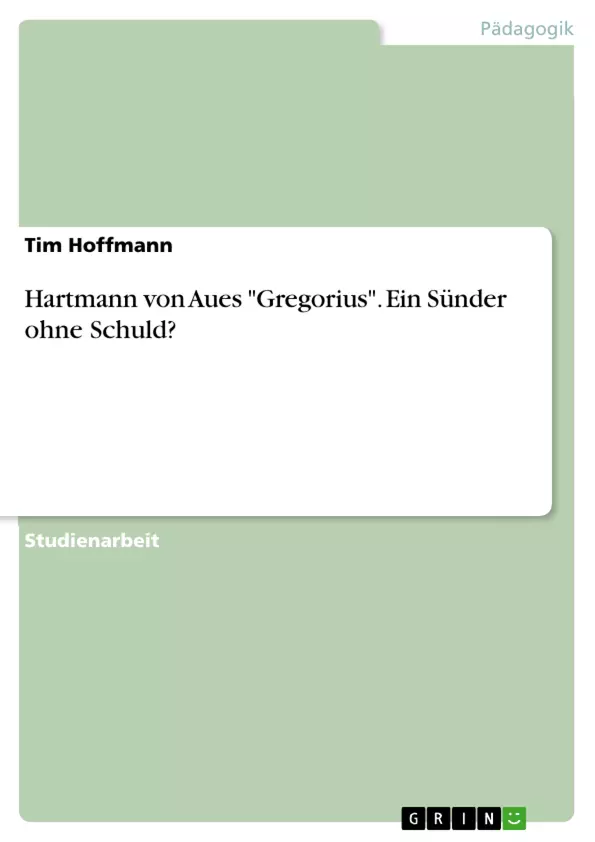In vorliegender Hausarbeit möchte der Verfasser auf die Brisanz und Aktualität der Schuldfrage in der Reimpaardichtung "Gregorius" von Hartmann von Aue hinweisen, indem er der Frage nachkommt, inwieweit Gregorius selbst Schuld an seinen und den ihm anhaftenden Verfehlungen trägt. Dabei soll ein Bild Gregorius’ gezeichnet werden, das ihn als Sünder ohne eigene Schuld darstellt, wie bereits der Autor selbst in dessen Bezeichnung eines „guoten sündære“ anklingen lässt.
Die Thematik erscheint dem Verfasser besonders interessant vor dem Hintergrund eines Vergleiches der heutigen Gesellschaft, in der immer mehr Menschen der Kirche den Rücken kehren und die Begriffe Schuld und Buße aus dem alltäglichen Sprachgebrauch nahezu verschwunden sind, mit jener aus der Zeit Hartmanns von Aue, die geprägt war von einer gottesfürchtigen Weltanschauung und einer vermeintlich engeren und strikteren Kontrolle durch die Instanz der Kirche und ihrer geistlichen Vertreter. So nehmen heutzutage immer weniger Christen die Beichte als Sakrament und reflektiertes Bekenntnis zur eigenen Schuld in Anspruch, denn die Kategorie der Sünde fehlt in der öffentlichen Sprache. Thomas Halik, Psychotherapeut und Priester, behauptet: „Die Sünde ist etwas Lächerliches geworden.“ Das zeigt, welche Aktualität und Parallelität in Hartmanns Gregorius stecken und, wie wichtig auch heute noch die Beschäftigung mit der Frage nach der eigenen Schuld ist.
So ist es das Ziel dieser Arbeit, Gregorius als unverschuldeten aber dennoch reuigen Sünder darzustellen, indem seine vermeintlichen und tatsächlichen Sünden unter Zuhilfenahme des Textes erklärt werden und die fromme Aufrichtigkeit seiner Reue benannt wird. Die Erklärung und Auflösung des Paradoxons des Sünders ohne Schuld sind dabei von entscheidender Bedeutung. Ferner wird davon ausgegangen, dass Gregorius sich selbst als größten Sünder seiner Zeit betrachtet, obwohl die Wahrnehmung seiner Situation konträr zu einer heutigen Perspektive ist.
Zu Beginn der Untersuchung nennt der Verfasser einige Arbeitsdefinitionen, deren teilweise widersprüchliche Aussagen in die Analyse der Schuldfrage einfließen. Zusätzlich wird die kirchliche Doktrin des Mittelalters in diese Überlegungen miteinbezogen. In Kapitel 3 werden darauf die konkreten Vergehen Gregorius’ chronologisch aufgezählt und bewertet, bevor in Kapitel 4 Gregorius’ Ansichten dargelegt und in Kapitel 5 die Stationen seiner Buße vor dem Hintergrund seines Gottesbildes betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Etymologische Definitionen
- Schuld
- Sünde
- Theologische Definitionen
- Schuld
- Sünde
- Normen kirchlicher und gesellschaftlicher Doktrin
- Etymologische Definitionen
- Die Sünden des Gregorius'
- Gregorius' Abstammung
- Abkehr vom klösterlichen Leben und Ergreifen der Ritterschaft
- Die Heirat mit seiner Mutter
- Gregorius' Zweifel an Gottes Plan
- Gregorius' Sicht auf seine Sündenlast
- Die Buße des Gregorius'
- Das klösterliche Leben
- Die Bedeutung seiner Tafel
- Die Felseninsel
- Das Papsttum als seine Erlösung
- Die Vorzeichnung seines Weges durch Gott
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage der Schuld in HARTMANNS VON AUEs Reimpaardichtung Gregorius. Sie untersucht, inwieweit Gregorius selbst für seine Verfehlungen verantwortlich ist und zeichnet ein Bild von ihm als Sünder ohne eigene Schuld. Die Arbeit analysiert die vermeintlichen und tatsächlichen Sünden Gregorius' und beleuchtet die Aufrichtigkeit seiner Reue. Sie zielt darauf ab, das Paradoxon des Sünders ohne Schuld zu erklären und zu lösen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Gregorius sich selbst als größten Sünder seiner Zeit betrachtet, obwohl seine Situation aus heutiger Perspektive anders bewertet werden könnte.
- Die Schuldfrage in HARTMANNS VON AUEs Gregorius
- Gregorius als Sünder ohne eigene Schuld
- Die Analyse der vermeintlichen und tatsächlichen Sünden Gregorius'
- Die Aufrichtigkeit der Reue Gregorius'
- Das Paradoxon des Sünders ohne Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Schuldfrage in HARTMANNS VON AUEs Gregorius ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Aktualität der Schuldfrage im Vergleich zur heutigen Gesellschaft und der Zeit HARTMANNS VON AUE.
Das zweite Kapitel definiert die Begriffe Schuld und Sünde aus etymologischer und theologischer Sicht. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Schuldfrage aufgezeigt, die durch Gregorius und die heutige Gesellschaft vertreten werden.
Kapitel 3 listet die konkreten Vergehen Gregorius' chronologisch auf und bewertet sie. Es werden seine Abstammung, seine Abkehr vom klösterlichen Leben, seine Heirat mit seiner Mutter und seine Zweifel an Gottes Plan beleuchtet.
Kapitel 4 legt Gregorius' Ansichten über seine Sündenlast dar. Es wird untersucht, wie er seine Situation wahrnimmt und welche Bedeutung er seinen Verfehlungen zuschreibt.
Kapitel 5 betrachtet die Stationen der Buße Gregorius' vor dem Hintergrund seines Gottesbildes. Es werden sein klösterliches Leben, die Bedeutung seiner Tafel, die Felseninsel und das Papsttum als seine Erlösung analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schuldfrage, die Sünde, die Reue, das Gottesbild, die kirchliche Doktrin, die mittelalterliche Gesellschaft, HARTMANN VON AUE, Gregorius, die Reimpaardichtung und die literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Gregorius als „guoter sündære“ bezeichnet?
Dieser Begriff beschreibt das Paradoxon eines Menschen, der zwar schwere Sünden begeht (wie Inzest), dies jedoch ohne böse Absicht oder Wissen tut und durch tiefe Reue nach Erlösung strebt.
Welche Rolle spielt die Herkunft für Gregorius' Schicksal?
Gregorius stammt aus einer inzestuösen Verbindung seiner Eltern, was im Mittelalter bereits als eine Form von vorbestimmter Sündhaftigkeit oder Makel angesehen wurde.
Was sind die zentralen Sünden des Gregorius?
Dazu gehören seine sündhafte Abstammung, die Abkehr vom klösterlichen Leben zugunsten der Ritterschaft und die unbewusste Heirat mit seiner eigenen Mutter.
Wie vollzieht Gregorius seine Buße?
Seine Buße führt ihn über Jahre der Isolation auf eine einsame Felseninsel, wo er durch extremes Büßertum seine Schuld abträgt, bis er schließlich zum Papst gewählt wird.
Wie unterscheidet sich der mittelalterliche Schuldbegriff von heute?
Im Mittelalter war die gottesfürchtige Weltanschauung und die Kontrolle durch die Kirche prägend, während heute Begriffe wie Sünde und Buße weitgehend aus dem Alltag verschwunden sind.
- Quote paper
- Tim Hoffmann (Author), 2014, Hartmann von Aues "Gregorius". Ein Sünder ohne Schuld?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275954