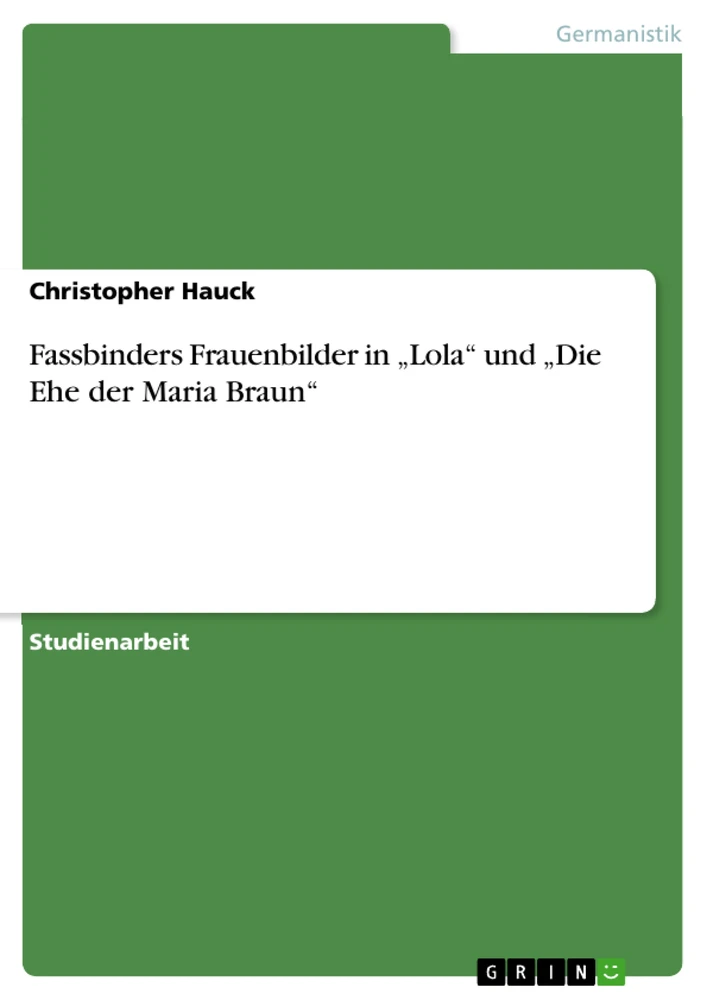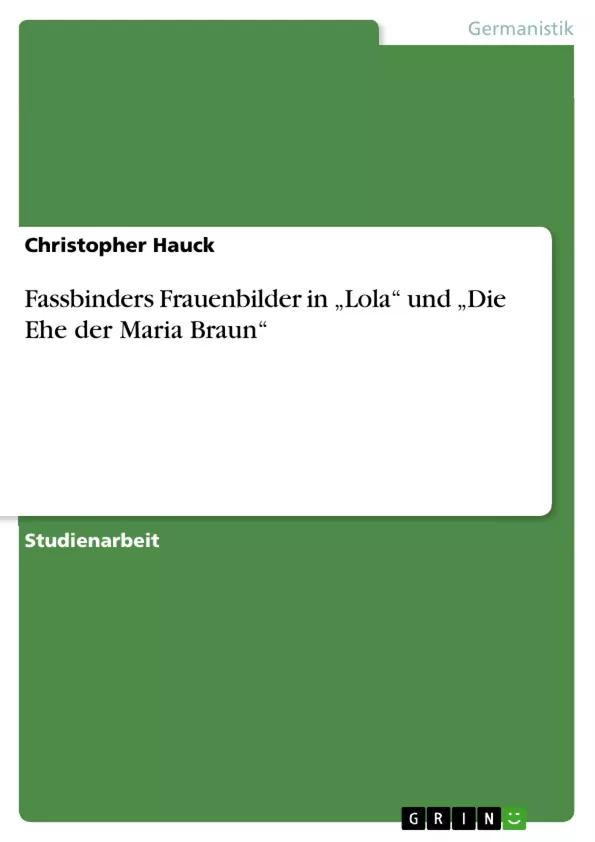„Ja, das möchte ich gern. Mein Problem ist nur, dass sie mich nicht richtig mitmachen lassen.“1 So äußert sich die Figur Lola in dem gleichnamigen Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1981 und scheint für den Zuschauer nicht nur auf die im Film gestellte Frage geantwortet zu haben, sondern vielmehr die Lage der Frauen im Nachkriegsdeutschland zugespitzt und mit einem satirischen und leicht verzweifelten Unterton zu beschreiben. Neben Lola gab es auch zwei Jahre zuvor in Fassbinders Film „Die Ehe der Maria Braun“ eine weibliche Protagonistin, welche stets ihren Weg ging, zur Erreichung ihrer Ziele alles tat und dabei nie die Marionette eines Mannes wurde. Zwei Filme, zwei Frauenbilder – welches entsprach am ehesten der Wirklichkeit der Nachkriegsjahre, in welchen beide Filme spielen?
Zum Ende des zweiten Weltkriegs wurden immer mehr deutsche Männer einberufen und hinterließen neben ihren Familien oftmals auch ihre Arbeitsplätze, welche gerade in der Rüstungsindustrie schnellstmöglich wieder besetzt werden mussten. So musste die nationalsozialistische Regierung von ihrem über Jahre propagiertem Bild der Frau als Hausfrau und Mutter zumindest teilweise abweichen und versuchen, die Frauen für die Erwerbstätigkeit zu gewinnen.2 Nach dem zweiten Weltkrieg waren viele der an die Front geschickten Männer tot oder in Kriegsgefangenschaft und die (Ehe-)Frauen mussten allein für ihren Lebensunterhalt sorgen und oftmals parallel ihre Kinder erziehen und versorgen.
Um die Eingangs formulierte Frage zu klären, werden die beiden Fassbinder-Filme im folgenden daraufhin untersucht, ob sich das jeweils dargestellte Frauenbild, sowohl im Hinblick auf die Protagonistin als auch im Blick auf die Frauen in den Nebenrollen im Vergleich mit zeitgenössischen Quellen aus den Nachkriegsjahren als realistisch beurteilen lässt. Die weiblichen Nebenrollen sind in beiden Filmen besonders zu beachten, da sie in ihrem Handeln im Regelfall stark von der Protagonistin abweichen und deren Handeln und Lebensweise somit auffällig kontrastieren. Hierdurch tritt die Intention des Regisseurs, die Situation, bzw. aus seiner Sicht die Missstände, der restaurativen Phase aufzuzeigen hervor. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass beide Filme durchaus satirische Elemente enthalten, welche allerdings dem Aufzeigen von Missständen in der damaligen Gesellschaft dienlich sind und somit für den Abgleich mit historischen Quellentexten nützlich sein können.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Lola“
- 3. Die Ehe der Maria Braun
- 4. Die Nachkriegsgesellschaft
- 5. Fazit / Fassbinders Frauenbilder und die gesellschaftliche Realität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frauenbilder in Rainer Werner Fassbinders Filmen „Lola“ und „Die Ehe der Maria Braun“ im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Ziel ist es, die im Film dargestellten Frauenfiguren mit zeitgenössischen Quellen zu vergleichen und die Realitätsnähe der Fassbinderschen Darstellung zu beurteilen. Dabei wird besonders auf die Kontraste zwischen den Protagonistinnen und den weiblichen Nebenfiguren geachtet.
- Das Frauenbild in Fassbinders Filmen „Lola“ und „Die Ehe der Maria Braun“
- Der Vergleich der Frauenfiguren mit zeitgenössischen Quellen aus der Nachkriegszeit
- Die Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Kritik Fassbinders
- Die Rolle von Materialismus und Doppelmoral in den Filmen
- Die Emanzipation der weiblichen Protagonistinnen im Kontext der gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Realitätsnähe der Frauenbilder in Fassbinders Filmen „Lola“ und „Die Ehe der Maria Braun“ im Kontext der Nachkriegsgesellschaft. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die methodische Vorgehensweise, die den Vergleich der filmischen Darstellung mit zeitgenössischen Quellen umfasst. Die Bedeutung der weiblichen Nebenrollen als Kontrastfiguren zu den Protagonistinnen wird hervorgehoben, um Fassbinders Gesellschaftskritik zu beleuchten.
2. „Lola“: Dieser Kapitelzusammenfassung analysiert Fassbinders Darstellung der weiblichen Figuren in seinem Film „Lola“. Die Protagonistin Lola, eine alleinerziehende Prostituierte, wird als selbstbewusste und unabhängige Frau präsentiert, die sich nicht den Erwartungen der Gesellschaft unterwirft. Im Kontrast dazu stehen die anderen Frauen, die sich passiv den Männern unterordnen und deren Leben von Materialismus und Doppelmoral geprägt ist. Der Film kritisiert die gesellschaftlichen Zustände der Nachkriegszeit, in denen die Frauen oft als Objekte der Begierde und des materiellen Vorteils gesehen werden. Lolas letztendlich emanzipierte Rolle am Ende des Films stellt einen scharfen Kontrast zu den anderen weiblichen Charakteren dar und unterstreicht die Kritik Fassbinders an der bestehenden Gesellschaftsordnung.
3. Die Ehe der Maria Braun: Das Kapitel widmet sich der Analyse von „Die Ehe der Maria Braun“. Maria Braun wird als eine äußerst selbstbewusste und initiative Frau dargestellt, die ihr Leben eigenständig gestaltet und sich nicht von den Männern abhängig macht. Im Gegensatz dazu stehen die passiven weiblichen Nebenfiguren, wie Marias Mutter und Schwester, die sich den Umständen fügen. Marias beruflicher Aufstieg, trotz fehlender Ausbildung, demonstriert die Möglichkeit von weiblicher Selbstverwirklichung, die aber nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht. Der Kontrast zwischen Maria und anderen Frauen verdeutlicht die außergewöhnliche Natur der Protagonistin und die Kritik an der gängigen Rolle von Frauen in der Nachkriegsgesellschaft.
Schlüsselwörter
Rainer Werner Fassbinder, Frauenbilder, Nachkriegsdeutschland, „Lola“, „Die Ehe der Maria Braun“, Emanzipation, Materialismus, Doppelmoral, Gesellschaftskritik, Realitätsnähe, Selbstbewusstsein, Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Frauenbilder in Fassbinders Filmen "Lola" und "Die Ehe der Maria Braun"
Welche Filme werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Frauenbilder in Rainer Werner Fassbinders Filmen "Lola" und "Die Ehe der Maria Braun".
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Realitätsnähe der Frauenbilder in Fassbinders Filmen im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Es wird verglichen, wie die filmischen Darstellungen mit zeitgenössischen Quellen übereinstimmen.
Welche Aspekte der Filme werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der weiblichen Figuren, sowohl der Protagonistinnen (Lola und Maria Braun) als auch der weiblichen Nebenfiguren. Es werden Vergleiche mit zeitgenössischen Quellen aus der Nachkriegszeit gezogen, um die Realitätsnähe der Fassbinderschen Darstellung zu beurteilen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Themen Materialismus, Doppelmoral, Emanzipation und Gesellschaftskritik gewidmet.
Wie werden die Frauenfiguren in den Filmen dargestellt?
Lola wird als selbstbewusste und unabhängige alleinerziehende Prostituierte gezeigt, die sich den Erwartungen der Gesellschaft widersetzt. Maria Braun wird als äußerst selbstbewusste und initiative Frau dargestellt, die ihr Leben eigenständig gestaltet. Im Gegensatz dazu stehen die passiven weiblichen Nebenfiguren in beiden Filmen, die sich den Umständen fügen.
Welche Rolle spielt die Nachkriegsgesellschaft in der Analyse?
Die Nachkriegsgesellschaft bildet den Kontext für die Analyse der Frauenbilder. Die Arbeit untersucht, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse und Normen die Lebensbedingungen und die Möglichkeiten der weiblichen Figuren beeinflussen. Fassbinders Gesellschaftskritik wird im Hinblick auf die Darstellung der Frauenrollen beleuchtet.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz. Die filmischen Darstellungen der Frauenfiguren werden mit zeitgenössischen Quellen aus der Nachkriegszeit verglichen, um die Realitätsnähe der Fassbinderschen Darstellung zu beurteilen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Rainer Werner Fassbinder, Frauenbilder, Nachkriegsdeutschland, "Lola", "Die Ehe der Maria Braun", Emanzipation, Materialismus, Doppelmoral, Gesellschaftskritik, Realitätsnähe, Selbstbewusstsein, Abhängigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu "Lola" und "Die Ehe der Maria Braun", ein Kapitel zur Nachkriegsgesellschaft und ein Fazit, das Fassbinders Frauenbilder und die gesellschaftliche Realität zusammenfasst.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Realitätsnähe der Frauenbilder in Fassbinders Filmen im Kontext der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Es wird die Bedeutung von Fassbinders Gesellschaftskritik hervorgehoben.
- Quote paper
- Christopher Hauck (Author), 2014, Fassbinders Frauenbilder in „Lola“ und „Die Ehe der Maria Braun“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276047