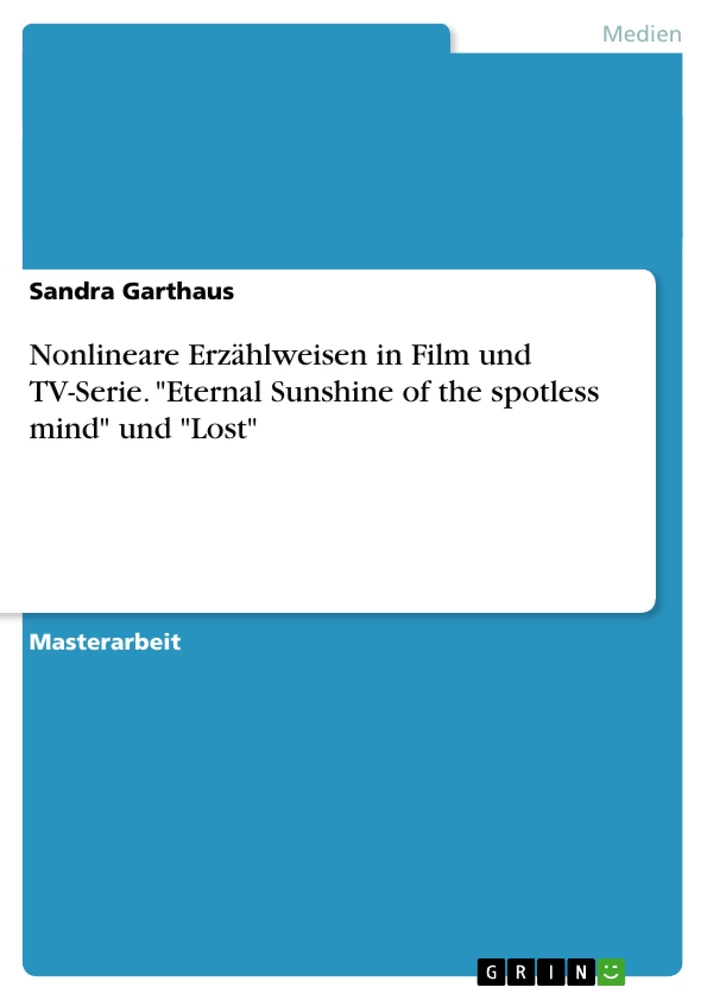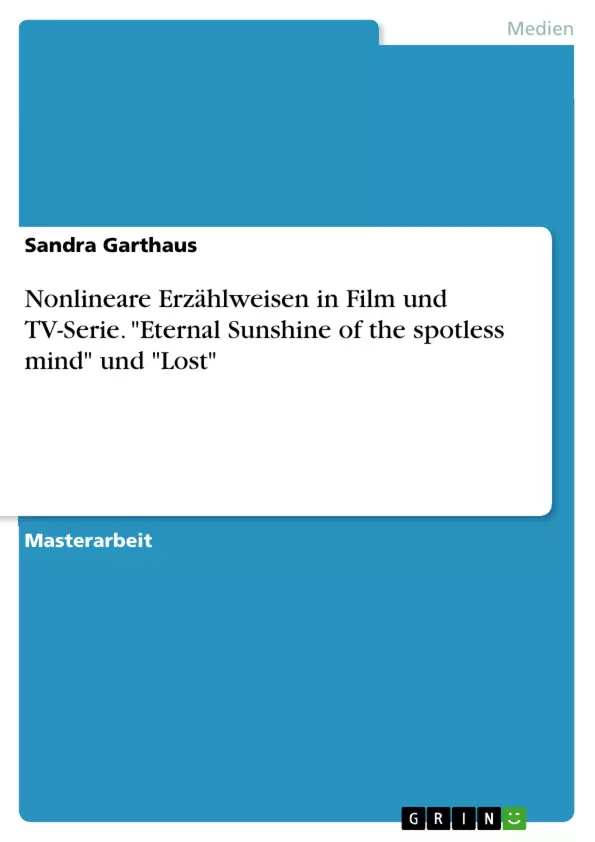„‘Wo soll man die Struktur der Erzählungen suchen? In den Erzählungen vermutlich‘“
(Roland Barthes nach Krützen 2006, 5).
Das Leben eines jeden Menschen folgt einer zeitlichen Struktur. Auf A folgt B und auf B
wiederum C. Es handelt sich um eine kausal-chronologische Ereigniskette, die unser
Zeitempfinden prägt. Wir leben in dieser zeitlichen Linearität und haben gelernt, linear
zu denken und zu kommunizieren. Regelmäßige, kontinuierliche Abfolgen beschreiben
das soziale Zeitmuster. Eine Manipulation dieser Zeitabfolge und ein Bewegen in der Zeit
sind für uns undenkbar. In der Denk- und Kommunikationsstruktur der Erzählung kann
man diese stringente kausale Abfolge jedoch auf unterschiedliche Weise durchbrechen.
Medien machen von der Grundtätigkeit des Menschen – dem Erzählen – Gebrauch. So
sind auch audiovisuelle Medien wie der Kinofilm und die Fernsehserie, die in den
kulturellen Alltag der Gesellschaft eingebettet sind, zeitliche Phänomene, indem sie in
einer Zeitspanne stattfinden und darin eine andere vermitteln. Sie bestehen in der Zeit
und sind in ihrer materiellen Entität der Geradlinigkeit verhaftet. Sie bergen ein großes
zeitästhetisches Potential, das immer mehr in experimenteller Weise genutzt und die
dramaturgische Entwicklung damit vorangetrieben wird. In den letzten Jahrzehnten
wurden vermehrt innovative Erzählstrukturen verwendet, wie z.B. das Echtzeit-
Verfahren der Fernsehserie 24 (USA 2001-heute, Jon Cassar et al.). Eine Besonderheit
der Entwicklung audiovisuellen Erzählens stellt jedoch das Durchbrechen der temporalen
Linearität dar. Seit den 1990er Jahren lässt sich eine neue Tendenz in der temporalen
Gestaltung filmischer Narration und damit eine Zunahme an Erzählstrukturen aufzeigen,
die als nonlinear zu charakterisieren ist. Dieses nicht lineare Erzählen wird in
den unterschiedlichsten Medien angewendet – so auch in Kinofilm und Fernsehserie,
deren Gemeinsamkeit die Audiovisualität ist und die in dieser Arbeit gegenübergestellt
werden.
Die These dieser Arbeit besagt, dass medienspezifische Differenzen Einfluss auf das zu
Vermittelnde nehmen, sodass sich spezielle Erzählformen entwickelt haben, die unterschiedliche
dramaturgische Gestaltungen zulassen. Ziel dieser Arbeit ist es, die medienspezifische
Umsetzung von Nonlinearität sowohl im Film, als auch in der TV-Serie
aufzuzeigen und in einem weiteren Schritt die Bedeutung dieser für die Rezeption
deutlich zu machen, da eine veränderte dramaturgische Gestaltung...
Inhaltsverzeichnis
- Aufblende
- Die zeitliche Dimension der Narration
- Audiovisualität als narrative Qualität
- Die dramaturgische Zeitstruktur
- Etablierte Zeitwechsel
- Nonlinearität
- Kognitive Verstehensprozesse
- Die dramaturgische Zeitstruktur
- Audiovisualität als narrative Qualität
- Spielfelder des Nonlinearen
- Filmisches Erzählen
- Serielles Erzählen
- ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
- Die Story
- Main-Story: Joel und Clementine
- Nebenhandlung: Lacuna
- Analyse der Zeitverhältnisse
- Nonlinearität durch Fragmentierung und Dramaturgiemix
- Multiple Ebenen durch Flashbacks
- Nonlinearität im Detail
- Innerdiegetische Orientierungspunkte
- Die Rezeption als temporale Odyssee
- Die Story
- Nonlinearität in Serie: LOST
- Der Story-Komplex
- LOST in Narration
- Narrative Komplexität
- LOST in Zeit und Raum
- Zeitverschiebungen durch temporale Rückgriffe
- Verwendung der zukünftigen Zeitebene
- 'Unstuck in time'
- Die alternative Zeitlinie
- Ebene des Unterbewusstseins
- Cues der Orientierung
- Vom Beobachter zum Analytiker: die LOST-Rezipienten
- Vergleichende Analyse
- Abblend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die medienspezifische Umsetzung von Nonlinearität in Film und Fernsehserie. Ziel ist es aufzuzeigen, wie medienspezifische Differenzen die Erzählformen beeinflussen und welche rezeptionsrelevanten Auswirkungen die veränderte dramaturgische Gestaltung mit sich bringt. Die Arbeit bewegt sich im Feld der Theorie des narrativen filmischen und televisuellen Erzählens.
- Analyse non-linearer Erzählstrukturen in Film und Fernsehen
- Vergleich der Umsetzung von Nonlinearität in Film (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) und Serie (LOST)
- Untersuchung der Bedeutung von Nonlinearität für die Rezeption
- Erörterung der kognitiven Prozesse beim Verständnis non-linearer Erzählungen
- Aufzeigen medienspezifischer Unterschiede im narrativen Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
Die zeitliche Dimension der Narration: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Analyse, indem es die zeitliche Struktur von Erzählungen im Allgemeinen und deren Manipulation in audiovisuellen Medien beleuchtet. Es werden die Konzepte der linearen und nicht-linearen Narration eingeführt und der Zusammenhang zwischen Narration und kognitiven Rezeptionsprozessen erörtert. Die Arbeit etabliert die theoretischen Rahmenbedingungen, die für das Verständnis der folgenden Kapitel unerlässlich sind, mit besonderem Fokus auf die audiovisuelle Gestaltung und die damit verbundenen Möglichkeiten der Zeitmanipulation.
Spielfelder des Nonlinearen: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen den spezifischen Möglichkeiten nicht-linearer Erzählweisen im Film und in der Fernsehserie. Es werden die Unterschiede in der Struktur, der Erzählweise und der Rezeption von Filmen und Serien im Bezug auf nicht-lineare Erzählstrukturen herausgearbeitet. Die jeweiligen medialen Eigenheiten und Einschränkungen für das Erzählen werden beleuchtet und bilden eine wichtige Grundlage für die anschließende Analyse von Eternal Sunshine of the Spotless Mind und Lost.
ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND: Der Film wird im Detail analysiert, wobei die nicht-lineare Struktur der Erzählung im Vordergrund steht. Die Kapitel untersuchen die Verflechtung von verschiedenen Zeitebenen und die Auswirkungen auf das Verständnis der Handlung. Es wird die Frage beleuchtet, wie die Fragmentierung der Erzählung und der Mix verschiedener dramaturgischer Elemente die Rezeption beeinflussen und das Verständnis von Beziehungen und Gefühlen zwischen den Protagonisten Joel und Clementine formen. Die Analyse der innerdiegetischen Orientierungspunkte im Film ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis der komplexen narrativen Struktur.
Nonlinearität in Serie: LOST: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird hier die Fernsehserie Lost im Hinblick auf ihre nicht-lineare Erzählstruktur untersucht. Der Fokus liegt auf der komplexen Interweaving verschiedener Zeitebenen und deren Einfluss auf das Verständnis der Handlung und der Charakterentwicklung. Die Analyse konzentriert sich auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der seriellen Form für die Darstellung der nicht-linearen Narration ergeben. Es werden die verschiedenen Zeitlinien und ihre Interaktion, die Rolle von Rückblenden, sowie die Auswirkungen auf die Rezeption und das Engagement der Zuschauer detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Nonlinearität, Erzählstruktur, Film, Fernsehserie, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Lost, Rezeption, Kognition, Zeit, Dramaturgie, Audiovisualität, Narrative Komplexität, Filmanalyse, Serielles Erzählen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse nicht-linearer Erzählstrukturen in Film und Fernsehen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die medienspezifische Umsetzung von Nonlinearität in Film und Fernsehserie. Im Fokus steht, wie medienspezifische Unterschiede die Erzählformen beeinflussen und welche Auswirkungen die veränderte dramaturgische Gestaltung auf die Rezeption hat. Die Arbeit bewegt sich im Feld der Theorie des narrativen filmischen und televisuellen Erzählens.
Welche Filme und Serien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert den Film "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" und die Fernsehserie "Lost", um die Umsetzung von Nonlinearität in diesen Medien zu vergleichen und zu untersuchen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse nicht-linearer Erzählstrukturen in Film und Fernsehen, Vergleich der Umsetzung von Nonlinearität in Film und Serie, Untersuchung der Bedeutung von Nonlinearität für die Rezeption, Erörterung der kognitiven Prozesse beim Verständnis non-linearer Erzählungen und Aufzeigen medienspezifischer Unterschiede im narrativen Erzählen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die die theoretischen Grundlagen der nicht-linearen Narration erläutern, die spezifischen Möglichkeiten im Film und der Serie untersuchen und schließlich die Fallstudien "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" und "Lost" detailliert analysieren. Ein Vergleich der beiden Analysen rundet die Arbeit ab.
Welche Aspekte der Nonlinearität werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die zeitliche Struktur der Erzählung, die Verwendung von Flashbacks, Fragmentierung, multiple Ebenen, die Interaktion verschiedener Zeitlinien und die Auswirkungen dieser Techniken auf das Verständnis der Handlung und die Rezeption durch den Zuschauer. Es wird auch die Rolle innerdiegetischer Orientierungspunkte beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die Rezeption für die Arbeit?
Die Rezeption non-linearer Erzählungen spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht, wie die kognitiven Prozesse beim Verstehen solcher Erzählungen funktionieren und wie die medienspezifische Gestaltung die Rezeption beeinflusst. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Handlung und der emotionalen Reaktion des Zuschauers.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nonlinearität, Erzählstruktur, Film, Fernsehserie, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Lost, Rezeption, Kognition, Zeit, Dramaturgie, Audiovisualität, Narrative Komplexität, Filmanalyse, Serielles Erzählen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: der zeitlichen Dimension der Narration (inkl. Audiovisualität und kognitiver Prozesse), Spielfeldern des Nonlinearen (Film vs. Serie), der detaillierten Analyse von "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", der Analyse der Nonlinearität in "Lost", und einer vergleichenden Analyse beider Fallstudien.
- Arbeit zitieren
- Sandra Garthaus (Autor:in), 2011, Nonlineare Erzählweisen in Film und TV-Serie. "Eternal Sunshine of the spotless mind" und "Lost", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276161