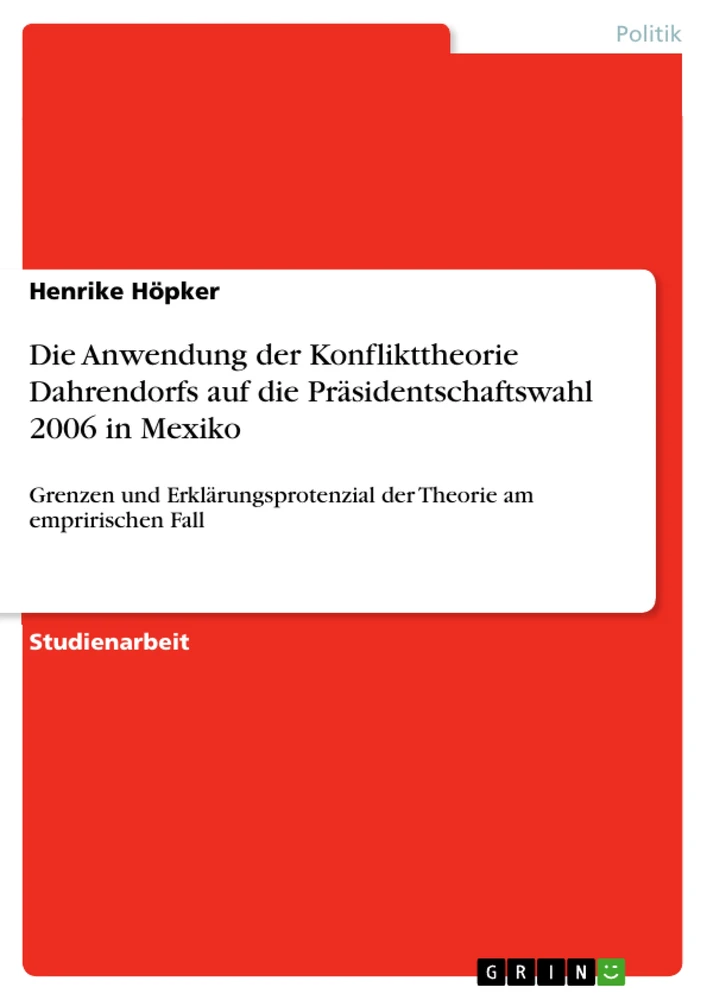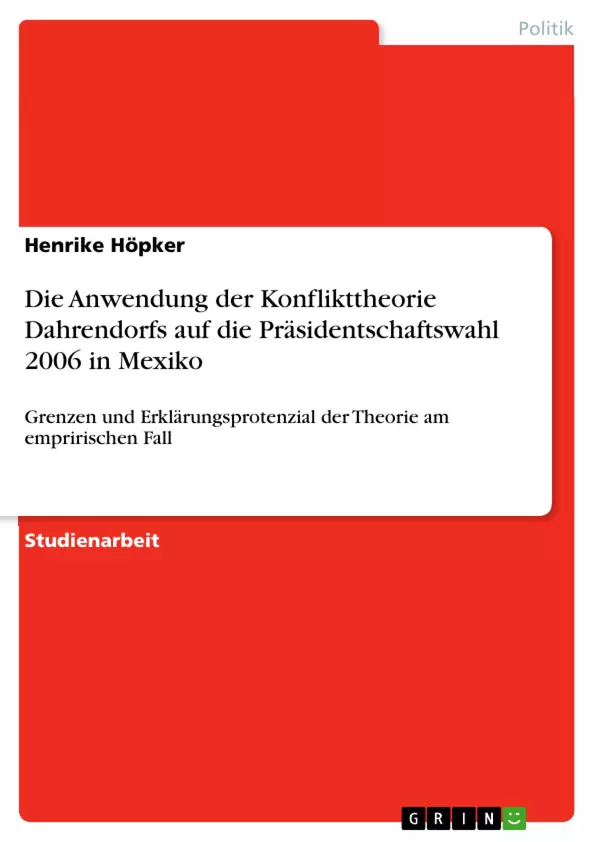Mexiko wurde über 70 Jahre lang von einer Partei regiert, bis dann im Jahr 2000, pünktlich zum Millenniumswechsel, ein Machtwechsel stattfand. Knapp gewann die PAN die Wahl und ein Regierungswechsel vollzog sich zum ersten Mal in Mexikos 2000 jähriger Geschichte friedlich. Doch wie sich zeigen sollte, war die Frage danach, wohin sich das Land entwickeln sollte, damit noch nicht endgültig gelöst. In Mexiko wird der Präsident alle sechs Jahre gewählt und kann nicht wiedergewählt werden, was jede Wahl aufs Neue interessant macht. Im Jahre 2006 dann äußerte sich die Wahl in erstaunlicher Intensität. Während 2000 die Entscheidung der Wähler hauptsächlich für oder gegen die alte Regierung war, so stellte sich die Auswahl 2006 weitaus komplexer da als zuvor. Dies lag zum einen da dran, dass die ehemalige Regierungspartei sich im Vorfeld erholt hatte und damit potenziell noch immer eine Alternative bot. Allerdings, wie zu zeigen sein wird, verspielte der Kandidat der PRI bereits in der Vorwahl seine Chancen auf den Wahlsieg. 2006 stand es um Mexiko wirtschaftlich gesehen weit besser als je zuvor: 2005 betrug die Inflation gerade mal 3,3 %, den geringsten Wert seit 1969 und die Ratingagentur Standart and Poor gab dem Land den geringsten Risikowert in seiner Geschichte. Dies wurde der Regierungspartei PAN zugerechnet, was sich positiv für diese auswirkte. Dagegen hatte die dritte Partei PRD einen beliebten und charismatischen Kandidaten aufgestellt, der vor allem in der Hauptstadt durch seine erfolgreiche Amtszeit als Bürgermeister äußerst beliebt war. Die Wahl blieb bis zum allerletzten Moment spannend und endete mit folgendem Ergebnis: Felipe Calderón Hinojosa von der Regierungspartei PAN gewann mit 0,58% gegen den Oppositionsführer Andrés Manuel Lopéz Obrador von der PRD.Dies führte zu wochenlangen massiven Protesten, der PAN wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Im Folgenden soll eine Analyse der Wahlvorgänge erfolgen. Hierfür wird zunächst ein Blick auf die Vorgeschichte des Landes geworfen, beginnend bei der mexikanischen Revolution. Dies ist notwendig, da die Ereignisse des Jahres 2006 nur im Zusammenhang mit der stark verzögerten Demokratisierung des Landes richtig einzuordnen sind. Anschließend werden die Ereignisse der Wahl 2006 genauer betrachtet und danach wird versucht, die Ereignisse mit dem Instrument der Konflikttheorie Dahrendorfs zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mexiko und die Wahlen des Jahres 2006
- Die Vorgeschichte
- Der Konflikt um die Wahl des Jahres 2006
- Der Wahlkampf
- Die Proteste gegen die Wahl
- Die Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf
- Grundlagen der Theorie
- Konflikt als Klassenkampf
- Die Konkretisierung der Theorie
- Das Konzept der Lebenschancen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die mexikanische Präsidentschaftswahl 2006 im Kontext der Geschichte des Landes und unter Anwendung der Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf. Die Analyse zielt darauf ab, die Grenzen und das Erklärungspotenzial dieser Theorie anhand des empirischen Falls zu untersuchen.
- Die Vorgeschichte der mexikanischen Politik und der Demokratisierungsprozess
- Die Wahl 2006 als Ausdruck gesellschaftlicher Konflikte
- Die Anwendung der Konflikttheorie Dahrendorfs auf den Wahlkampf und die Proteste
- Die Grenzen der Theorie in Bezug auf die Erklärung der Wahl 2006
- Die Bedeutung des empirischen Falls für die Weiterentwicklung der Konflikttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Wahl 2006 in Mexiko erläutert und die Relevanz der Anwendung der Konflikttheorie Dahrendorfs aufzeigt. Anschließend beleuchtet das erste Kapitel die Vorgeschichte des Landes, beginnend bei der mexikanischen Revolution und der Entstehung des autoritären Staates unter der Herrschaft der PRI. Dabei wird insbesondere auf die Entwicklung des politischen Systems und die Demokratisierungsprozesse in Mexiko eingegangen. Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse der Wahl 2006, wobei der Fokus auf den Wahlkampf, die Ergebnisse und die darauffolgenden Proteste liegt. Dieses Kapitel stellt den empirischen Fall dar, der im weiteren Verlauf der Arbeit mit der Konflikttheorie Dahrendorfs in Beziehung gesetzt wird. Das dritte Kapitel widmet sich der Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf und erläutert ihre wichtigsten Grundlagen, Konzepte und Anwendungsmöglichkeiten. Es wird gezeigt, wie die Theorie die Entstehung und Dynamik sozialer Konflikte erklärt und welche Faktoren in der mexikanischen Gesellschaft zur Entstehung von Konflikten beitragen können. Abschließend diskutiert das Fazit die Ergebnisse der Analyse und zieht Schlüsse für die Weiterentwicklung der Konflikttheorie und für das Verständnis der mexikanischen Politik.
Schlüsselwörter
Mexikanische Politik, Präsidentschaftswahl 2006, Konflikttheorie, Ralf Dahrendorf, Demokratisierung, Klassenkampf, Lebenschancen, Empirische Analyse, Wahlkampf, Proteste, Mexiko.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Konflikttheorie von Ralf Dahrendorf?
Dahrendorf sieht sozialen Wandel als Ergebnis von Konflikten zwischen herrschenden und beherrschten Gruppen, wobei das Konzept der "Lebenschancen" eine zentrale Rolle spielt.
Warum war die mexikanische Präsidentschaftswahl 2006 so umstritten?
Die Wahl endete mit einem extrem knappen Vorsprung von nur 0,58 % für Felipe Calderón (PAN) vor Andrés Manuel López Obrador (PRD), was zu massiven Protesten und Vorwürfen des Wahlbetrugs führte.
Wie lässt sich Dahrendorfs Theorie auf die Wahl 2006 anwenden?
Die Wahl kann als Klassenkampf oder Konflikt zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Lagern interpretiert werden, die um unterschiedliche Visionen von Lebenschancen und politischer Teilhabe rangen.
Welche Rolle spielte die verzögerte Demokratisierung Mexikos?
Nach über 70 Jahren Einparteienherrschaft der PRI war das politische System noch fragil, was die Intensität des Konflikts und das Misstrauen in die Institutionen im Jahr 2006 verstärkte.
Was sind die Grenzen von Dahrendorfs Theorie in diesem Fall?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Dahrendorfs eher binäres Modell (Herrschende vs. Beherrschte) die komplexe Drei-Parteien-Dynamik und die wirtschaftliche Stabilität Mexikos ausreichend erklären kann.
- Arbeit zitieren
- Henrike Höpker (Autor:in), 2012, Die Anwendung der Konflikttheorie Dahrendorfs auf die Präsidentschaftswahl 2006 in Mexiko, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276333