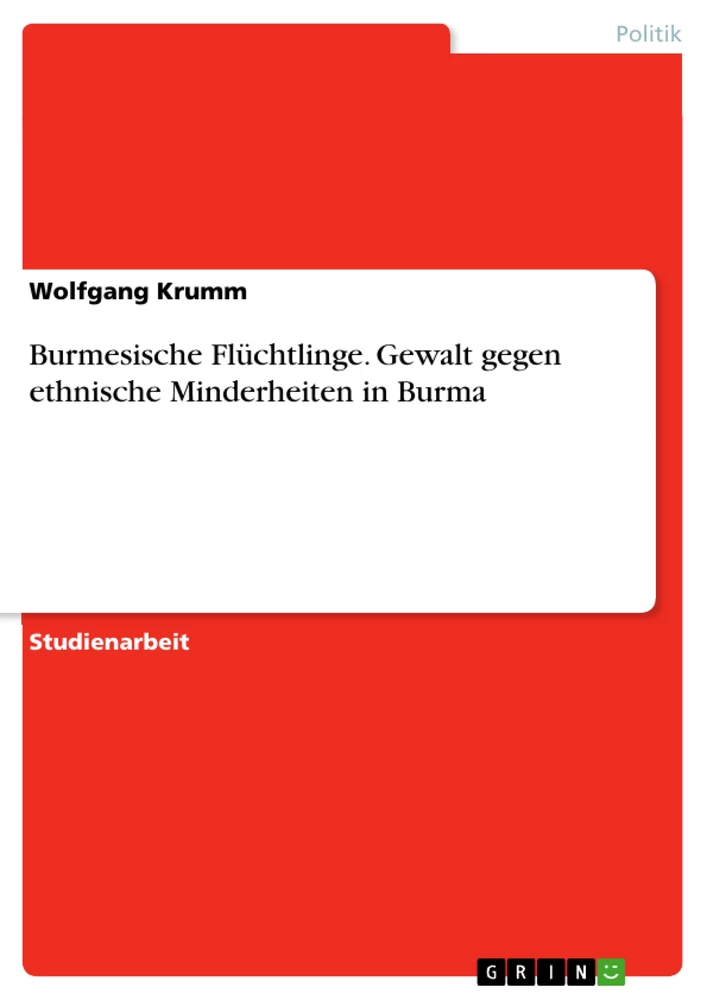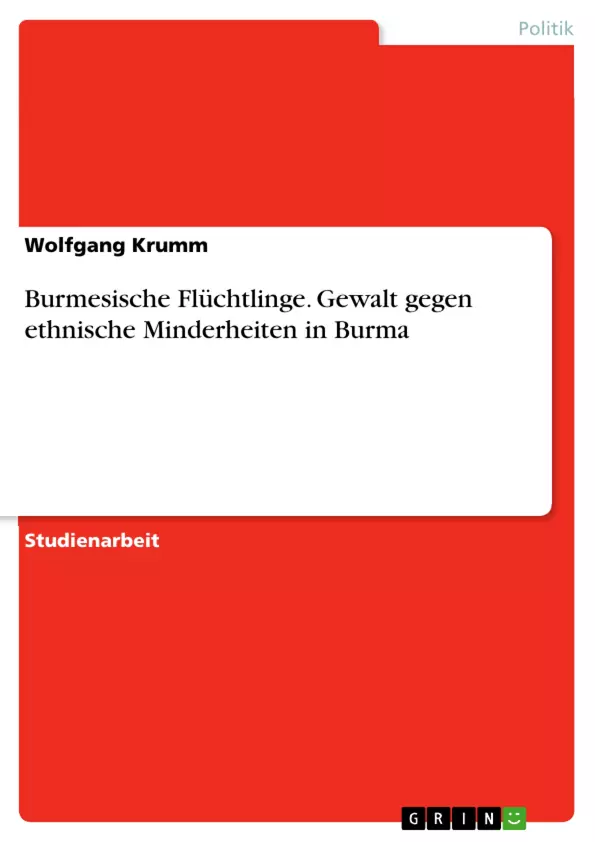Im Seminar „Anthropologie von Gewalt und Konflikt“ ging es darum, unterschiedliche Erscheinungsformen von Gewalt greifbar zu machen und sich auf verschiedenen Ebenen dieser Thematik zu nähern. Gewalt tritt als vielschichtiges Phänomen auf, welches im Seminar unter anderem auf folgende Art und Weise einer Analyse unterzogen wurde: Gewalt und Medien, Genozid und Holocaust, Staatsgewalt, Kontinuum von Gewalt, Staatsterror sowie alte und neue Kriege. Hinsichtlich Forschungen zu Gewalt sowie Untersuchungen zu Flüchtlingen gibt es bei diesen verwandten Themengebieten Überschneidungen.
In dieser Seminararbeit steht das Themenfeld Gewalt gegen ethnische Minderheiten und die daraus resultierende Flüchtlingsproblematik im Fokus der Betrachtung. Im Besonderen soll es dabei um in Burma lebende ethnische Minderheiten gehen, die zur Flucht aus ihren Dörfern gezwungen worden sind und nun Binnenflüchtlinge sind oder über die Grenze nach Thailand fliehen mussten. Dabei stehen die folgenden Fragen im Vordergrund: Welche Auswirkungen sind durch die Erfahrungen an Gewalt im alltäglichen Leben zu bemerken? Welche Formen gibt es, die Gewalt zu verarbeiten? Welcher Umgang findet mit den Tätern und den
Opfern statt? Die Hypothese hierzu lautet, dass die Gewalt zu
schwerwiegenden physischen und psychischen Beeinträchtigungen bei den Opfern führt und eine angemessene Behandlung der Flüchtlinge nicht gegeben ist, da oftmals die benötigten Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Ein Täter-Opfer-Umgang findet nicht statt, da die Täter in überwiegendem Maße straffrei bleiben.
- Citation du texte
- Wolfgang Krumm (Auteur), 2011, Burmesische Flüchtlinge. Gewalt gegen ethnische Minderheiten in Burma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276354