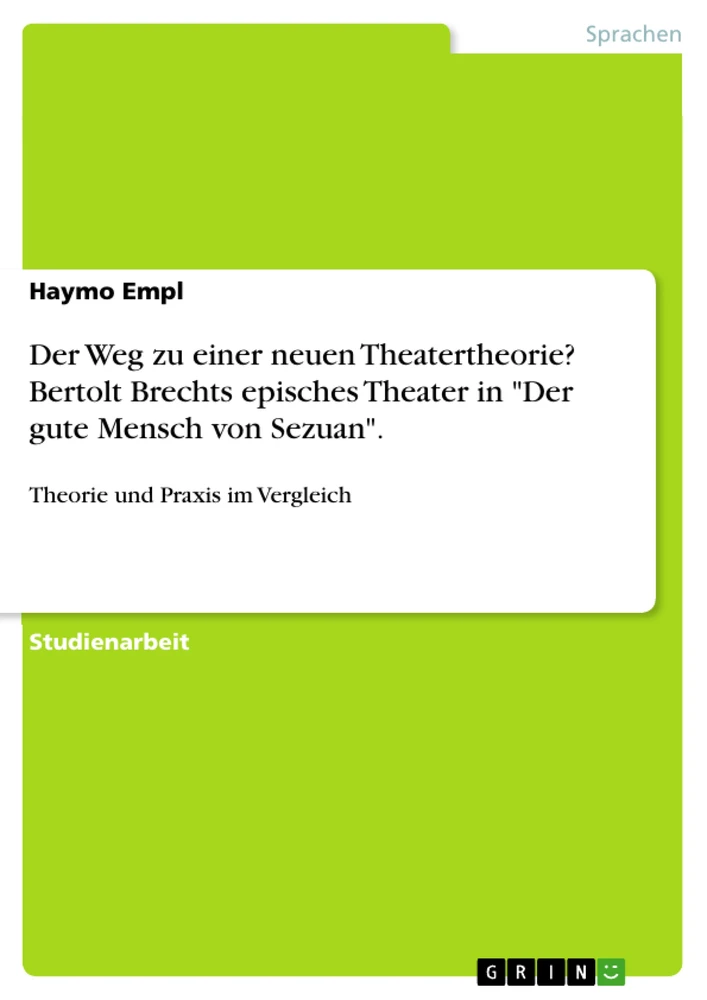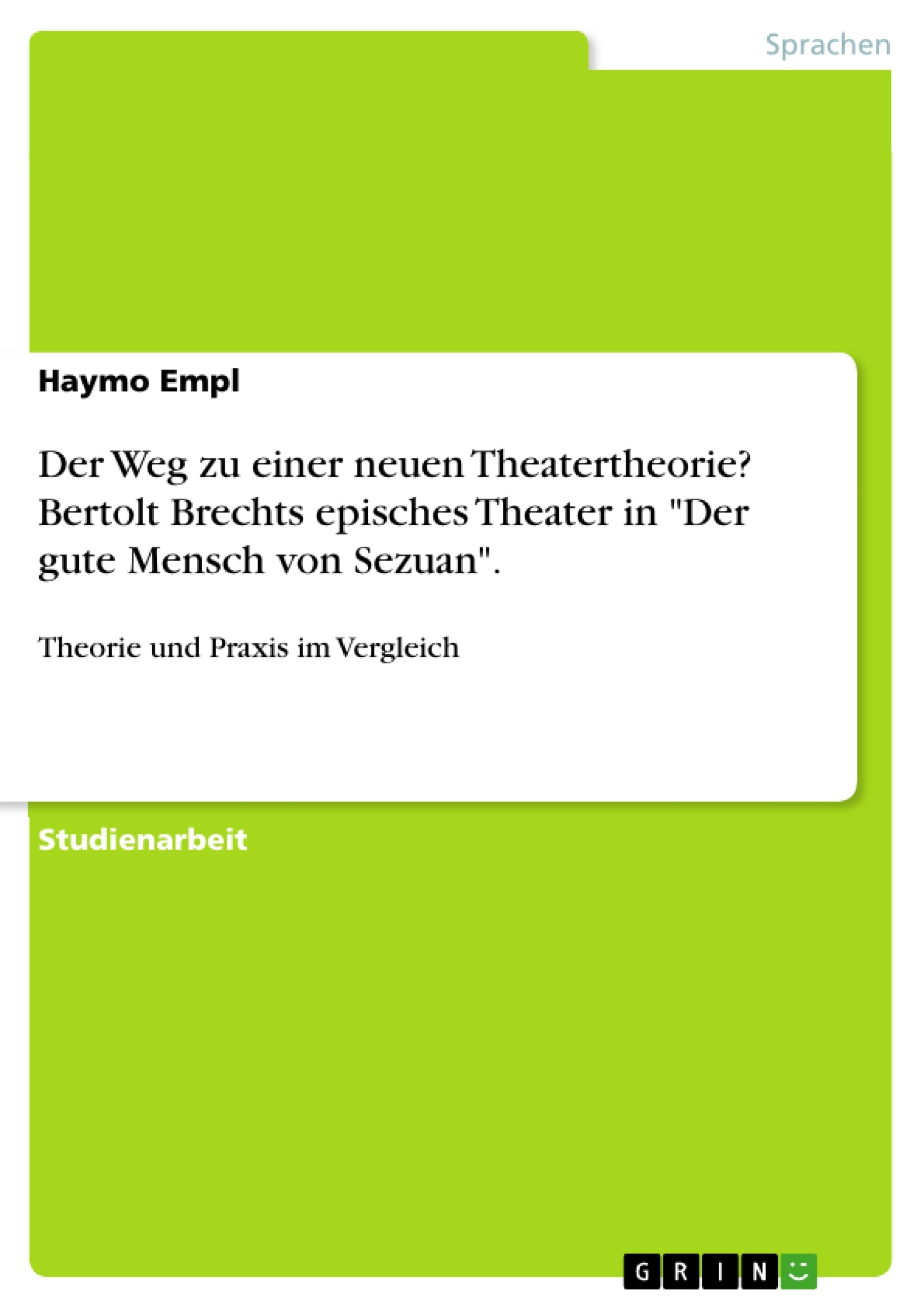In dieser Arbeit wird das Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ von Bertolt Brecht kritisch in Hinblick auf Brechts Theater & Dramentheorie analysiert.
Die Literatur und Forschung über Brecht im deutschsprachigen Raum ist unüberschaubar. Nichts, das über Brecht nicht geschrieben worden wäre, kein Theaterstück, kein Gedicht, kein Lied, welches nicht bis ins kleinste Detail bereits analysiert worden wäre. Die Literatur im deutschsprachigen Raum setzt sich – eine subjektive Feststellung nach Sichtung unzähliger Aufsätze, Essays und Büchern – weniger kritisch mit Brecht auseinander als die wesentlich weniger zahlreichen Schriften im angelsächsischen Raum. Daher wurden in dieser Arbeit auch Literatur aus den USA und England hinzugezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das epische Theater
- 2.1 Einflüsse auf Brechts episches Theater
- 3. Der gute Mensch von Sezuan: Theorie des epischen Theaters
- 3.1 Aufbau und Setting des Stücks
- 3.2 V-Effekt
- 3.3 Brechts Arbeit am Berliner Ensemble
- 4. «Der gute Mensch von Sezuan»: Theorie und Praxis im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Bertolt Brechts epischem Theater und analysiert das Stück «Der gute Mensch von Sezuan» als ein Musterbeispiel für die Theorie und Praxis dieses Theaterkonzepts. Die Arbeit untersucht die Einflüsse auf Brechts episches Theater, beleuchtet den Verfremdungseffekt und analysiert die Beziehung zwischen Theorie und Praxis anhand des Stücks und seiner Inszenierungen.
- Brechts episches Theater im Vergleich zu traditionellem Drama
- Der Verfremdungseffekt als zentrale Technik im epischen Theater
- Die Rolle des Berliner Ensembles in Brechts Theaterarbeit
- Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis im «Guten Menschen von Sezuan»
- Die Bedeutung des Stücks als Musterbeispiel für Brechts episches Theater
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des epischen Theaters und die Einflüsse auf Brechts Konzept. Kapitel drei analysiert «Der gute Mensch von Sezuan» als exemplarisches Stück für die Theorie des epischen Theaters. Es werden der Aufbau und das Setting des Stücks, der Verfremdungseffekt und Brechts Arbeit am Berliner Ensemble genauer betrachtet. Kapitel vier setzt sich mit der Beziehung zwischen Theorie und Praxis im «Guten Menschen von Sezuan» auseinander.
Schlüsselwörter
Episches Theater, Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Verfremdungseffekt, Berliner Ensemble, Theatertheorie, Theorie und Praxis, Dramaturgie, Gesellschaftskritik, Politik, Kunst und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „epische Theater“ von Bertolt Brecht?
Das epische Theater ist ein Theaterkonzept, das den Zuschauer nicht emotional mitreißen, sondern zum kritischen Nachdenken und Handeln anregen will. Es bricht mit den Regeln des aristotelischen Dramas.
Was bewirkt der Verfremdungseffekt (V-Effekt)?
Der V-Effekt soll bekannte Vorgänge fremd erscheinen lassen, um die kritische Distanz des Zuschauers zu wahren und gesellschaftliche Missstände als veränderbar darzustellen.
Warum ist „Der gute Mensch von Sezuan“ ein Musterbeispiel für Brechts Theorie?
Das Stück zeigt das Dilemma der Protagonistin Shen Te, die in einer kapitalistischen Welt nur überleben kann, indem sie eine harte Maske (Shui Ta) aufsetzt. Es illustriert die Unmöglichkeit, in einer schlechten Welt allein gut zu sein.
Welche Rolle spielte das Berliner Ensemble?
Das Berliner Ensemble war die Wirkungsstätte Brechts, an der er seine Theorien des epischen Theaters in die Regiepraxis umsetzte und weiterentwickelte.
Wie unterscheidet sich Brechts Ansatz von der angelsächsischen Forschung?
Die Arbeit stellt fest, dass sich die angelsächsische Literatur oft kritischer mit Brecht auseinandersetzt, während die deutschsprachige Forschung sehr detailliert, aber teils weniger distanziert ist.
Welche gesellschaftskritischen Themen behandelt das Stück?
Zentrale Themen sind die Ausbeutung im Kapitalismus, die Rolle der Moral in der Wirtschaft und die Frage, wie gesellschaftliche Strukturen das individuelle Handeln bestimmen.
- Quote paper
- Haymo Empl (Author), 2014, Der Weg zu einer neuen Theatertheorie? Bertolt Brechts episches Theater in "Der gute Mensch von Sezuan"., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276403