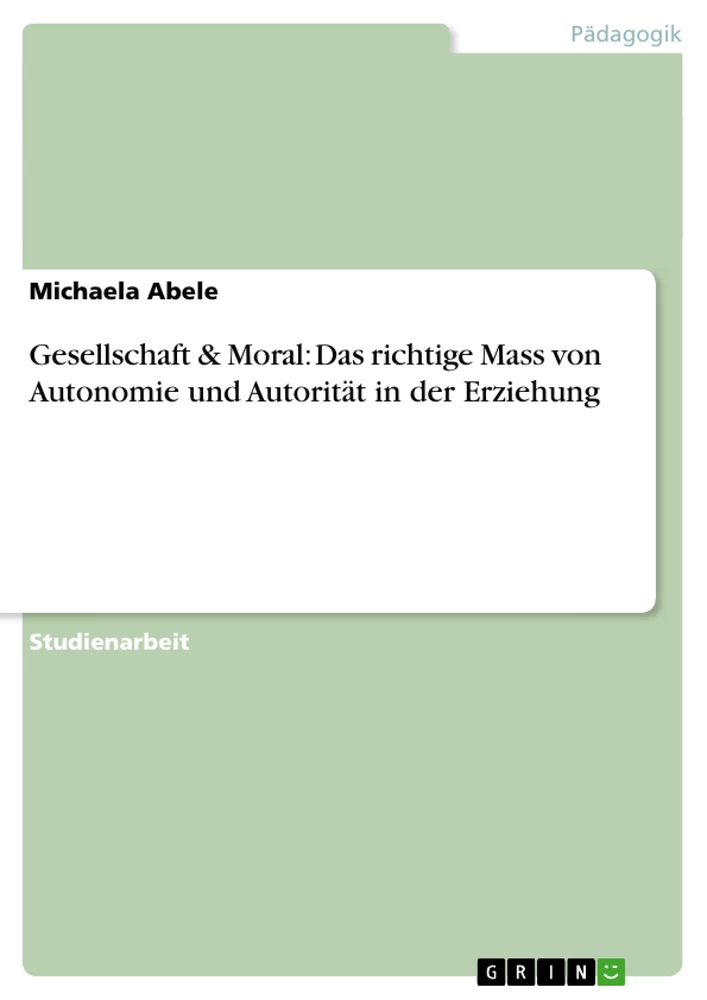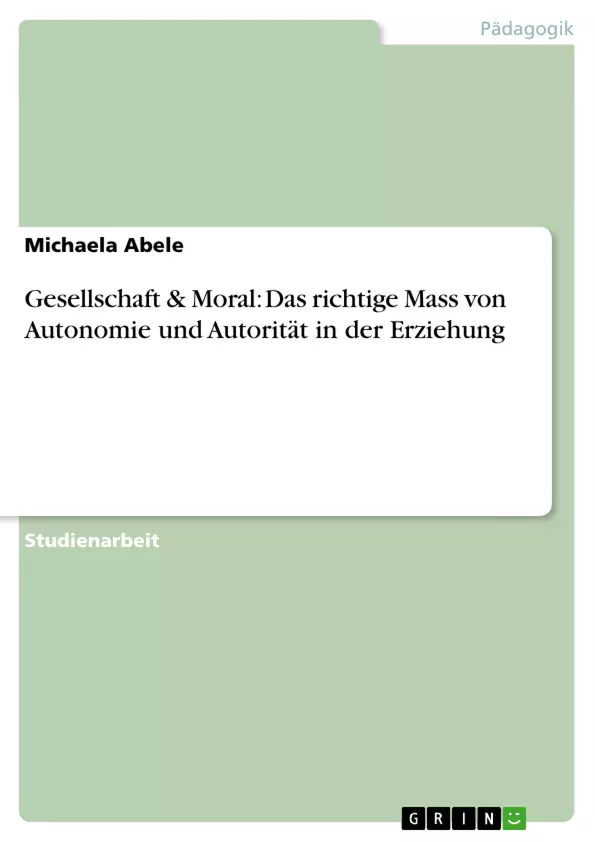Für den Menschen als soziales Wesen, als „zoon politicon“ wie es Aristoteles
formulierte, spielen Verhaltensmaßregeln eine zentrale Rolle. Eine Gemeinschaft kann
nicht existieren, wenn von zu vielen ihrer Mitglieder widerstreitende Interessen verfolgt
werden, ein Zusammenleben mehrerer ist nur möglich, wenn das Verhalten des Einzelnen
dem Wohl aller nicht entgegenwirkt. Doch gerade ein solches Phänomen ist die steigende
Gewaltbereitschaft Jugendlicher in Deutschland am Ende des 20. Jahrhunderts – Gewalt
vor allem gegenüber Minderheiten wie Asylanten, gepaart mit einer Gewissenlosigkeit, die
jeglichem Unrechtsempfinden entbehrt. Dieses Phänomen inklusive der Wirkungslosigkeit
angedrohter Sanktionen dient Detlef Horster als Aufhänger für seinen Artikel „Was sind
moralische Regeln und wie lernt man sie?“1, auf dem die vorliegende Hausarbeit aufbaut.
Im Folgenden werde ich zunächst Horsters grundlegende Gedanken aufgreifen, dabei
aber auch eigene Überlegungen miteinbeziehen, wobei ich unter anderem das Problem der
Normsetzung in der Pädagogik streifen werde. Desweitern möchte ich Alternativen zu
Horsters Ansatz vorstellen und auf die damit verbundene Problematik eingehen, bevor ich
letztendlich die jeweiligen Modelle gegeneinander abwägen werde.
1 Detlef Horster, „Was sind moralische Regeln und wie lernt man sie?“. Kurt Beutler und Detlef Horster,
Pädagogik & Ethik , Reclam, Stuttgart, 1996.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Was sind moralische Regeln und wie lernt man sie?
- II. 1. Definition moralischer Regeln
- II. 2. Bedeutung moralischer Regeln für die Gesellschaft
- II. 3. Entstehung von Moral
- II. 4. Das Problem der Normsetzung in der Pädagogik
- III. Sanktionen
- III. 1. Ziel und Funktion von Sanktionen
- III. 2. Die Todesstrafe
- III. 3. Potentielle Effekte harter bzw. unzureichend differenzierter Sanktionen
- IV. Ursachenbekämpfung
- IV. 1. Motivationen und Gegenmaßnahmen
- IV. 2. Prävention
- V. Modell einer Ideal-Gesellschaft
- V. 1. Moralidee, Sanktionsmodell oder Ursachenbekämpfung?
- V. 2. Sind Gesetze überflüssig?
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Moral im gesellschaftlichen Zusammenleben spielt und wie Menschen moralische Regeln lernen. Der Fokus liegt dabei auf den Gedanken des Autors Detlef Horster, der eine enge Verbindung zwischen Moral und Rechtsempfinden hervorhebt. Die Arbeit untersucht die Bedeutung moralischer Regeln für die Gesellschaft, die Entstehung von Moral und die Problematik der Normsetzung in der Pädagogik.
- Definition moralischer Regeln und Abgrenzung von rechtlichen Regeln
- Bedeutung moralischer Regeln für das gesellschaftliche Zusammenleben
- Entstehung von Moral und Verinnerlichung von Regeln
- Kritik an der Wirksamkeit von Sanktionen und die Notwendigkeit einer moralischen Basis
- Alternative Modelle zur Ursachenbekämpfung und zur Schaffung einer Ideal-Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
II. Was sind moralische Regeln und wie lernt man sie?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Moral und der Abgrenzung von Konventionen, Sitten und Bräuchen sowie rechtlichen Regeln. Es wird hervorgehoben, dass Moral nicht auf äußeren Zwang, sondern auf innerer Haltung basiert und durch Verinnerlichung von Regeln entsteht. Die Bedeutung moralischer Regeln für die Gesellschaft wird anhand der steigenden Gewaltbereitschaft Jugendlicher und der Ineffektivität von Sanktionen verdeutlicht.
III. Sanktionen
Das Kapitel beleuchtet die Zielsetzung und Funktion von Sanktionen und untersucht die Auswirkungen der Todesstrafe. Es werden potentielle Effekte harter oder unzureichend differenzierter Sanktionen analysiert und die Notwendigkeit einer moralischen Grundlage für die Wirksamkeit von Strafen betont.
IV. Ursachenbekämpfung
Dieses Kapitel präsentiert alternative Ansätze zur Ursachenbekämpfung von Kriminalität. Es werden Motivationen und Gegenmaßnahmen im Kampf gegen Gewalt und die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen diskutiert.
V. Modell einer Ideal-Gesellschaft
Im letzten Kapitel werden verschiedene Modelle einer Ideal-Gesellschaft vorgestellt und verglichen. Die Frage, ob moralische Regeln, Sanktionen oder Ursachenbekämpfung die Grundlage für eine gerechte und friedliche Gesellschaft bilden, wird diskutiert. Die Überlegungen zur Überflüssigkeit von Gesetzen in einer moralischen Gesellschaft werden dargelegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Moral, Rechtsempfinden, gesellschaftliches Zusammenleben, Gewaltbereitschaft Jugendlicher, Sanktionen, Ursachenbekämpfung, Prävention und Ideal-Gesellschaft. Dabei werden die Gedanken Detlef Horsters und die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung als zentrale Bezugspunkte verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernt man moralische Regeln laut Detlef Horster?
Moralische Regeln werden nicht durch äußeren Zwang, sondern durch Verinnerlichung und die Entwicklung eines inneren Rechtsempfindens im sozialen Umfeld gelernt.
Was ist der Unterschied zwischen Moral und Konvention?
Moral basiert auf einer inneren Haltung und ethischen Prinzipien, während Konventionen eher gesellschaftliche Sitten und Bräuche ohne tiefere ethische Begründung sind.
Warum sind Sanktionen oft wirkungslos?
Sanktionen wirken nur, wenn eine moralische Basis vorhanden ist; ohne Unrechtsempfinden werden Strafen lediglich als Pech oder technisches Risiko wahrgenommen.
Welches Problem gibt es bei der Normsetzung in der Pädagogik?
Pädagogen müssen entscheiden, welche Werte sie vermitteln, ohne die Autonomie der Jugendlichen zu unterdrücken, was eine Balance zwischen Autorität und Freiheit erfordert.
Was ist das Ziel der Ursachenbekämpfung bei Gewalt?
Ziel ist es, durch Prävention und soziale Maßnahmen die Motivation für Gewalt zu senken, statt lediglich auf die Taten mit harten Strafen zu reagieren.
- Citar trabajo
- Michaela Abele (Autor), 2004, Gesellschaft & Moral: Das richtige Mass von Autonomie und Autorität in der Erziehung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27640