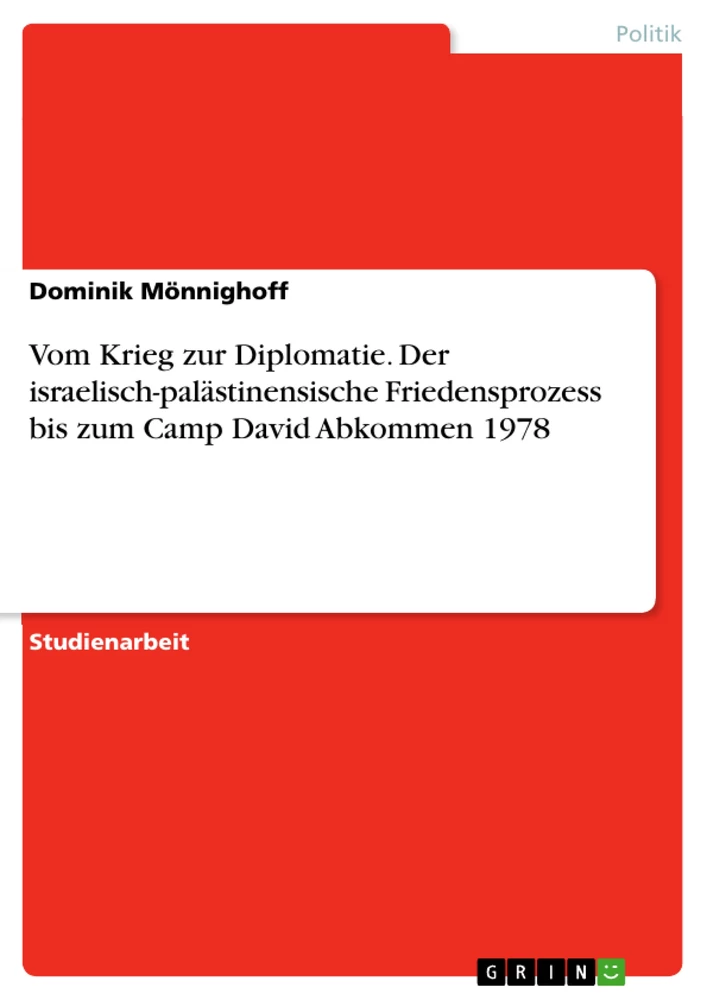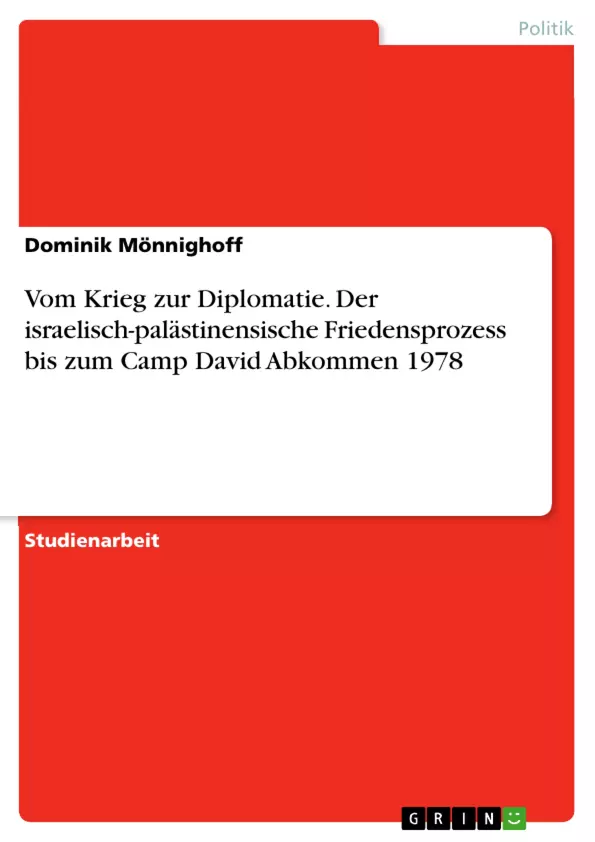Der Nahostkonflikt ist einer der ältesten und immer noch aktuellsten Konflikte unserer Zeit. Gegen den Widerstand der arabischen Bevölkerung gründeten jüdische Siedler im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948 auf britischen Mandatsgebiet den Staate Israel. Da das Gebiet palästinensisch war, kam es zu Reaktionen der arabischen Nachbarn, denn für Sie hatte Israel keine Daseins-Berechtigung. Es folgten mehrere Kriege der arabischen Staaten gegen Israel. Israel siegte jedoch in jeder gewaltsamen Auseinandersetzung. Die größten Verluste bescherte der Sechs-Tage-Krieg 1967 den arabischen Staaten, als nach dem Waffenstillstand der Gaza-Streifen, die Sinai-Halbinsel, Westjordanien sowie die syrischen Golanhöhlen Israel alle Gebiete weiterhin besetzte. Auf der Gipfelkonferenz von Khartoum einigten sich die arabischen Staaten auf die „Drei Neins“ im Bezug auf Israel: Keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels, keinen Frieden mit Israel.
Nach dem Sechs-Tage Krieg setzt ein beginnender Friedensprozess ein, welcher in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen wird. Ein Friedensprozess unterliegt vielen Faktoren, die Ihn beeinflussen. Der Zugriff auf den israelischen-ägyptischen Friedensprozess soll anhand der Realismus-Theorie der Internationalen Beziehungen erfolgen. Der Friedensprozess fällt in die Zeitspanne des Kalten Krieges, in der die Theorie des Realismus neben der des Neorealismus die vorherrschende war.
War das Camp-David-Abkommen ein Erfolg und ein Fortschritt für den Friedensprozess im Nahen Osten oder zersplitterte er die arabische Welt und machte einen dauerhaften Frieden noch unwahrscheinlicher? War es der Mediation der Amerikaner geschuldet, einen kurzfristigen Erfolg im Friedensprozess zu verzeichnen?
Außerdem soll untersucht werden, inwiefern der israelisch-ägyptische Friedensprozess ein Projekt der Eliten unter besonderer Vermittlung der US-Amerikaner gewesen ist. So sollen neben den externen Faktoren auch die innerstaatlichen Voraussetzungen für das staatliche Handeln untersucht werden. Der staatszentrierte Realismus misst Internationalen Organisationen keinen hohen Stellenwert zu. Jeder Staat versucht möglichst unabhängig von anderen Staaten oder Organisationen zu bleiben, da diese keine verlässliche Sicherheit garantieren können. Das Prinzip der Selbsthilfe ist wohl auch Grund dafür, dass die Vereinten Nationen in diesem Konflikt eine schwache Position einnehmen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Theoretische Vorbemerkungen
- Die Entflechtungsabkommen der Genfer Friedenskonferenz 1973
- Das israelisch-ägyptische Sinai-Abkommen von 1975
- Der Besuch Präsident Sadats in Israel
- Die Verträge von Camp David
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den israelisch-palästinensischen Friedensprozess bis zum Camp David Abkommen 1978, wobei der Fokus auf dem israelisch-ägyptischen Friedensprozess liegt. Ziel ist es, die Entwicklung des Friedensprozesses im Kontext der Realismus-Theorie der Internationalen Beziehungen zu betrachten und die Rolle der USA als Vermittler zu untersuchen.
- Die Entflechtungsabkommen der Genfer Friedenskonferenz 1973
- Das israelisch-ägyptische Sinai-Abkommen von 1975
- Der Besuch Präsident Sadats in Israel
- Die Verträge von Camp David
- Die Rolle der USA als Vermittler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Nahostkonflikt und seine historische Entwicklung dar, wobei der Fokus auf den Sechs-Tage-Krieg 1967 und die daraus resultierenden Spannungen liegt. Die Arbeit untersucht den Friedensprozess im Kontext der Realismus-Theorie und analysiert die Rolle der USA als Vermittler.
Das Kapitel über die Entflechtungsabkommen der Genfer Friedenskonferenz 1973 beleuchtet die ersten Schritte zur Deeskalation des Konflikts nach dem Jom-Kippur-Krieg. Es wird die Rolle der USA und der Sowjetunion sowie die Schwierigkeiten bei der Einbindung der PLO in den Friedensprozess dargestellt.
Das Kapitel über das israelisch-ägyptische Sinai-Abkommen von 1975 beschreibt die weitere Entwicklung des Friedensprozesses zwischen Israel und Ägypten. Es werden die Hintergründe des Abkommens, die Rolle der USA und die Auswirkungen auf die arabische Welt beleuchtet.
Das Kapitel über den Besuch Präsident Sadats in Israel analysiert die historische Bedeutung dieses Ereignisses und die damit verbundenen politischen und diplomatischen Prozesse. Es werden die Reaktionen in Israel und der arabischen Welt sowie die Rolle der USA betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den israelisch-palästinensischen Friedensprozess, den israelisch-ägyptischen Friedensprozess, die Realismus-Theorie, die Rolle der USA als Vermittler, die Genfer Friedenskonferenz 1973, das Sinai-Abkommen von 1975, der Besuch Präsident Sadats in Israel und die Verträge von Camp David.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Camp David Abkommen von 1978?
Es war ein historisches Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten, das unter Vermittlung von US-Präsident Jimmy Carter zustande kam.
Welche Rolle spielten die USA als Vermittler?
Die USA agierten als zentrale Mediatoren, wobei der Friedensprozess stark von den Eliten und diplomatischem Druck aus Washington geprägt war.
Wie reagierte die arabische Welt auf den Besuch Sadats in Israel?
Der Besuch führte zu einer Zersplitterung der arabischen Welt, da viele Staaten die Anerkennung Israels und den Alleingang Ägyptens ablehnten.
Was besagten die "Drei Neins" von Khartoum?
Sie waren die offizielle arabische Haltung nach 1967: Keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel, kein Frieden mit Israel.
Wie erklärt der Realismus den israelisch-ägyptischen Frieden?
Die Theorie des Realismus sieht Staaten als rationale Akteure, die Frieden schließen, wenn es ihrer nationalen Sicherheit und Unabhängigkeit im Kontext des Kalten Krieges dient.
- Citar trabajo
- Dominik Mönnighoff (Autor), 2013, Vom Krieg zur Diplomatie. Der israelisch-palästinensische Friedensprozess bis zum Camp David Abkommen 1978, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276426