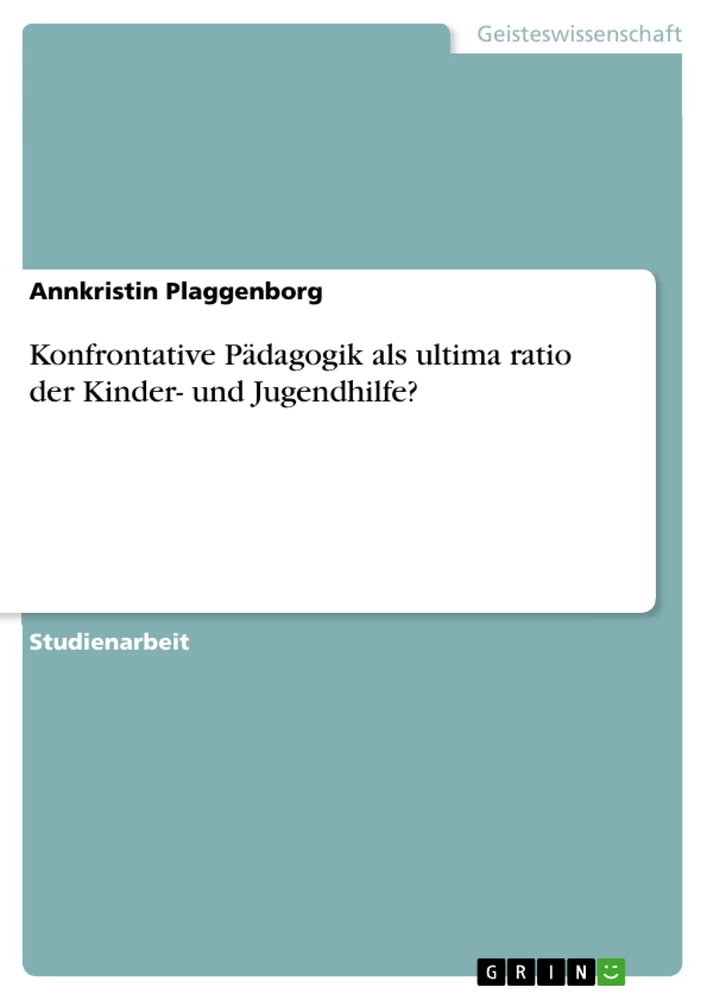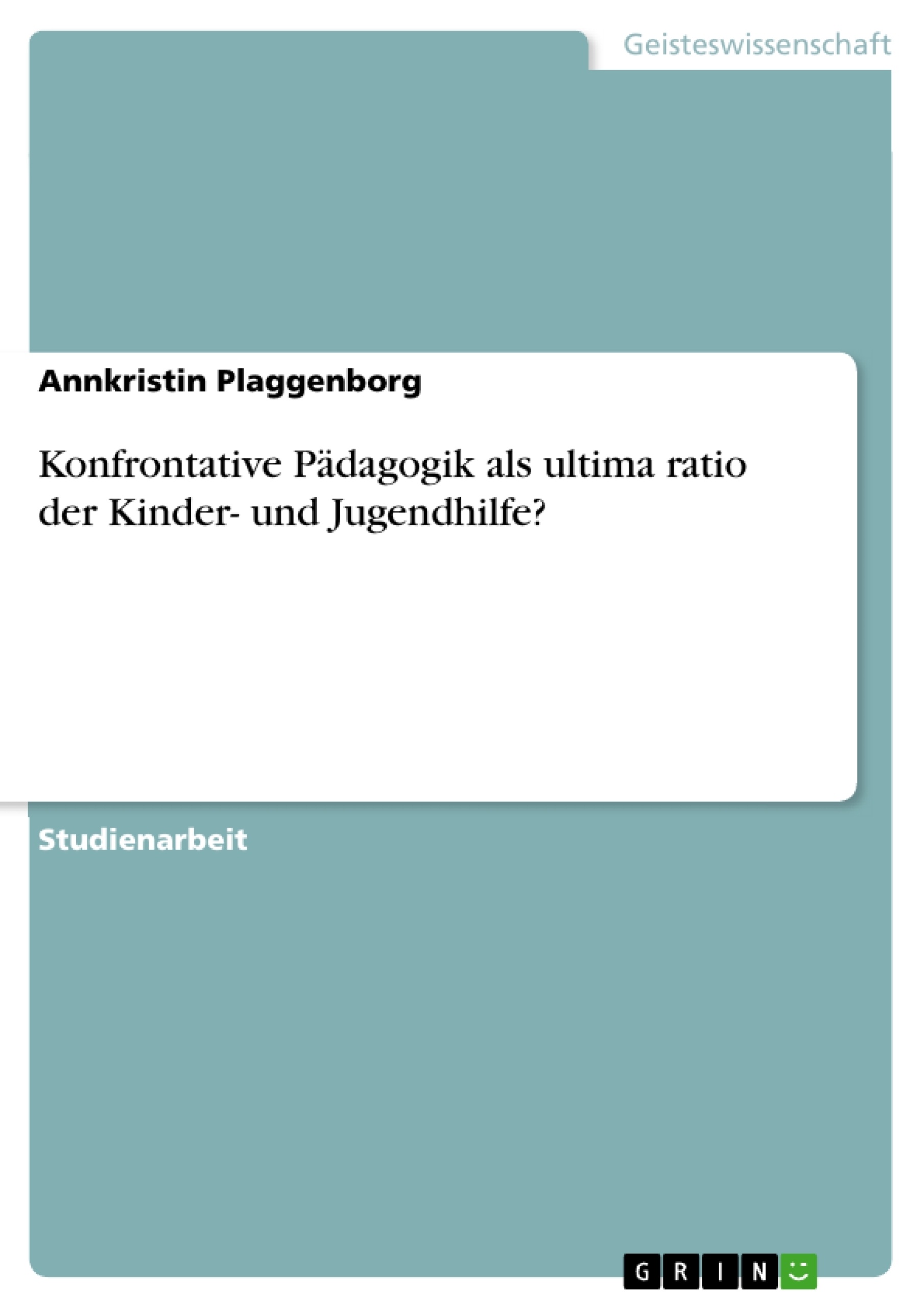Es wird ein sehr umstrittenes Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe behandelt: Die konfrontative Pädagogik.
Diese Art von Erziehung setzt da an, wo herkömmliche Methoden versagen. Dies liegt unter anderem an den persönlichen Grenzen der handelnden Sozialarbeiter. Anfänglich wird zur Veranschaulichung der Problematik auf das Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe eingegangen. Im Weiteren werden entsprechende allgemeine Dinge, wie beispielsweise der grundsätzliche Aufbau der staatlichen Hilfe, geklärt. Dieser kurze Einblick soll ein besseres Verständnis beim Leser hervorrufen und eventuelle Unklarheiten im Voraus zu beseitigen. Dieser kann somit trotz geringer Kenntnisse, jegliche Schritte nachvollziehen und seine persönliche Meinung über diese Problematik bilden.
Was dieses Thema relevant und interessant macht, sind die Vorbehalte, die oft mit dieser speziellen Handlungsstrategie einhergehen. Es besteht die allgemeine Meinung, dass gewalttätige Mehrfachauffällige nicht bereit sind sich zu ändern, sodass das Gefängnis die einzige Möglichkeit ist, sich und die Gesellschaft schützen zu können. Ein weiterer Grund für bestehende Kritik ist der Vorwurf, dass diese sozialarbeiterische Vorgehensweise eine „Wiederbelebung autoritärer Strukturen in einem neuen terminologischen Gewand“ (Weidner 2010, S. 13) darstellt.
Auf der anderen Seite besteht ebenfalls Kritik an dieser neuen Methodik. Entgegen des durch die Medien verbreiteten Erfolges des „heißen Stuhls“ oder der Hinter-dem-Rücken-Technik , belegen gewisse Studien, dass eine Verhaltensveränderung beim Probanden nach der Therapie nicht zwingend folgen muss. Die Rückfallrate, wie auch die Rückfallgeschwindigkeit sind fast identisch. Böse Zungen gehen sogar soweit und behaupten, dass diese Trainingsform außergewöhnlich mediengeeignet ist. Nicht ohne Grund bestehe ein so großer Hype um diese Behandlungsform. (vgl. Hoenig 2008, S.93). Die daraus resultierende Beliebtheit sei lediglich Produkt der enormen Medienpräsenz, jedoch völlig unbegründet (vgl. ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Kinder- und Jugendhilfe
- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe
- 3. Definition Konfrontative Pädagogik (KP)
- 3.1 Ziele
- 3.2 Zielgruppe
- 3.3 Methoden
- 3.3.1 Ein Beispiel: Das Anti-Aggressivitäts-Training ®
- 4. Evaluierung der Methodik mit Rückblick auf die Fragestellung
- 5. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Konfrontativen Pädagogik im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. Sie untersucht die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen dieser umstrittenen Methode, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob sie als Ultima Ratio in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt werden kann.
- Definition und Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe
- Ziele, Zielgruppen und Methoden der Konfrontativen Pädagogik
- Evaluierung der Wirksamkeit und ethische Aspekte der Konfrontativen Pädagogik
- Diskussion der Grenzen und Risiken der Konfrontativen Pädagogik
- Entwicklung eines Fazits zur Frage, ob die Konfrontative Pädagogik als Ultima Ratio in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Konfrontativen Pädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie beleuchtet die Vorbehalte und Kritikpunkte, die mit dieser Methode verbunden sind, sowie die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
Kapitel 2 definiert den Begriff der Kinder- und Jugendhilfe und beleuchtet die Rahmenbedingungen sowie die Grenzen dieser staatlichen Hilfe. Es wird auf die Herausforderungen und Dilemmata eingegangen, die im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe auftreten.
Kapitel 3 widmet sich der Definition der Konfrontativen Pädagogik. Es werden die Ziele, die Zielgruppe und die Methoden dieser pädagogischen Herangehensweise erläutert. Ein Beispiel für eine konfrontative Methode, das Anti-Aggressivitäts-Training ®, wird näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Konfrontative Pädagogik, Kinder- und Jugendhilfe, Ultima Ratio, Gewaltprävention, Verhaltensänderung, Mehrfachtäter, ethische Aspekte, Wirksamkeit, Grenzen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konfrontative Pädagogik (KP)?
Es ist eine Methode der Kinder- und Jugendhilfe, die bei gewaltbereiten Mehrfachtätern ansetzt und durch direkte Konfrontation mit dem Fehlverhalten eine Verhaltensänderung bewirken will.
Was ist das Ziel des Anti-Aggressivitäts-Trainings (AAT)?
Das Ziel ist die Reduzierung von Gewaltbereitschaft durch Methoden wie den „heißen Stuhl“, bei dem der Proband mit seinen Taten und deren Folgen für die Opfer konfrontiert wird.
Warum ist die Konfrontative Pädagogik umstritten?
Kritiker werfen ihr die Wiederbelebung autoritärer Strukturen vor. Zudem zeigen Studien, dass die Rückfallquoten im Vergleich zu anderen Maßnahmen nicht zwingend niedriger sind.
Gilt die KP als „Ultima Ratio“?
Sie wird oft als letztes Mittel eingesetzt, wenn herkömmliche pädagogische Methoden versagen, wobei ihre Wirksamkeit und ethische Vertretbarkeit intensiv diskutiert werden.
Welche Rolle spielen die Medien bei diesem Thema?
Medienberichte über spektakuläre Trainingserfolge haben den Hype um die KP befeuert, was laut Experten die tatsächliche wissenschaftliche Evidenz teilweise überlagert.
- Arbeit zitieren
- Annkristin Plaggenborg (Autor:in), 2013, Konfrontative Pädagogik als ultima ratio der Kinder- und Jugendhilfe?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276446