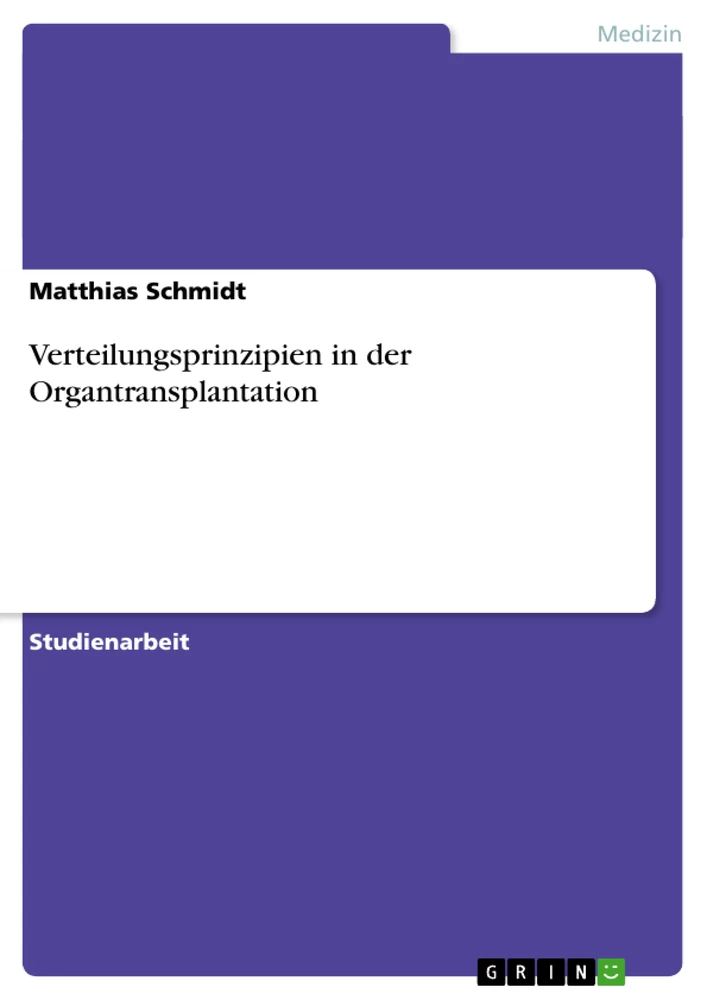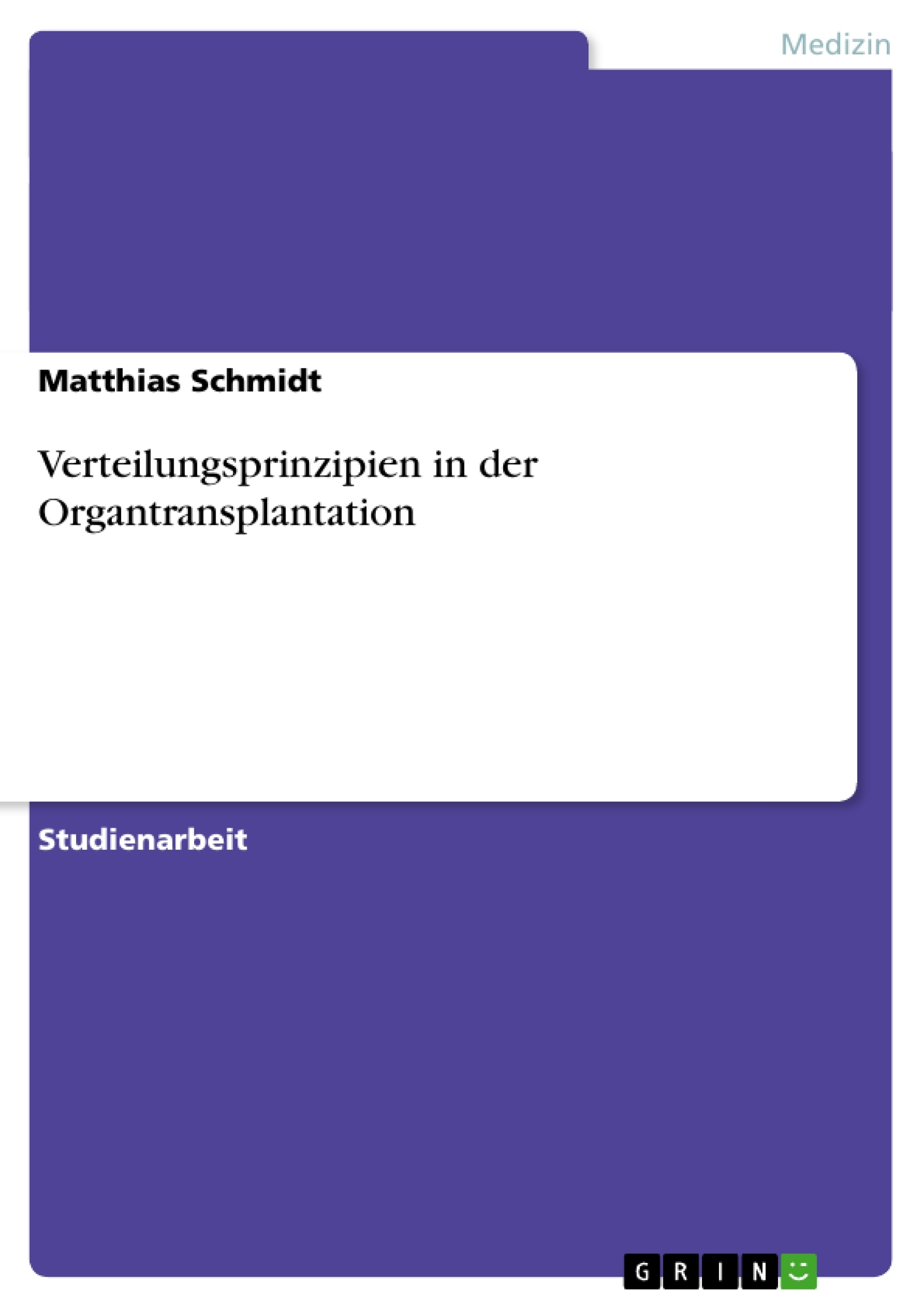Die Transplantationsmedizin ist heutzutage ein fester Bestandteil der Medizin und
des Gesundheitswesens. Im Gegensatz zu anderen Bereichen gibt es jedoch hier das
Problem, dass man mit einer gegebenen Anzahl von verfügbaren Organ-Ressourcen
auskommen muss. In Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, übersteigt
die Anzahl der auf ein Organ wartenden Patienten die Anzahl der, durch die
begrenzte Anzahl der zur Transplantation freigegebenen Organe, möglichen
Transplantationen. In den letzten Jahren ist die Warteliste derart kontinuierlich
angewachsen, das es nach Meinung der Deutschen Stiftung Organtransplantation
(DSO) fraglich ist ob diese jemals abgebaut werden kann (DSO 2001, Seite 40). Die
Warteliste für Nierentransplantation entsprach im Jahr 2000 dem circa fünffachen
der realisierten Transplantationen (ebd, Seite 44 (Abb. 37)). Es ist anzumerken, das
auch im internationalen Vergleich eine Entwicklung ständig steigender Wartelisten
zu beobachten ist. Selbst durch einen (mitunter langsamen) kontinuierlichen Anstieg
von Transplantationen in den letzten Jahren ist es nicht zu einem Abbau von
Wartelisten sondern zu deren Anstieg gekommen. Das mag durch den Fortschritt in
der Medizin, die Bevölkerungsentwicklung und durch eine immer größere
Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen einer immer breiteren Bevölkerung zu
erklären sein. Eine einheitliche Begründung gibt es dafür jedoch nicht.
Es wird in der Hausarbeit nur darum gehen wie man mit den zurzeit verfügbaren
Organen umgeht. Die Frage, wie man zu Organen kommt, also die der Organspende
eröffnet ein weiters großes Diskussionsfeld, welches hier nicht behandelt werden
soll.
Als erstes werden verschiedene Kriterien vorgestellt, mit denen man theoretisch
arbeiten kann, wenn es um eine Zuteilung von Organen geht und deren Vor- und
Nachteile beleuchtet. Anschließend werden diese Kriterien in einem Modell
ethischen Prinzipien zugeordnet. Im zweiten Teil wird das deutsche
Transplantationssystem vorgestellt um einen Vergleich der theoretischen Kriterien
und Prinzipien mit der Praxis herzustellen. Ein Ausblick auf das amerikanische
Transplantationssystem wird dies noch zusätzlich vervollständigen. Im Schlussteil
werden einzelne kritische Diskussionspunkte aufgezeigt und Themen für weitere
Diskussionen benannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsebenen
- Prinzipien der Organverteilung
- Allgemeine Gedanken
- Der Patient als Individuum' / Prinzip der Wohltätigkeit
- Medizinischer und allgemeiner Nutzen / Prinzip des Utilitarismus
- Dringlichkeit
- Schadensvermeidung
- Soziale Kriterien allgemein
- Wartezeit
- Lotterieprinzip
- Psychosoziale Kriterien
- Soziale Unterstützung
- Soziale Verantwortung
- Selbstverschulden
- Soziale Wertigkeit
- Gruppenzugehörigkeit
- Finanzielle Ausstattung / Zahlungsfähigkeit
- Retransplantation
- Zusammenfassung
- Überschneidungen aktueller Normen/Prinzipien
- Konflikt zwischen Dialyse und Transplantation
- Praktizierte Modelle
- Das Eurotransplant - System
- Sachtechnische / logistische Grundlagen von Eurotransplant
- Ablauf und Phasen der Organverteilung
- Punktesystem für Nierentransplantation
- Entwicklung
- Das US-amerikanische Punktesystem
- Punktesystem der Nierentransplantation
- Weitere Diskussionspunkte
- Anmerkungen zum Kriterium der Spender-Empfänger-Bilanz
- Allgemeine Juristische Gesichtspunkte
- Umgang mit suboptimaler Verteilung
- Umgang mit finanziellen Ressourcen
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage der Verteilung von Organen in der Transplantationsmedizin. Dabei liegt der Fokus auf den Kriterien und Prinzipien, die bei der Zuteilung von Organen zum Einsatz kommen. Ziel ist es, verschiedene theoretische Ansätze zur Organverteilung darzustellen, deren Vor- und Nachteile zu beleuchten und diese mit der Praxis im deutschen und amerikanischen Transplantationssystem zu vergleichen. Darüber hinaus werden kritische Diskussionspunkte aufgezeigt und Themen für weitere Debatten benannt.
- Ethische Prinzipien der Organverteilung
- Theoretische Kriterien der Organverteilung
- Praxis der Organverteilung in Deutschland und den USA
- Diskussion um Fairness und Gerechtigkeit in der Organverteilung
- Kritikpunkte und Herausforderungen der Organverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Organverteilung in der Transplantationsmedizin ein und erläutert die Bedeutung des Themas im Kontext steigender Wartelisten. Es werden verschiedene Ebenen der Allokation von Ressourcen im Gesundheitswesen dargestellt, die die Entscheidung über Organverteilungen beeinflussen.
Kapitel 2 präsentiert verschiedene Prinzipien der Organverteilung, darunter das Prinzip der Wohltätigkeit, das Prinzip des Utilitarismus, Dringlichkeit, Schadensvermeidung und soziale Kriterien. Die Kapitel gehen auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kriterien ein.
Kapitel 3 fasst die Überschneidungen zwischen aktuellen Normen und Prinzipien der Organverteilung zusammen und beleuchtet den Konflikt zwischen Dialyse und Transplantation.
Kapitel 4 stellt das deutsche und das US-amerikanische Transplantationssystem vor, einschließlich der Funktionsweise von Eurotransplant und der jeweiligen Punktesysteme für Nierentransplantationen.
Kapitel 5 eröffnet weitere Diskussionspunkte, die die ethischen und rechtlichen Aspekte der Organverteilung betreffen, wie z.B. die Spender-Empfänger-Bilanz, den Umgang mit suboptimaler Verteilung und den Umgang mit finanziellen Ressourcen.
Schlüsselwörter
Organtransplantation, Verteilungsprinzipien, Ethische Prinzipien, Gerechtigkeitsvorstellungen, Utilitarismus, Wohltätigkeit, Dringlichkeit, Soziale Kriterien, Eurotransplant, US-amerikanisches Transplantationssystem, Punktesystem, Juristische Gesichtspunkte, Ressourcenallokation, Suboptimale Verteilung, Finanzielle Ressourcen.
Häufig gestellte Fragen
Nach welchen Kriterien werden Spenderorgane verteilt?
Zu den Kriterien gehören medizinische Dringlichkeit, Erfolgsaussicht (Utilitarismus), Wartezeit und Gewebekompatibilität (HLA-Matching).
Was ist Eurotransplant?
Eurotransplant ist die Vermittlungsstelle, die den Organaustausch zwischen Deutschland und mehreren europäischen Nachbarländern nach sachtechnischen und logistischen Standards koordiniert.
Was besagt das Prinzip des Utilitarismus in der Transplantationsmedizin?
Dieses Prinzip zielt darauf ab, mit den begrenzten Organressourcen den größtmöglichen Gesamtnutzen zu erzielen, also die Patienten mit der besten Langzeitprognose zu bevorzugen.
Gibt es soziale Kriterien bei der Organvergabe?
Theoretisch werden Kriterien wie soziale Unterstützung oder Verantwortung diskutiert, in der Praxis (z. B. Deutschland) sind diese jedoch aus ethischen und rechtlichen Gründen meist ausgeschlossen.
Wie funktioniert das Punktesystem für Nierentransplantationen?
Es werden Punkte für verschiedene Faktoren wie Wartezeit, Übereinstimmung der Merkmale und regionale Nähe vergeben, um eine faire Reihung auf der Warteliste zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Matthias Schmidt (Auteur), 2002, Verteilungsprinzipien in der Organtransplantation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27644