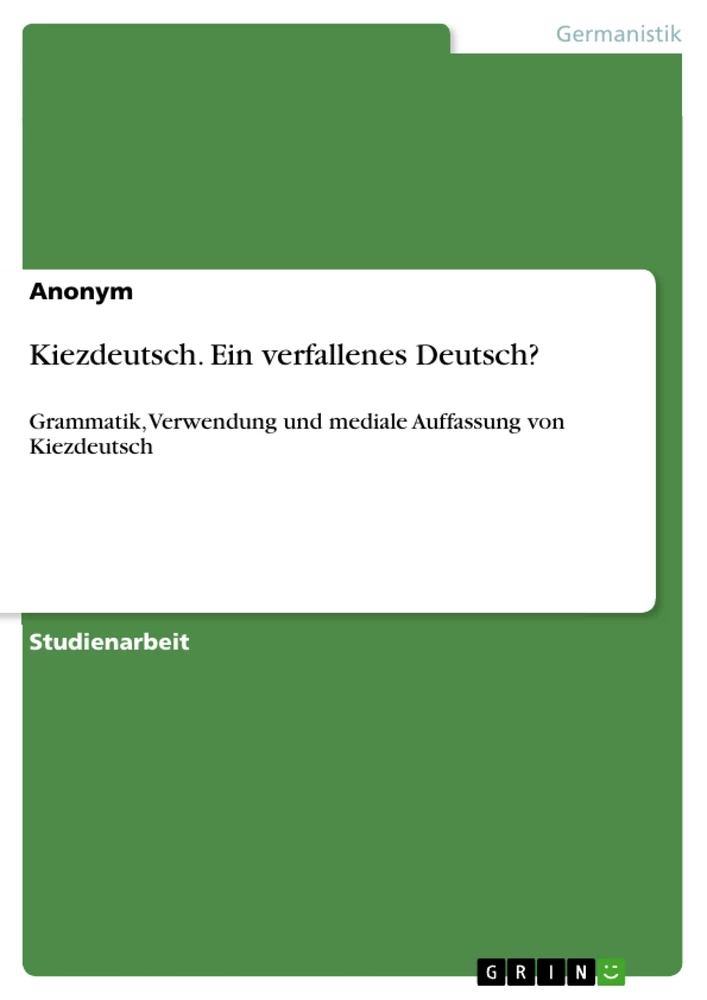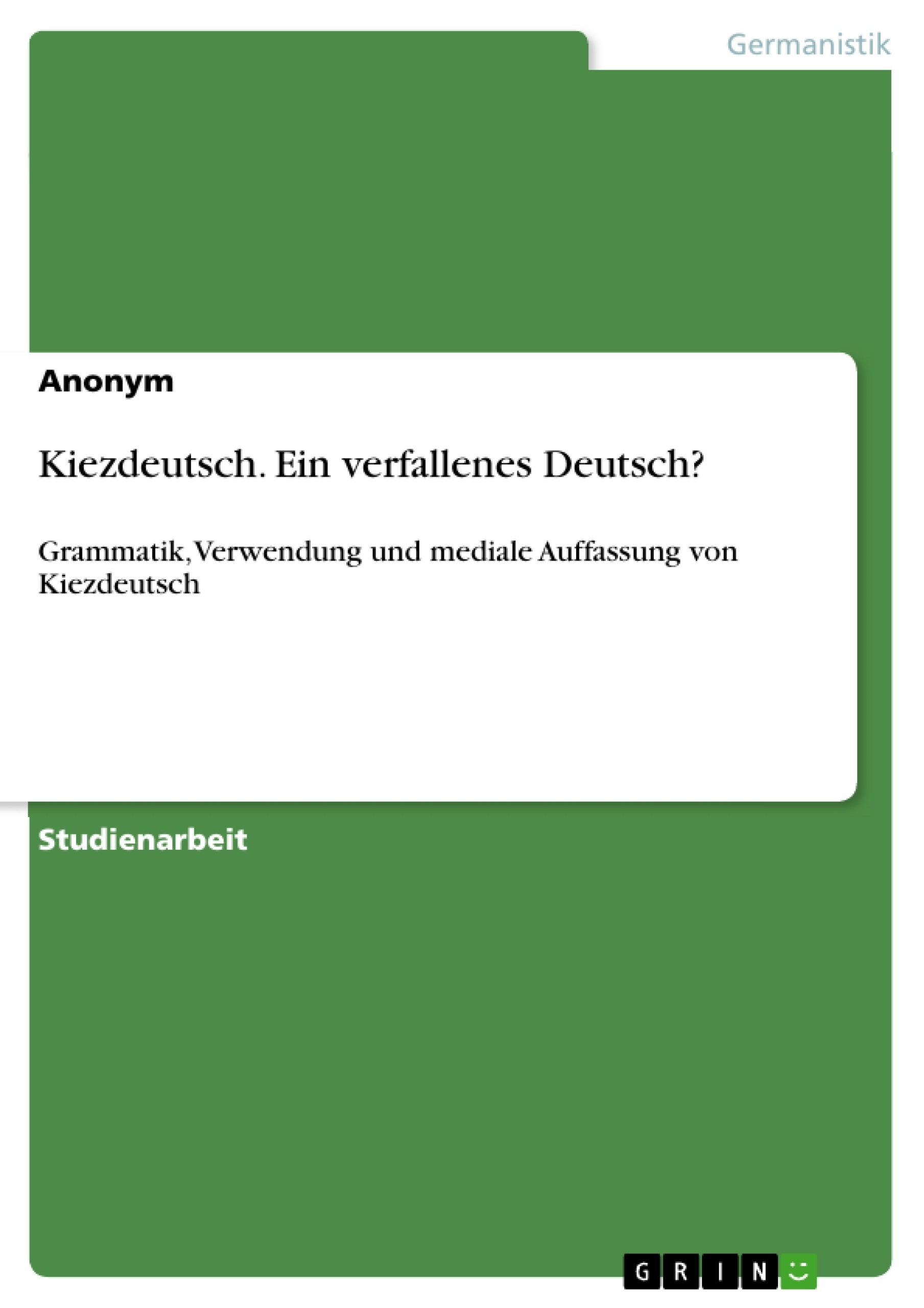Gegenstand dieser Arbeit soll es sein, eine multiperspektivische Einsicht auf die Verwendung des Kiezdeutschen zu geben. Dabei sollen Einschätzungen der Sprecher selbst, der Medien und der nicht-Sprecher gegenseitig kontrastiert und durch die Vorstellung einiger grammatikalischer Aspekte des Kiezdeutschen sprachwissenschaftlich unterfüttert werden. Ein mediales Beispiel soll dazu dienen, Kongruenz und Divergenz zwischen sprachlicher Wirklichkeit und medialer Auffassung zu illustrieren. Es soll sich der Frage genähert werden, ob es sich beim Kiezdeutschen um ein reduziertes und defizitäres Deutsch handelt und ob dies der deutschen Standardvarietät bedrohlich werden kann.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Begriff Kiezdeutsch immer mehr in den öffentlich politischen Diskurs gelangt. Doch nicht nur dieser, sondern auch andere Begriffe etablierten sich zur Beschreibung dieses jugendsprachlichen Phänomens, so zum Beispiel der zuerst durch Rosemarie Füglein durch ihre Diplomarbeit Kanak Sprak. Eine ethnolinguistische Untersuchung eines Sprachphänomens im Deutschen geprägte und später durch Feridun Zaimoglu popularisierte Begriff „Kanak Sprak“. „Kanak Sprak“ leitet sich aus der pejorativen Bezeichnung „Kanacke“ ab, die ähnlich wie der englische Begriff „nigger“ eine ethnische Beleidigung darstellt (vgl. Wiese 2006: 246). „Kanacke“ bezieht sich dabei hauptsächlich auf türkische Migranten der zweiten oder dritten Generation (vgl. Wiese 2009: 783). Die Wahl eines so negativ besetzten Begriffs sollte aber kein Zufall gewesen sein, so beschrieb Zaimoglu das, was er „Kanak Sprak“ nannte als „eine Sprache, die nur Türken verstehen“, ein „defizitäres Gestammel“, oder eine „verkauderwelschte“ Mischung aus Deutsch und Türkisch. Die öffentliche Wahrnehmung seiner Ausführungen war dementsprechend negativ behaftet (Dirim/Auer 2004: 7). Jedoch greift das Buch die Varietät nicht realistisch, sondern literarisiert auf, daher die falsche Annahme es handle sich bei „Kanak Sprak“ und Kiezdeutsch um dasselbe. Sprecher dieser Varietät verwenden daher zwar eher den Ausdruck „Kiezsprache“, aber in dieser Arbeit soll fortan „Kiezdeutsch“ zur Betitelung des Sachverhalts benutzt werden, da die Semantik der beiden Konstituenten dieses Kompositums bereits grob beschreibt, was Kiezdeutsch ausmacht. Zum einen ist Kiezdeutsch nämlich, auch wenn teilweise Wörter aus anderen Sprachen entlehnt werden (Wiese 2009: 786), eine Varietät der deutschen Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. BEGRIFF „KIEZDEUTSCH“
- 2. KIEZDEUTSCH-SPRECHER
- 2.1. IDENTIFIKATORISCHE BEDEUTUNG
- 3. GRAMMATIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
- 3.1. GRAMMATIKALISCHE REDUKTION
- 3.2. KONSTRUKTIONEN MIT BLOẞEN NOMINALPHRASEN
- 4. SPRACHWECHSELVERHALTEN IN GESPRÄCHSSITUATIONEN
- 4.1. „CODE-SWITCHING“
- 4.1.1. TEILNEHMERBEZOGENES „CODE-SWITCHING“
- 4.1.2. DISKURSFUNKTIONALES „CODE-SWITCHING“
- 4.2. „CODE-MIXING“
- 4.3. SPRACHALTERNATIONEN AM BEISPIEL MURATS UND DER TÜRKISCHEN POWERGIRLS
- 4.1. „CODE-SWITCHING“
- 5. KONTRASTIERENDE STILE
- 5.1. GASTARBEITERDEUTSCH
- 5.2. SEKUNDÄRER ETHNOLEKT
- 5.2.1. SEKUNDÄRER ETHNOLEKT AM BEISPIEL VON „WAS GUCKST DU?!“
- 5.3. TERTIÄRER ETHNOLEKT
- 5.4. „CROSSING“
- 4. FAZIT
- 5. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Kiezdeutschen und verfolgt das Ziel, eine multiperspektivische Analyse seiner Verwendung zu liefern. Dabei werden Einschätzungen von Sprechern, Medien und Nicht-Sprechern kontrastiert und durch sprachwissenschaftliche Erkenntnisse über grammatische Aspekte des Kiezdeutschen untermauert. Die Arbeit untersucht, ob Kiezdeutsch als reduziertes und defizitäres Deutsch betrachtet werden kann und ob es eine Bedrohung für die deutsche Standardvarietät darstellt.
- Die Entstehung und Entwicklung des Begriffs „Kiezdeutsch“
- Die sprachlichen und soziokulturellen Merkmale von Kiezdeutsch-Sprechern
- Die grammatischen Besonderheiten des Kiezdeutschen, insbesondere Reduktion und Verwendung bloßer Nominalphrasen
- Der Sprachwechsel in Gesprächssituationen, einschließlich Code-Switching und Code-Mixing
- Die Kontrastierung von Kiezdeutsch mit anderen Sprachvarianten wie Gastarbeiterdeutsch und Sekundärem Ethnolekt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kiezdeutsch ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Entstehung des Begriffs „Kiezdeutsch“ und stellt ihn in Relation zu anderen Begriffen wie „Kanak Sprak“. Die Einleitung verdeutlicht die Bedeutung des Kiezdeutschen als sprachliche Varietät, die in informellen Gesprächssituationen verwendet wird.
Kapitel 2 befasst sich mit den Sprechern des Kiezdeutschen. Es wird erläutert, dass Kiezdeutsch von Jugendlichen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen sowie von deutschen Jugendlichen gesprochen wird. Die Verwendung von Kiezdeutsch ist meist auf in-group-Situationen beschränkt und findet vor allem zwischen jugendlichen Sprechern statt. Das Kapitel beleuchtet die identifikatorische Bedeutung des Kiezdeutschen und die Gründe, warum deutsche Muttersprachler diese Sprachvarietät verwenden.
Kapitel 3 analysiert die grammatischen Eigenschaften des Kiezdeutschen. Es werden die grammatischen Reduktionen und die Verwendung bloßer Nominalphrasen als charakteristische Merkmale des Kiezdeutschen beschrieben. Das Kapitel beleuchtet die sprachlichen Besonderheiten des Kiezdeutschen und stellt sie in den Kontext der Sprachentwicklung.
Kapitel 4 untersucht das Sprachwechselverhalten in Gesprächssituationen, insbesondere Code-Switching und Code-Mixing. Es werden die verschiedenen Formen des Sprachwechsels und ihre Funktionen in der Kommunikation erläutert. Das Kapitel analysiert die Sprachalternationen am Beispiel von Murat und den Türkischen Powergirls und zeigt die Bedeutung des Sprachwechsels für die soziale Interaktion.
Kapitel 5 kontrastiert Kiezdeutsch mit anderen Sprachvarianten wie Gastarbeiterdeutsch und Sekundärem Ethnolekt. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Sprachvarianten aufgezeigt und die Entwicklung des Kiezdeutschen im Kontext der Sprachgeschichte beleuchtet. Das Kapitel analysiert den Tertiären Ethnolekt und das Phänomen des „Crossing“ und zeigt die vielfältigen Formen der Sprachvariation im urbanen Raum.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kiezdeutsch, Jugendsprache, Multiethnolekt, Sprachvariation, Sprachwechsel, Code-Switching, Code-Mixing, Gastarbeiterdeutsch, Sekundärer Ethnolekt, Tertiärer Ethnolekt, „Crossing“, Identifikatorische Bedeutung, Sprachliche Reduktion, Soziolinguistik, Sprachgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Kiezdeutsch. Ein verfallenes Deutsch?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276582