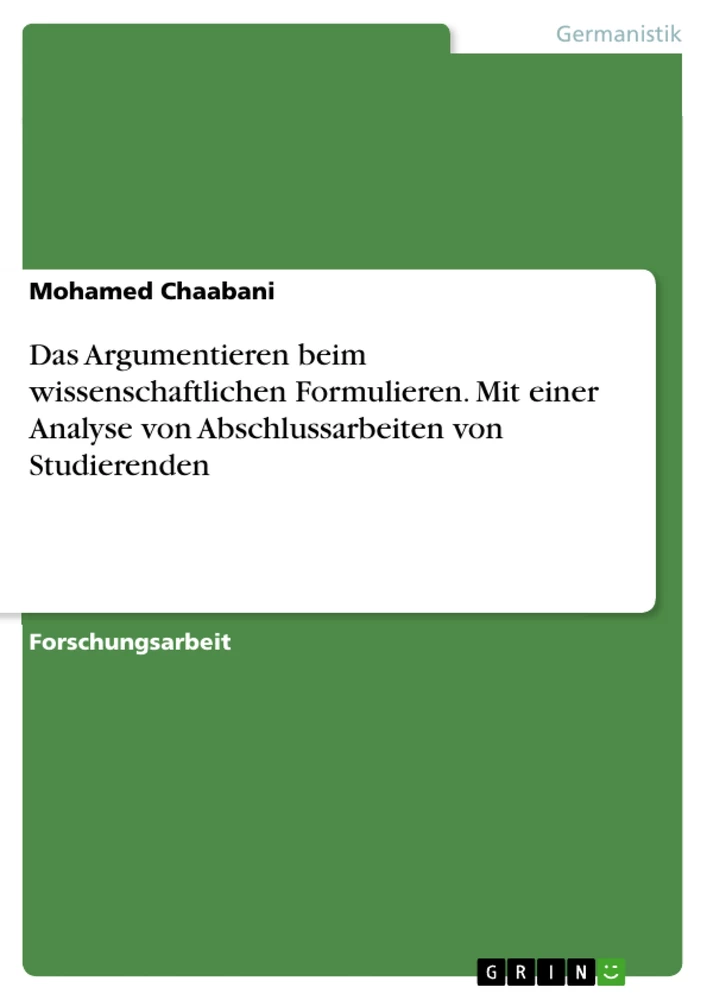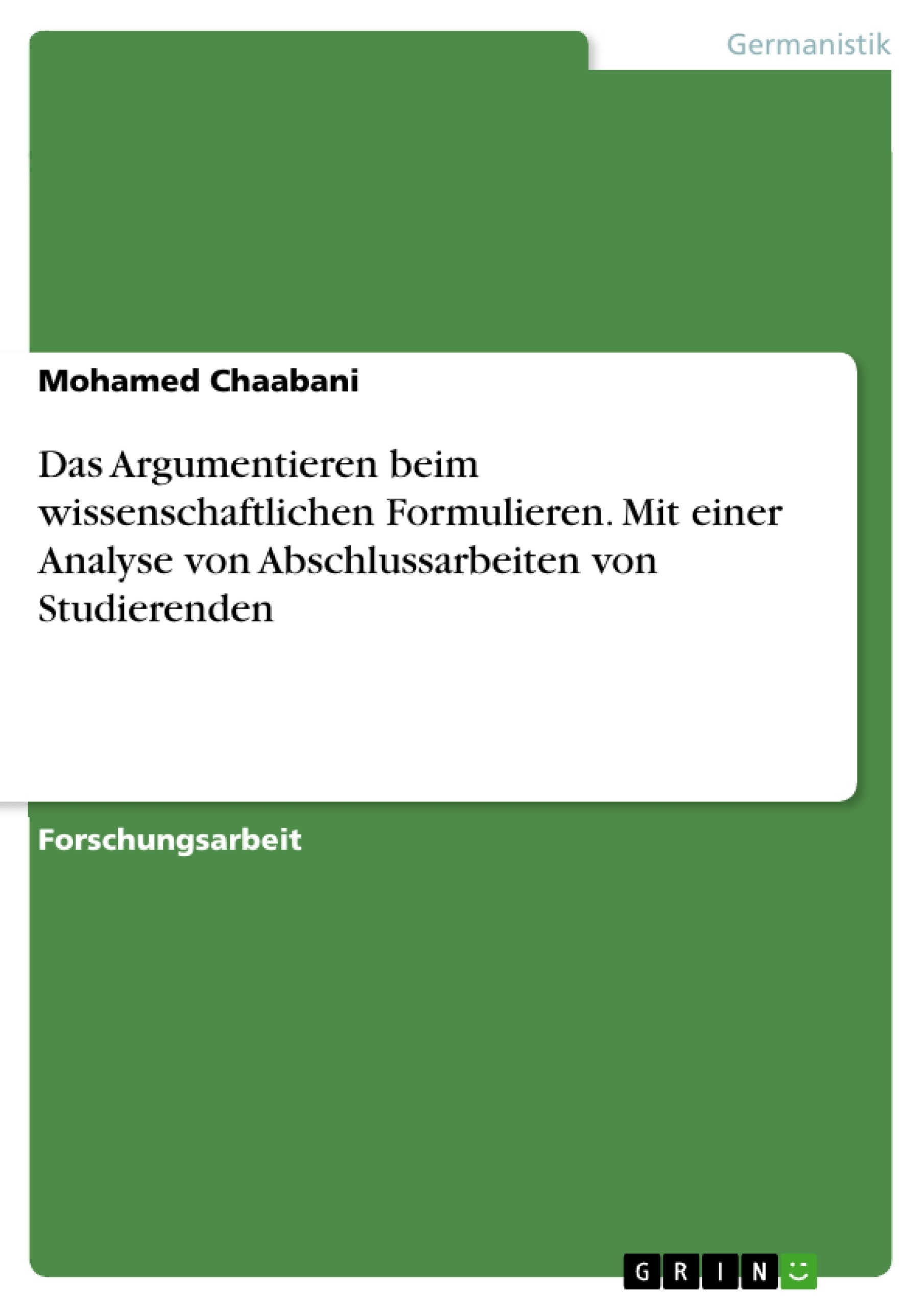Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit ist das Argumentieren beim wissenschaftlichen Formulieren. Anliegen der Arbeit ist es, Schwächen und Stärken der Studierenden hinsichtlich des Argumentierens zu untersuchen. Für diesen Zweck wurden Abschlussarbeiten, die von Germanistikstudenten verfasst wurden, analysiert. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zur Förderung vom wissenschaftlichen Schreiben bei den Studierenden leisten.
Das Argumentieren gab es laut Kruse, Otto (2010, 99) in der Antike im Bereich der Rhetorik. In dieser Zeit versuchte Aristoteles zwischen wissenschaftlichen Argumentieren und anderen Argumentationsarten zu differenzieren.
Zudem gibt es das mündliche und schriftliche Argumentieren. Schriftliche Argumentationen erfolgen konzessiv, Steinhoff (2007, 929). Dadurch erhalten Gegenmeinungen eine Stellung in der Arbeit. Im Anschluss dieser Gegenmeinungen erfolgt die eigene Meinung. Durch ein Argument kann man etwas von seiner Richtigkeit überzeugen. Es gibt in diesem Sinne als ein Grund.
Bei Brun, G., Hirsch Hadorn, G. (2009, 198) findet sich folgende Definition zur Argumentation:
„Eine Argumentation ist ein Text (Rede, Schreibe usw.) mit dem Ziel, die Zustimmung oder den Widerspruch von (wirklichen oder fiktiven) Gesprächspartnern zu einer Aussage (für beziehungsweise gegen deren Wahrheit argumentiert wird) durch den schrittweisen Rückgang auf bereits gemeinsam anerkannte Aussagen zu erreichen.
In einfachsten Fall, wenn eine Aussage unmittelbar durch andere Aussagen begründet wird, handelt es sich um ein Argument. Eine komplexe Argumentation besteht aus mehreren Argumenten.“
Inhaltsverzeichnis
- Zum Argumentieren beim wissenschaftlichen Formulieren
- Funktion des Argumentierens
- Argumentationsmuster
- Beschreibung und Interpretation
- Definition und Explikation
- Vermittlung von Fakten und Informationen
- Gang der Argumentation
- Prinzipien der Argumentation
- Die Typen von Argumenten
- Elemente der Argumentation
- Formen der Argumentation
- Analyse von Abschlussarbeiten
- Methodisch-didaktische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Stärken und Schwächen von Studierenden im wissenschaftlichen Argumentieren. Analysiert werden hierfür Abschlussarbeiten von Germanistikstudenten. Ziel ist es, Beiträge zur Verbesserung des wissenschaftlichen Schreibens bei Studierenden zu leisten.
- Argumentieren im wissenschaftlichen Kontext
- Analyse von Argumentationsmustern in wissenschaftlichen Texten
- Identifizierung von Stärken und Schwächen im studentischen Argumentieren
- Methodisch-didaktische Konsequenzen für die Lehre
- Funktionen des Argumentierens in der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Argumentieren beim wissenschaftlichen Formulieren: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Argumentierens, beginnend mit der Antike und der Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem und anderen Argumentationstypen. Es werden verschiedene Definitionen von Argumentation vorgestellt und die Unterscheidung zwischen mündlichem und schriftlichem Argumentieren (konzessiv bei schriftlichen Argumentationen) erläutert. Die Bedeutung der Überzeugungskraft von Argumenten und deren Funktion als Begründung wird hervorgehoben. Die Grundlage des Kapitels liegt in der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven und Definitionen zum Thema wissenschaftliches Argumentieren.
Funktion des Argumentierens: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Funktionen des Argumentierens in wissenschaftlichen Arbeiten. Es werden verschiedene Autoren zitiert, die die Funktion des Argumentierens als Mittel zur Einigung über strittige Aussagen, zur Klärung der Wahrheit von Aussagen, zur Nachvollziehbarkeit von Gedankengängen, zur Überzeugung und zur Erklärung definieren. Die soziale Dimension des Argumentierens, also die Interaktion mit den Meinungen anderer, wird ebenfalls betont. Das Kapitel unterstreicht die Vielschichtigkeit der Funktion von Argumentation in der wissenschaftlichen Kommunikation.
Argumentationsmuster: In diesem Kapitel werden sieben Argumentationsmuster für den Hauptteil wissenschaftlicher Arbeiten vorgestellt. Die Muster umfassen Beschreibung und Interpretation (mit Fokus auf Paraphrase und Interpretation von Texten), Definition und Explikation (mit Betonung der Notwendigkeit von klaren und konsistenten Definitionen), sowie die Vermittlung von Fakten und Informationen. Jedes Muster wird kurz erläutert und mit Hinweisen zur korrekten Anwendung in wissenschaftlichen Texten versehen. Das Kapitel bietet eine strukturierte Übersicht über verschiedene Ansätze wissenschaftlichen Argumentierens.
Schlüsselwörter
Wissenschaftliches Argumentieren, Argumentationsmuster, Argumentationsanalyse, wissenschaftliches Schreiben, Studierende, Abschlussarbeiten, Germanistik, Methodisch-didaktische Konsequenzen, Überzeugungskraft, Begründung, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse wissenschaftlichen Argumentierens in Abschlussarbeiten
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Diese Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen von Studierenden im wissenschaftlichen Argumentieren, basierend auf der Auswertung von Abschlussarbeiten im Fach Germanistik. Das Ziel ist die Verbesserung des wissenschaftlichen Schreibens bei Studierenden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des wissenschaftlichen Argumentierens, darunter die Funktion des Argumentierens, verschiedene Argumentationsmuster (Beschreibung/Interpretation, Definition/Explikation, Vermittlung von Fakten), den Gang der Argumentation, Prinzipien und Typen von Argumenten, sowie methodisch-didaktische Konsequenzen für die Lehre.
Welche Argumentationsmuster werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf sieben Argumentationsmuster, die für den Hauptteil wissenschaftlicher Arbeiten relevant sind: Beschreibung und Interpretation (mit Fokus auf Paraphrase und Interpretation von Texten), Definition und Explikation (mit Betonung der Notwendigkeit von klaren und konsistenten Definitionen), sowie die Vermittlung von Fakten und Informationen. Jedes Muster wird erläutert und mit Hinweisen zur korrekten Anwendung versehen.
Wie wird die Forschungsarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Zum Argumentieren beim wissenschaftlichen Formulieren; Funktion des Argumentierens; Argumentationsmuster; Gang der Argumentation; Prinzipien der Argumentation; Die Typen von Argumenten; Elemente der Argumentation; Formen der Argumentation; Analyse von Abschlussarbeiten; Methodisch-didaktische Konsequenzen. Zusätzlich gibt es eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die methodisch-didaktischen Konsequenzen der Studie?
Die Studie zielt darauf ab, methodisch-didaktische Konsequenzen für die Lehre abzuleiten. Die Ergebnisse der Analyse der studentischen Arbeiten sollen dazu beitragen, das wissenschaftliche Schreiben und Argumentieren bei Studierenden zu verbessern. Konkrete didaktische Maßnahmen werden jedoch nicht explizit in den bereitgestellten Informationen genannt.
Welche Arten von Argumenten werden betrachtet?
Die bereitgestellten Informationen benennen zwar "Die Typen von Argumenten" als Kapitelüberschrift, geben aber keine detaillierte Auflistung der betrachteten Argumenttypen. Weitere Informationen wären nötig, um diese Frage detailliert zu beantworten.
Auf welche Art von Texten basiert die Analyse?
Die Analyse basiert auf Abschlussarbeiten von Studierenden der Germanistik. Diese Arbeiten dienen als Grundlage zur Untersuchung des wissenschaftlichen Argumentierens bei Studierenden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wissenschaftliches Argumentieren, Argumentationsmuster, Argumentationsanalyse, wissenschaftliches Schreiben, Studierende, Abschlussarbeiten, Germanistik, methodisch-didaktische Konsequenzen, Überzeugungskraft, Begründung, Textanalyse.
- Citar trabajo
- Mag. Mohamed Chaabani (Autor), 2014, Das Argumentieren beim wissenschaftlichen Formulieren. Mit einer Analyse von Abschlussarbeiten von Studierenden, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276642