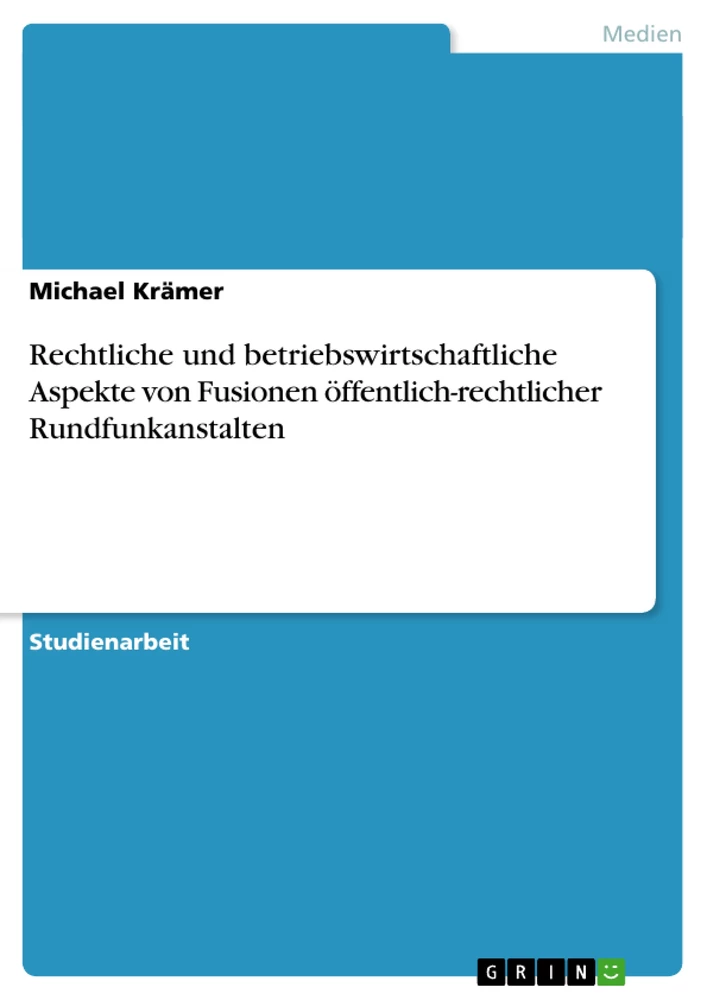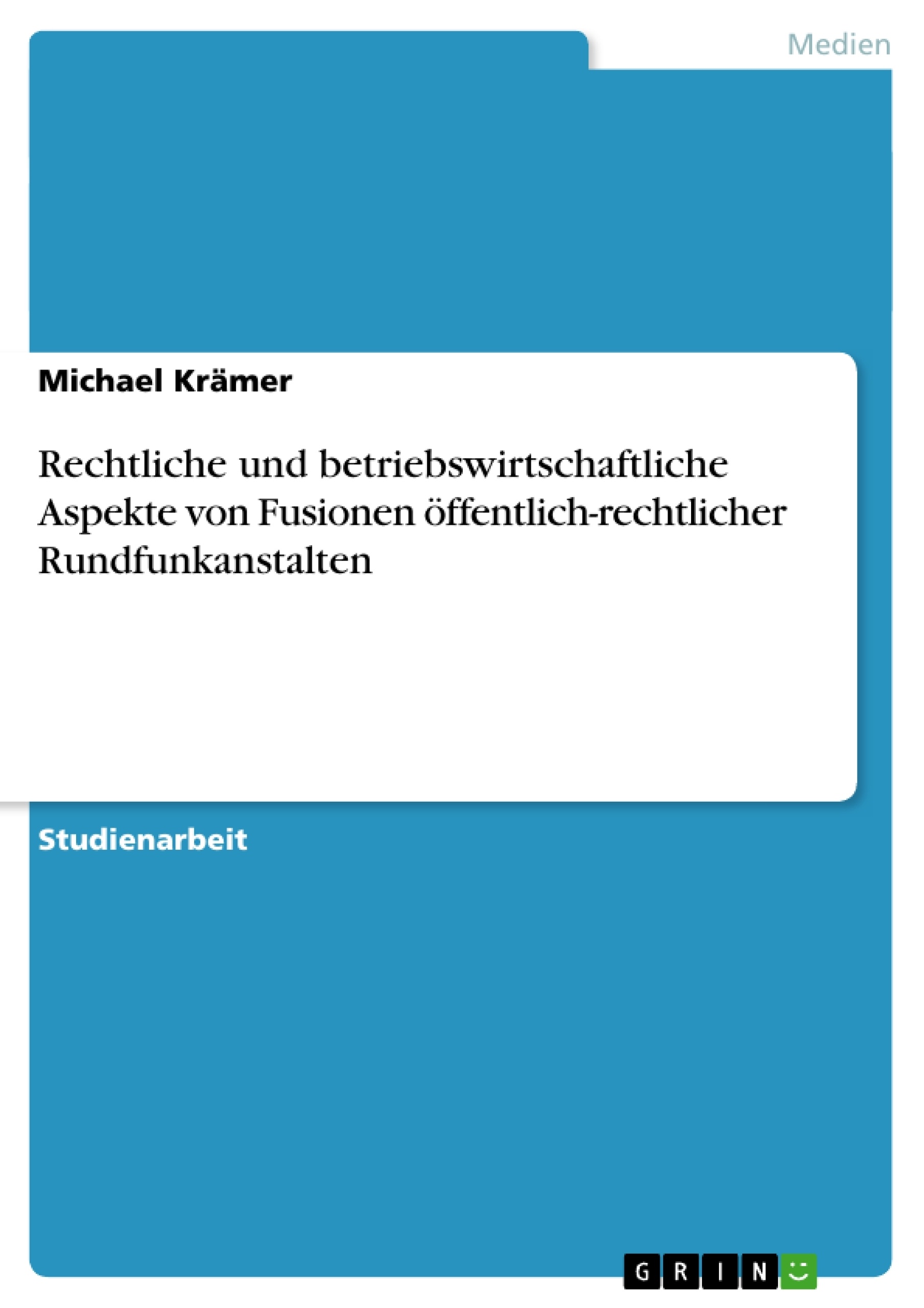Mit der Fusion des Senders Freies Berlin und des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg zum Rundfunk Berlin-Brandenburg zum 1. Mai 2003 wurde mittlerweile die zweite Fusion innerhalb der öffentlich-rechtlichen Rundfunklandschaft Deutschlands vollzogen. Fusionen von Rundfunkanstalten als Maßnahme der Strukturreform zur Sicherung der zukünftigen Konkurrenzfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind Thema dieser Arbeit.
Im Folgenden wird zunächst beschrieben, wie die Organisationsstruktur, wie man sie heute kennt, entstand und welche Probleme sich daraus in Bezug auf die gegenwärtige Wirtschaftslage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ergeben. Eine Beschreibung möglicher Restrukturierungsmodelle sowie die nähere Betrachtung zweier schon vollzogener Fusionen geben weiterhin einen Überblick über die Maßnahmen, die von den Fusionspartnern im Zuge der Neuordnung ergriffen wurden. Die abschließend detailliert beschriebenen und analysierten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte von Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten können, wie man leicht erkennen wird, größtenteils in den von SWR und RBB ergriffenen Maßnahmen wiedergefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- 2.1 Entstehungsgeschichte der heutigen Organisationsstruktur
- 2.2 Strukturelle Probleme
- 3. Strukturreform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
- 3.1 Konzepte und Meinungen zur Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Rundfunklandschaft
- 3.2 SWR & RBB - Portraits zweier fusionierter Rundfunkanstalten
- 3.2.1 SWF SDR = SWR
- 3.2.2 ORB + SFB = RBB
- 3.3 Betriebswirtschaftliche Aspekte einer Fusion im Überblick
- 3.3.1 Wirtschaftliche Voraussetzungen
- 3.3.2 Zentral oder Dezentral
- 3.3.3 Synergieeffekte
- 3.4 Rechtliche Aspekte von Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
- 3.4.1 Entscheidungsträger einer Fusion
- 3.4.2 Die Standortfrage
- 3.4.3 Aufgaben einer fusionierten Rundfunkanstalt
- 4. Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland als Reaktion auf strukturelle Probleme und den steigenden Kostendruck. Die Zielsetzung ist es, die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte solcher Fusionen zu analysieren und anhand von Beispielen (SWR und RBB) zu illustrieren.
- Entstehung und Entwicklung der Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Strukturelle Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, insbesondere finanzielle Ungleichgewichte
- Betriebswirtschaftliche Aspekte von Fusionen (Wirtschaftlichkeit, Zentralisierung/Dezentralisierung, Synergieeffekte)
- Rechtliche Aspekte von Fusionen (Entscheidungsträger, Standortfrage, Aufgaben der fusionierten Anstalt)
- Fallstudien: SWR und RBB als Beispiele für Fusionen und deren Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland, insbesondere am Beispiel der Fusion von SFB und ORB zum RBB. Sie fokussiert auf die Notwendigkeit von Strukturreformen zur Sicherung der zukünftigen Konkurrenzfähigkeit im Kontext des zunehmenden Kostendrucks und des Wettbewerbs mit privaten Anbietern. Die Arbeit verspricht eine Analyse der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte von solchen Fusionen, die anhand der Beispiele SWR und RBB veranschaulicht werden.
2. Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte der aktuellen Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Es zeigt den starken Einfluss der alliierten Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg auf die dezentrale, regional begrenzte Struktur, die sich aus den Besatzungszonen und den unterschiedlichen Modellen der Besatzungsmächte ergab. Die Entwicklung der Anstalten nach dem Krieg, die Gründung des SFB und die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung auf die Rundfunklandschaft werden detailliert dargestellt. Der Abschnitt hebt die daraus resultierenden strukturellen Probleme hervor, insbesondere die Ungleichgewichte zwischen großen und kleinen Anstalten aufgrund unterschiedlicher Bevölkerungszahlen und Rundfunkgebühren-Einnahmen.
3. Strukturreform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konzepten und Meinungen zur Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Rundfunklandschaft. Es analysiert die Notwendigkeit von Strukturreformen, die durch Fusionen von Anstalten eine ausgewogenere Größenstruktur schaffen sollen. Die Kapitelteile zu SWR und RBB dienen als Fallstudien, die die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte solcher Fusionen detailliert untersuchen. Die Analyse umfasst wirtschaftliche Voraussetzungen, die Frage nach Zentralisierung oder Dezentralisierung, Synergieeffekte und rechtliche Herausforderungen wie die Bestimmung von Entscheidungsträgern, die Standortfrage und die Aufgaben der fusionierten Anstalt.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fusionen, Strukturreform, ARD, Betriebswirtschaft, Recht, Konkurrenzfähigkeit, Kostendruck, Finanzierung, Regionalisierung, SWR, RBB, Dezentralisierung, Zentralisierung, Synergieeffekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland. Sie untersucht die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte solcher Fusionen und illustriert diese anhand der Beispiele SWR (aus SWF und SDR) und RBB (aus ORB und SFB).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Notwendigkeit von Strukturreformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgrund von strukturellen Problemen und steigendem Kostendruck zu belegen. Sie analysiert die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen von Fusionen und zeigt anhand von Fallbeispielen deren Umsetzung auf.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, strukturelle Probleme wie finanzielle Ungleichgewichte, betriebswirtschaftliche Aspekte von Fusionen (Wirtschaftlichkeit, Zentralisierung/Dezentralisierung, Synergieeffekte), rechtliche Aspekte (Entscheidungsträger, Standortfrage, Aufgaben der fusionierten Anstalt) und Fallstudien zu SWR und RBB.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Organisationsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Kapitel zur Strukturreform mit detaillierten Fallstudien zu SWR und RBB, und ein Fazit/Ausblick. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche strukturellen Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden angesprochen?
Die Arbeit hebt insbesondere finanzielle Ungleichgewichte zwischen großen und kleinen Anstalten aufgrund unterschiedlicher Bevölkerungszahlen und Rundfunkgebühren-Einnahmen hervor. Diese Ungleichgewichte resultieren aus der historischen Entwicklung und der dezentralen Struktur des Systems.
Welche betriebswirtschaftlichen Aspekte werden im Detail betrachtet?
Die betriebswirtschaftliche Analyse umfasst die Wirtschaftlichkeit von Fusionen, die Frage nach der optimalen Organisationsstruktur (Zentralisierung vs. Dezentralisierung) und die Erzielung von Synergieeffekten.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Herausforderungen von Fusionen, darunter die Bestimmung der Entscheidungsträger, die Frage nach dem Standort der fusionierten Anstalt und die Definition der Aufgaben der neuen Anstalt.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus den Fallstudien zu SWR und RBB?
Die Fallstudien zu SWR und RBB dienen als Beispiele für die praktische Umsetzung von Fusionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und illustrieren die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen und Chancen solcher Zusammenschlüsse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fusionen, Strukturreform, ARD, Betriebswirtschaft, Recht, Konkurrenzfähigkeit, Kostendruck, Finanzierung, Regionalisierung, SWR, RBB, Dezentralisierung, Zentralisierung, Synergieeffekte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Medienökonomie, Medienrecht und Strukturreformen im öffentlichen Sektor beschäftigen. Sie ist insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Fachleute im Bereich des Rundfunks von Interesse.
- Citation du texte
- Michael Krämer (Auteur), 2003, Rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte von Fusionen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27737