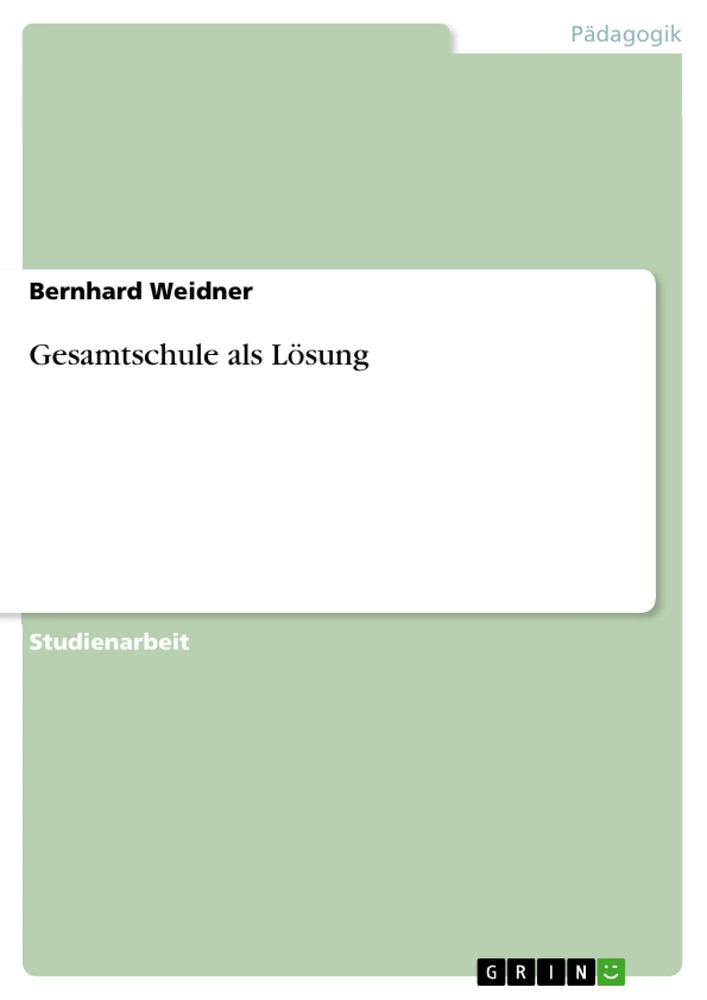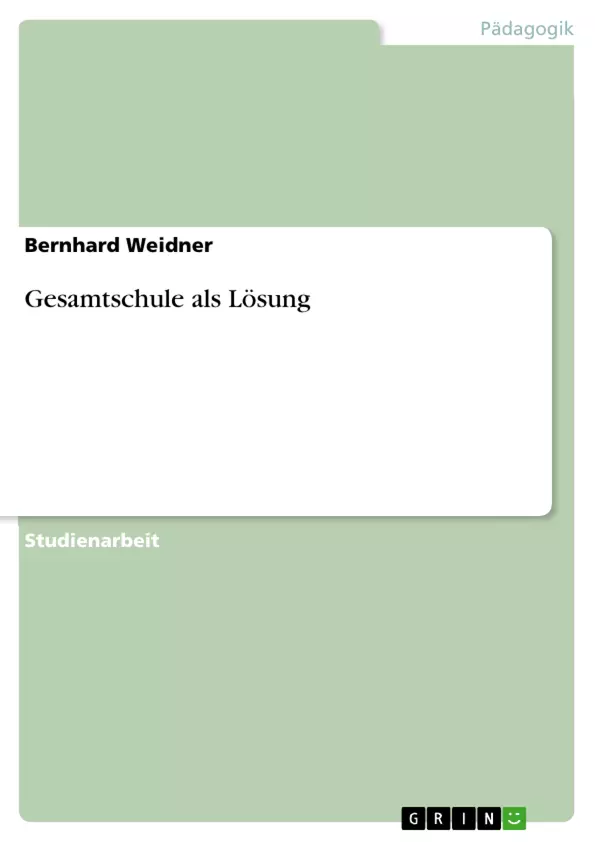Als Helmut Schelsky 1959 dem Schulsystem mit dessen Einstufung als „Zuteilungsapparatur von Lebenschancen“ einen defizitären und unsozialen Charakter attestierte, befand sich Deutschland inmitten einer intensiven pädagogischen Diskussion und einer Phase der Umwälzungen in der Schulentwicklung. Nicht nur die vertikale Gliederung des Schulsystems wurde in Frage gestellt, auch die Unterrichtsprinzipien und Methoden standen im Fokus der Reformbefürworter.
Eine Möglichkeit, um der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit Rechnung zu tragen, schien die Einrichtung von Gesamtschulen - einer Schule für alle. Im Jahr 1968 wurden in Deutschland die ersten Gesamtschulen gegründet, und in den folgenden Jahren flächendeckende Schulversuche mit 40 Gesamtschulen in ganz Deutschland durchgeführt. Diese Schulkonzeption wurde im Modellversuch schwerpunktmäßig in den Jahren 1971-1976 deutschlandweit erprobt und ausgewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden je nach parteipolitischer Ausrichtung der Regierung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich interpretiert und als erfolgreich eingestuft oder umgekehrt als gescheitert erklärt. Die Tatsache, dass es schon immer „politischen Machtverhältnisse gewesen sind, die einer Schulstruktur eine Chance gaben oder nicht“ erklärt dieses dogmatisch geschiedene Meinungsbild: Ihre Befürworter glauben, sie fördere die Schwachen, wohingegen die Gegner der Gesamtschule ihre Gleichmacherei verteufeln. Entsprechend der regierenden Partei wurden die Gesamtschulprojekte weitergeführt, oder weitestgehend abgeschafft.
Die Diskussion ist jedoch weiterhin im Gange und bleibt aktuell: In den vergangenen Jahren wurde der Einschätzung, ¸¸dass unser dreigliederiges Schulsystem in hohem Maße ungerecht ist" , mit Studien, die belegen sollen, dass die Gesamtschuleinführung folgenlos war und Bildung je nach dem bildungsfernem bzw. –nahem Milieu entsprechend vererbt wird , eine weitere Facette hinzugefügt: Auch die Gesamtschule löst die Bildungsmisere scheinbar nicht. Je nach Lesart, lassen sich Meinungen finden, die der Gesamtschule Wirkungslosigkeit in einem ihrer Kernziele, der Chancengleichheit, attestieren oder die Schule der Zukunft identifiziert zu haben glauben.
Die vorliegende Arbeit versucht, das vorherrschende Meinungskonglomerat zu entwirren, Erfahrungen und Konzepte zu beschreiben und sofern möglich auch zu bewerten. Neben den Zielen der Gesamtschule sind die Möglichkeiten und Grenzen der Gesamtschule Untersuchungsgegen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesamtschule als Lösung?
- 2.1 Entwicklung der Gesamtschulkonzepte
- 2.1.1 Ältere Gesamtschulvorstellungen
- 2.1.2 Neuere Gesamtschulvorstellungen
- 2.1.2.1 Westdeutschland
- 2.1.2.2 Ostdeutschland
- 2.2 Die Gesamtschuldiskussion – Hintergründe
- 2.2.1 Ausgangslage
- 2.2.2 Probleme im gegliederten Schulwesen
- 2.2.3 Vision Gesamtschule - eine Schule für alle
- 2.3 Die Gesamtschulkonzeption
- 2.4 Die Gesamtschultypen
- 2.4.1 Integrierte Gesamtschule
- 2.4.2 Kooperative Gesamtschule
- 2.5 Schulversuche mit Gesamtschulen
- 2.6 Etappe einer Konfliktentwicklung: 1982
- 2.7 Gesamtschule in Bayern
- 2.8 Gesamtschule – was kann sie denn nun?
- 2.8.1 Möglichkeiten der Gesamtschule
- 2.8.1.1 Was ist machbar
- 2.8.1.2 Eine Musterschule: Die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim
- 2.8.2 Grenzen der Gesamtschule
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung des Gesamtschulkonzepts in Deutschland im Kontext der pädagogischen Diskussion und der gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Sie setzt sich zum Ziel, die historischen Hintergründe, die Konzeption und die verschiedenen Typen von Gesamtschulen sowie die aktuellen Debatten um die Gesamtschule zu beleuchten und zu bewerten. Dabei werden die Chancen und Grenzen der Gesamtschule im Hinblick auf die Chancengleichheit und die Qualität der Bildung diskutiert.
- Entwicklung und historische Hintergründe des Gesamtschulkonzepts
- Chancen und Grenzen der Gesamtschule
- Die Gesamtschuldebatte in Deutschland
- Analyse von verschiedenen Gesamtschultypen
- Die Gesamtschule im Vergleich zum gegliederten Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die pädagogische Diskussion im Nachkriegsdeutschland und stellt die Gesamtschule als eine mögliche Lösung für die Probleme des gegliederten Schulsystems vor. Das Kapitel 2.1 geht auf die historischen Entwicklungen des Gesamtschulkonzepts ein, beginnend bei den älteren Vorstellungen von Comenius und Humboldt bis hin zu den neuere Konzepten in West- und Ostdeutschland. Die Kapitel 2.2 bis 2.4 fokussieren sich auf die Konzeption, die unterschiedlichen Gesamtschultypen und die Schulversuche in Deutschland. Kapitel 2.6 untersucht eine Etappe der Konfliktentwicklung im Jahr 1982, während Kapitel 2.7 einen Blick auf die Situation der Gesamtschule in Bayern wirft. Das Kapitel 2.8 schließlich beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der Gesamtschule im Detail.
Schlüsselwörter
Gesamtschule, Schulreform, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, gegliedertes Schulsystem, Einheitsschule, Polytechnische Oberschule, Differenzierter Mittelbau, Schulversuche, Robert-Bosch-Gesamtschule, Hildesheim.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Vision hinter dem Gesamtschulkonzept?
Die Vision war eine „Schule für alle“, die soziale Gerechtigkeit fördert und die Selektion nach der vierten Klasse aufhebt, um Bildungschancen vom sozialen Status zu entkoppeln.
Was ist der Unterschied zwischen integrierter und kooperativer Gesamtschule?
In der integrierten Gesamtschule werden alle Schüler gemeinsam unterrichtet, während in der kooperativen Form die Schulzweige (Haupt-, Real-, Gymnasium) unter einem Dach nebeneinander bestehen.
Warum steht das dreigliedrige Schulsystem in der Kritik?
Kritiker wie Helmut Schelsky bezeichneten es als „Zuteilungsapparatur von Lebenschancen“, da es soziale Ungleichheiten eher verfestigt als abbaut.
Löst die Gesamtschule das Problem der Bildungsgerechtigkeit?
Studien liefern hierzu unterschiedliche Ergebnisse; einige attestieren ihr Erfolg, andere sehen Bildung nach wie vor stark vom Elternhaus abhängig („Vererbung von Bildung“).
Welche Rolle spielt die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim?
Sie wird in der Arbeit als Musterschule herangezogen, um zu zeigen, was im Rahmen einer gut geführten Gesamtschulkonzeption machbar ist.
- Citar trabajo
- Bernhard Weidner (Autor), 2010, Gesamtschule als Lösung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277505