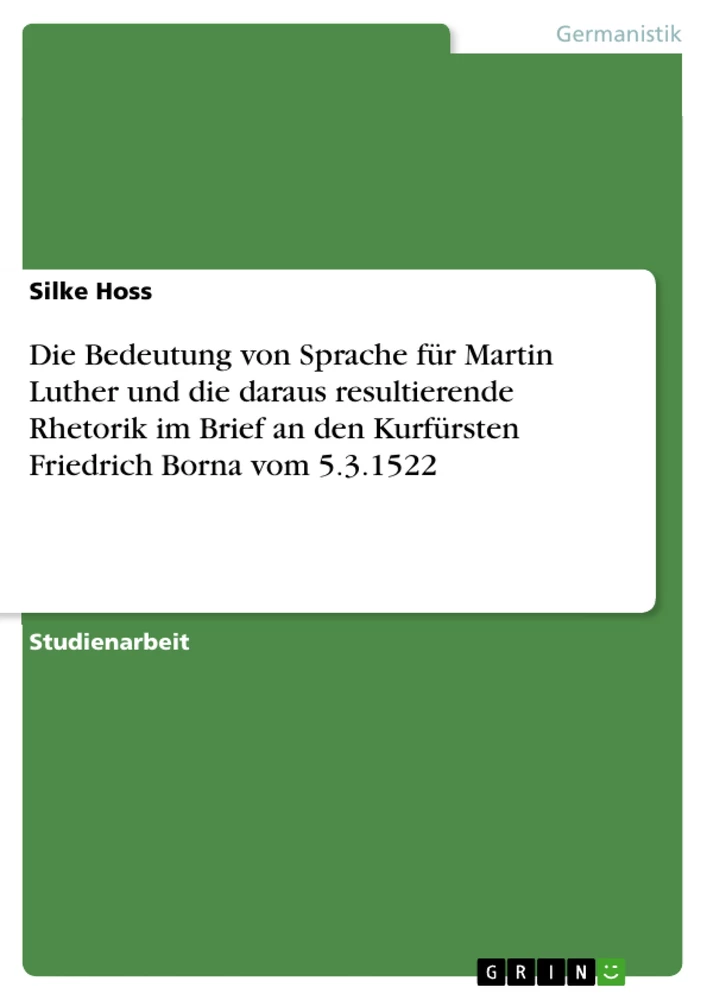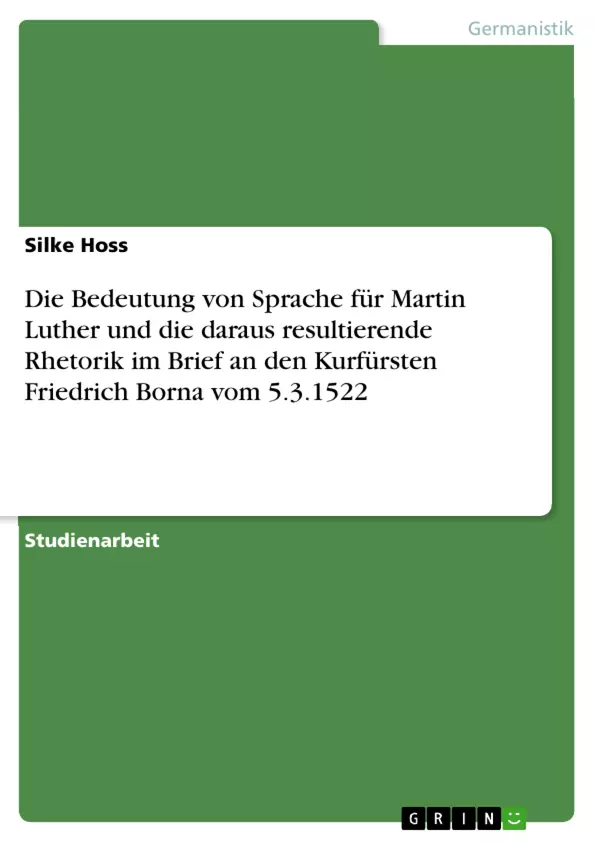Der vorliegende Brief stammt aus einer Zeit, in der das Leben Martin Luthers sich wieder beruhigt hatte. Zuvor musste er sich wiederholt seinen Widersachern entgegenstellen.
Im Jahr 1520 werden in Köln und Mainz öffentlich die Schriften von Martin Luther verbrannt.
Im November 1520 verlangt Kaiser Karl V von seinem Onkel Friedrich III, Luther zum Wormser Reichstag zu entsenden, damit dieser sich dort öffentlich zu den Vorwürfen äußert.
Luther erhält auf Drängen von Friedrich dem Weisen freies Geleit nach Worms und sagt aus.
Am 3. Januar 1521 spricht Papst Leo X in der Bulle Decet Romanum pontificem den Bann gegen Luther aus.
Am 17. April 1921 findet die Verhandlung statt, bei welcher Luther sein Handeln rechtfertigen und seine Schriften erläutern will, jedoch von seinen Anklägern kaum angehört wird. Im Anschluss an die Verhandlung verweigert Luther eine Widerrufung seiner Thesen und muss sich mit Hilfe von Friedrich III unter einem anderen Namen auf der Wartburg verstecken.
In dieser Zeit entstehen zahlreiche Schriften und Predigten sowie innerhalb von nur elf Wochen die Übersetzung des Neuen Testaments.
Nach zehn Monaten kehrt er im März 1522 wieder nach Wittenberg zurück, nimmt seine Vorlesungen und Lehren wieder auf und betritt abermals seine Kanzel, um zu predigen. Da sein Kurfürst zulässt, dass sich die Dinge entwickeln, führen ihn sein Bekanntheitsgrad und seine Predigten unter anderem nach Zwickau, Altenburg und Borna. In Borna steht er im regen Briefwechsel mit seinem Kurfürsten Friedrich III.
Inhaltsverzeichnis
- Übersetzung
- Einleitung
- Historische Einordnung
- Friedrich der Weise
- Kommentar zur Übersetzung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text "An den Kurfürsten Friedrich" von Martin Luther aus dem Jahr 1522 ist ein Brief, der an den Kurfürsten Friedrich von Sachsen gerichtet ist. Luther versucht in diesem Brief, den Kurfürsten von seiner eigenen Position im Konflikt mit Herzog Georg von Sachsen zu überzeugen und ihn gleichzeitig zu beruhigen. Der Brief ist ein wichtiges Zeugnis für Luthers theologische und politische Überzeugungen sowie für die schwierige Situation der Reformation in dieser Zeit.
- Luthers Verteidigung seiner eigenen Position im Konflikt mit Herzog Georg
- Die Bedeutung des Evangeliums für Luther
- Luthers Verhältnis zum Kurfürsten Friedrich
- Die Rolle der Obrigkeit in der Reformation
- Luthers Glaube an Gott und seine Macht
Zusammenfassung der Kapitel
In der Übersetzung des Briefes an den Kurfürsten Friedrich, der am 5. März 1522 in Borna verfasst wurde, äußert sich Luther zu den jüngsten Ereignissen in Wittenberg und versucht, den Kurfürsten von seiner eigenen Position zu überzeugen. Er betont, dass er das Evangelium nicht von Menschen, sondern von Gott empfangen hat und dass er sich als Knecht und Evangelist versteht. Luther erklärt, dass er sich zum Verhör und Gericht erboten hat, um andere zu locken, aber nun sieht er, dass seine Demut zur Erniedrigung des Evangeliums führt. Er betont, dass er dem Kurfürsten bereits genug Dienste erwiesen hat und dass er sich nicht von Herzog Georg einschüchtern lassen wird. Luther appelliert an den Kurfürsten, ihm zu helfen, das Urteil von Herzog Georg abzuwenden, und er betont, dass er in einem höheren Schutz als dem des Kurfürsten steht. Er fordert den Kurfürsten auf, sich nicht von Herzog Georg beeinflussen zu lassen und ihm nicht zu schaden. Luther schließt den Brief mit der Bitte um Gottes Gnade und der Hoffnung, dass der Kurfürst Gottes Herrlichkeit sehen wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Evangelium, die Reformation, den Konflikt mit Herzog Georg, die Rolle der Obrigkeit, Luthers Glaube an Gott und seine Macht, die Bedeutung der Demut und die Bedeutung des Dienstes. Der Text beleuchtet die schwierige Situation der Reformation in dieser Zeit und Luthers Bemühungen, seine Position zu verteidigen und gleichzeitig den Kurfürsten Friedrich zu beruhigen.
Häufig gestellte Fragen
Warum schrieb Martin Luther 1522 einen Brief an Kurfürst Friedrich?
Luther wollte den Kurfürsten von seiner Position im Konflikt mit Herzog Georg von Sachsen überzeugen und ihn beruhigen, nachdem er nach zehn Monaten auf der Wartburg nach Wittenberg zurückgekehrt war.
Was war Luthers Selbstverständnis laut diesem Brief?
Luther betonte, dass er das Evangelium direkt von Gott empfangen habe und sich als Knecht und Evangelist verstehe. Er sah sich in einem höheren Schutz stehend als dem der weltlichen Obrigkeit.
In welcher historischen Situation befand sich Luther zu dieser Zeit?
Nach dem Wormser Reichstag 1521 stand Luther unter dem Kirchenbann und der Reichsacht. Er hatte sich als „Junker Jörg“ auf der Wartburg versteckt und dort das Neue Testament übersetzt.
Wie war das Verhältnis zwischen Luther und Friedrich dem Weisen?
Friedrich der Weise war Luthers Schutzherr, der ihn vor dem Zugriff des Kaisers und des Papstes bewahrte. Luther appellierte in seinem Brief an diese Schutzfunktion, betonte aber gleichzeitig seine religiöse Unabhängigkeit.
Welche Rolle spielte Herzog Georg von Sachsen in diesem Konflikt?
Herzog Georg war ein entschiedener Gegner der Reformation. Luther versuchte im Brief, den Kurfürsten davor zu bewahren, sich von den Drohungen oder dem Urteil des Herzogs beeinflussen zu lassen.
- Quote paper
- Silke Hoss (Author), 2009, Die Bedeutung von Sprache für Martin Luther und die daraus resultierende Rhetorik im Brief an den Kurfürsten Friedrich Borna vom 5.3.1522, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277546