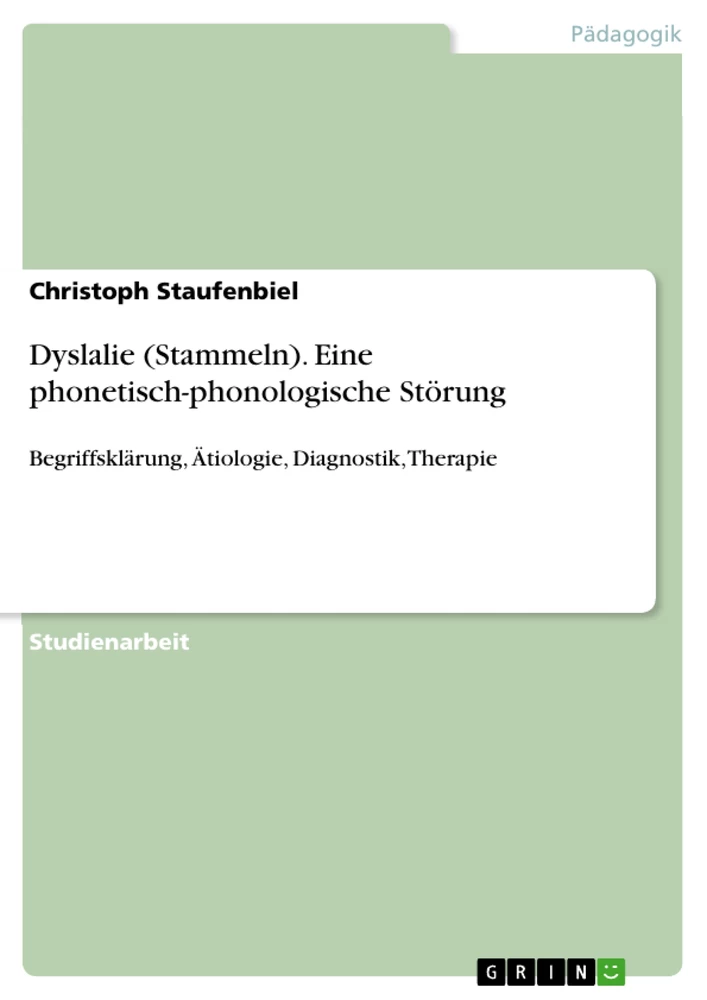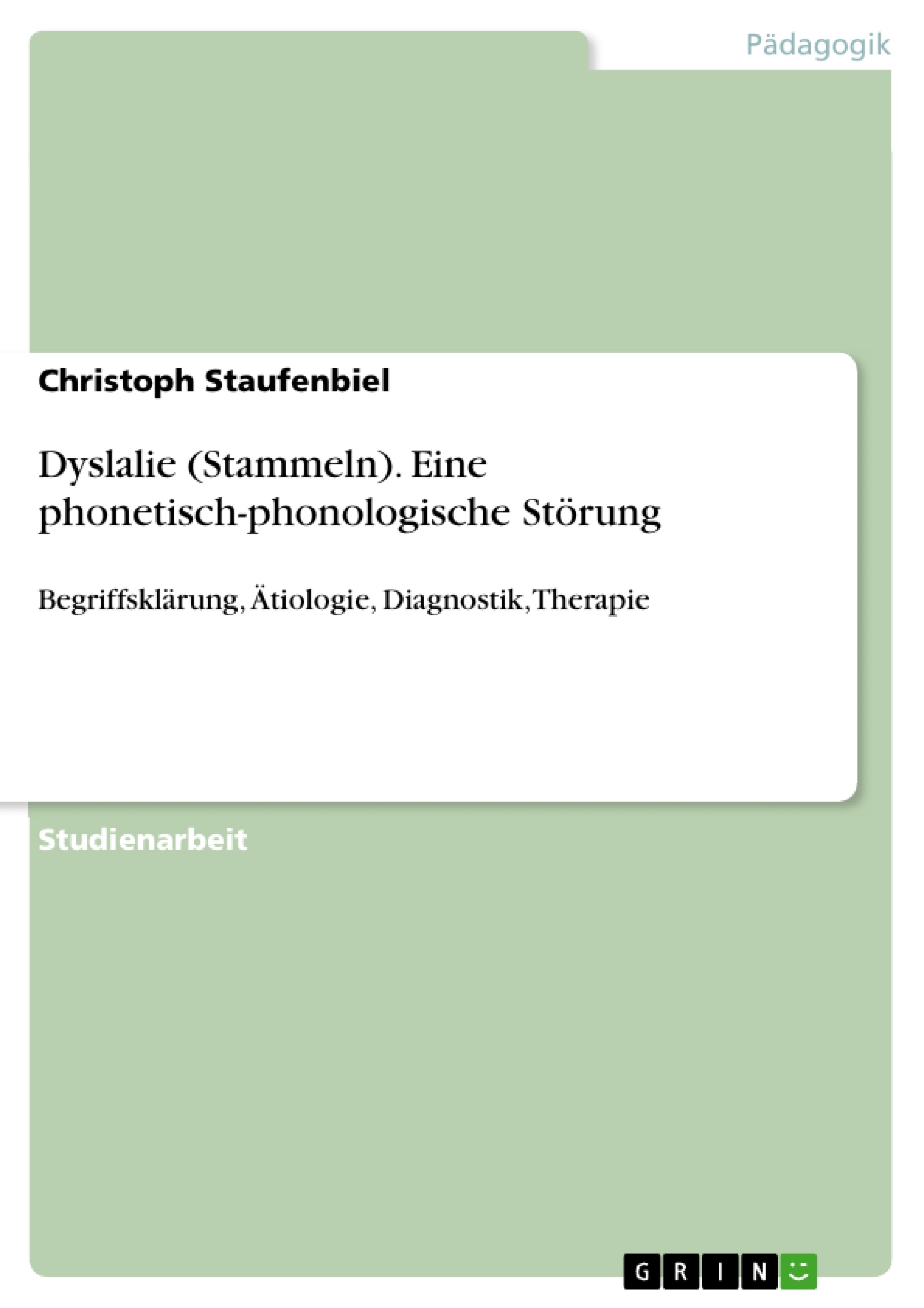Es gibt in der Sprachbehindertenpädagogik unterschiedliche Sprach- und Sprechstörungen, die klassifiziert werden. Diese Hausarbeit handelt im kurzen von der Thematik der Dyslalie. Die Dyslalie gehört zu den phonetisch-phonologischen Sprechstörungen. In aktuellerer Literatur wird das Wort Dyslalie manchmal mit dem Wort phonetisch- phonologischen Sprechstörung ersetzt. Stammeln war eine ältere Bezeichnung für das Wort Dyslalie.
Diese Hausarbeit stellt einen Überblick dar, zunächst angefangen in Kapitel 2 mit den unterschiedlichen Begriffsklärungen, wie Sprache, Sprachstörung, Strukturebenen der Sprache und die Kommunikationsbehinderung. Danach folgt in Kapitel 3 der Hauptteil der Hausarbeit die Dyslalie, welche sich gliedert in die Definition, die Merkmale, die Einteilungsmöglichkeiten, die Diagnostikverfahren und die Therapiemöglichkeiten.
Ein Fazit befindet sich in Kapitel 4 und das Literatur- und Quellenverzeichnis in Kapitel 5.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Sprache
- Sprachstörung, Sprachbehinderung und Kommunikationsbehinderung
- Strukturebenen der Sprache
- Dyslalie
- Definition
- Merkmale von Dyslalie
- Einteilung von Dyslalie
- Diagnostik
- Therapiemöglichkeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen Überblick über das Thema Dyslalie (Stammeln), eine phonetisch-phonologische Sprechstörung. Ziel ist es, die Begrifflichkeiten zu klären und einen Einblick in Ätiologie, Diagnostik und Therapie zu geben.
- Begriffsklärung der Begriffe Sprache, Sprachstörung und Kommunikationsbehinderung
- Definition und Merkmale von Dyslalie
- Einteilung und Diagnostik von Dyslalie
- Möglichkeiten der Dyslalie-Therapie
- Zusammenhang zwischen den verschiedenen Strukturebenen der Sprache und Dyslalie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Dyslalie ein und beschreibt den Aufbau der Hausarbeit. Es wird der Unterschied zwischen den Begriffen Dyslalie, phonetisch-phonologische Sprechstörung und Stammeln kurz erläutert und die Struktur der Arbeit vorgestellt, welche die Begriffsklärung, die Dyslalie selbst mit ihren Merkmalen, der Diagnostik und Therapiemöglichkeiten umfasst, bevor sie mit einem Fazit endet.
Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Sprache, wobei verschiedene Definitionen von Linguisten wie Edward Sapir, Noam Chomsky und Robert Anderson Hall vorgestellt und verglichen werden. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen werden hervorgehoben, wobei der Fokus auf Kommunikation mittels symbolischer Systeme und strukturellen Aspekten liegt. Der Abschnitt erweitert sich auf die Unterscheidung zwischen Sprachstörung, Sprachbehinderung und Kommunikationsbehinderung nach Knura und Braun, wobei die individuellen Ursachen und Auswirkungen dieser Störungen betont werden.
Dyslalie: Dieser zentrale Teil der Arbeit definiert Dyslalie, beschreibt ihre Merkmale und verschiedene Einteilungsmöglichkeiten. Es werden unterschiedliche Ausprägungen der Störung und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Lautbildung detailliert erklärt. Der Abschnitt beschreibt diagnostische Verfahren zur Erkennung von Dyslalie und verschiedene therapeutische Ansätze zur Behandlung der Störung. Die Zusammenhänge zwischen den Strukturebenen der Sprache und den Auswirkungen von Dyslalie werden ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Dyslalie, Stammeln, phonetisch-phonologische Sprechstörung, Sprachstörung, Sprachbehinderung, Kommunikationsbehinderung, Sprachtherapie, Diagnostik, Ätiologie, Lautbildung, Strukturebenen der Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Dyslalie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Dyslalie (Stammeln), eine phonetisch-phonologische Sprechstörung. Sie beinhaltet eine Begriffsklärung, die Definition und Merkmale von Dyslalie, ihre Einteilung und Diagnostik sowie verschiedene Therapiemöglichkeiten. Zusätzlich werden die Zusammenhänge zwischen den Strukturebenen der Sprache und Dyslalie beleuchtet. Die Arbeit enthält Einleitung, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Begriffe werden in der Hausarbeit geklärt?
Die Hausarbeit klärt die Begriffe Sprache, Sprachstörung, Sprachbehinderung und Kommunikationsbehinderung. Es werden verschiedene Definitionen von Sprache von Linguisten wie Sapir, Chomsky und Hall verglichen und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Sprachbeeinträchtigungen nach Knura und Braun erläutert.
Was ist Dyslalie?
Dyslalie, auch Stammeln genannt, ist eine phonetisch-phonologische Sprechstörung. Die Hausarbeit definiert Dyslalie, beschreibt ihre Merkmale und verschiedene Einteilungsmöglichkeiten. Es werden unterschiedliche Ausprägungen der Störung und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Lautbildung detailliert erklärt.
Wie wird Dyslalie diagnostiziert und behandelt?
Die Hausarbeit beschreibt diagnostische Verfahren zur Erkennung von Dyslalie und verschiedene therapeutische Ansätze zur Behandlung der Störung. Die genauen Methoden werden im Kapitel "Dyslalie" detailliert dargestellt.
Welche Strukturebenen der Sprache werden im Zusammenhang mit Dyslalie betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Strukturebenen der Sprache und den Auswirkungen von Dyslalie. Die genaue Darstellung dieser Zusammenhänge findet sich im Kapitel "Dyslalie".
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Dyslalie, Stammeln, phonetisch-phonologische Sprechstörung, Sprachstörung, Sprachbehinderung, Kommunikationsbehinderung, Sprachtherapie, Diagnostik, Ätiologie, Lautbildung, Strukturebenen der Sprache.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist strukturiert in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung, ein zentrales Kapitel über Dyslalie (inkl. Merkmale, Diagnostik und Therapie) und ein Fazit. Der Aufbau wird in der Einleitung und im Inhaltsverzeichnis detailliert beschrieben.
- Quote paper
- M. Ed. Christoph Staufenbiel (Author), 2014, Dyslalie (Stammeln). Eine phonetisch-phonologische Störung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277552