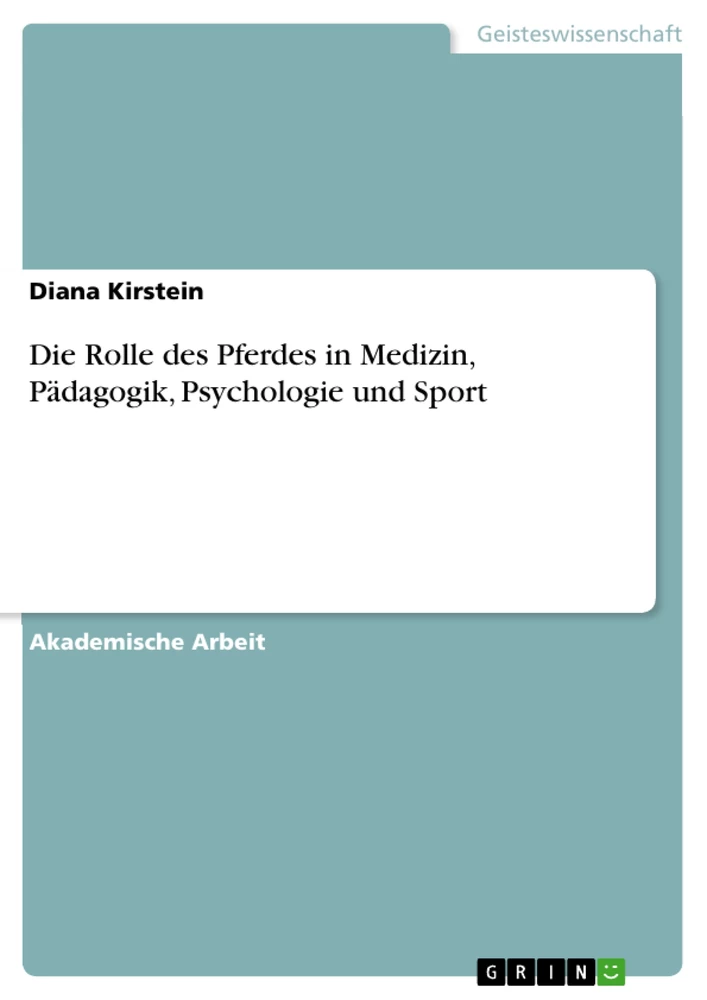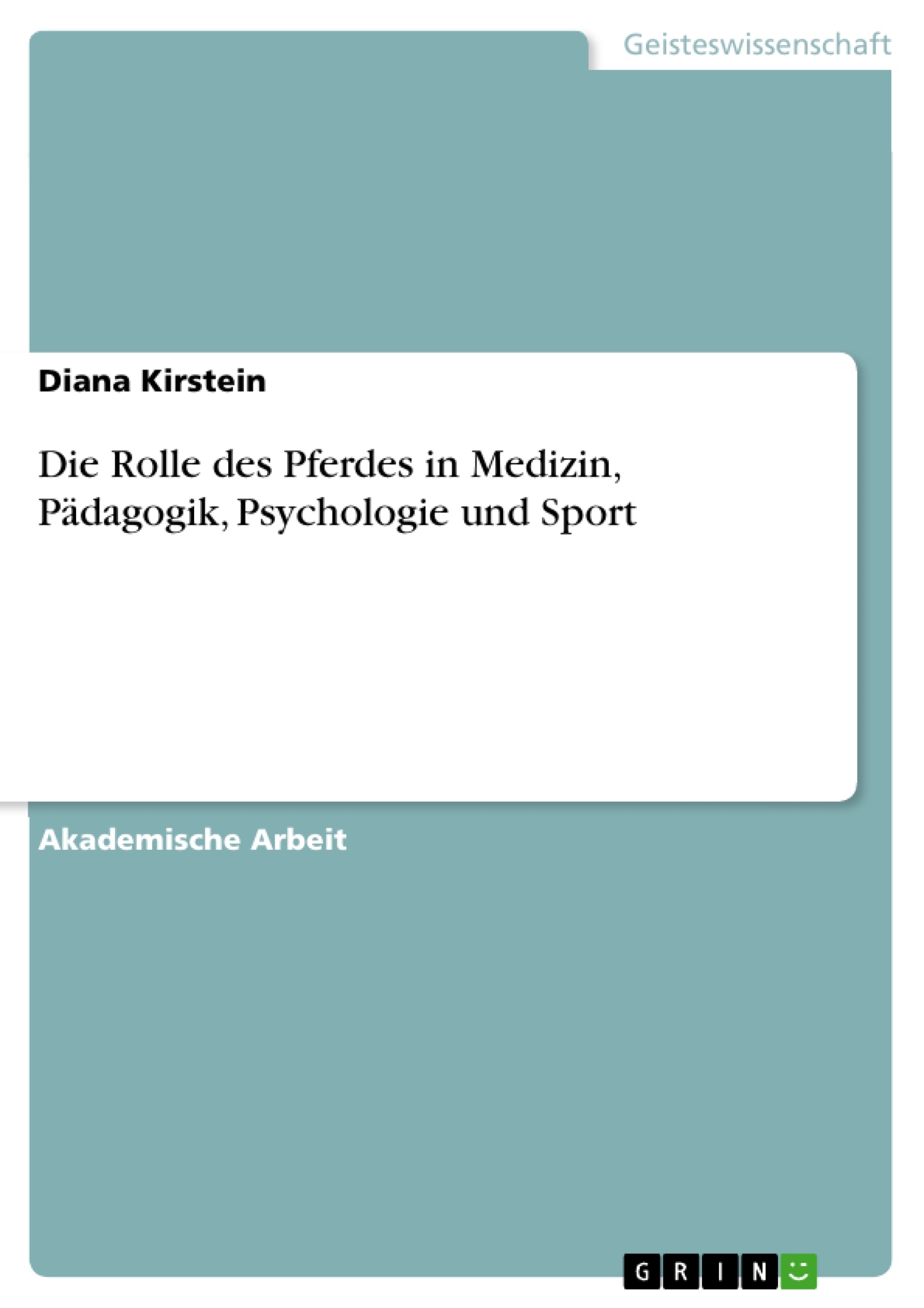Die vorliegende Arbeit gibt nähere Einblicke in die Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Der Rückblick bezieht sich sowohl auf die Zusammenführung von Mensch und Pferd, als auch im speziellen Sinne auf die Entstehung des therapeutischen Reitens.
Aus dem Inhalt:
- Vom Zugpferd zum therapeutischen Helfer
- Krankengymnastik auf dem Pferd
- Das Pferd in Psychologie und Pädagogik
Inhaltsverzeichnis
- Vom Zugpferd zum Therapeutischen Helfer- geschichtlicher Rückblick
- Therapeutisches Reiten- das Pferd in Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sport
- Krankengymnastik auf dem Pferd – Hippotherapie
- Sportlich aktiv mit dem Pferd- Behindertenreitsport
- Das Pferd in Psychologie und Pädagogik – Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
- Der Unterschied zwischen Voltigieren und Reiten
- Excurs Situation des Therapeutischen Reitens im Ausland
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Quellenangaben
- Abbildungsnachweise
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle des Pferdes in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sport. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Therapeutischen Reitens und stellt die verschiedenen Fachbereiche, wie Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren und Behindertenreitsport, vor. Darüber hinaus werden die Einsatzmöglichkeiten des Pferdes in der Therapie und die positiven Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit des Menschen untersucht.
- Die historische Entwicklung des Therapeutischen Reitens
- Die verschiedenen Fachbereiche des Therapeutischen Reitens
- Die Einsatzmöglichkeiten des Pferdes in der Therapie
- Die positiven Auswirkungen des Reitens auf die körperliche und psychische Gesundheit
- Die Bedeutung des Pferdes als Therapiepartner
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Pferdes vom Zugpferd zum Therapeutischen Helfer. Es wird die lange Geschichte der Mensch-Pferd-Beziehung dargestellt und die Anfänge des Therapeutischen Reitens bis ins Altertum zurückverfolgt. Das Kapitel zeigt, wie das Reiten im Laufe der Zeit als heilsames Exercitium erkannt wurde und wie die therapeutischen Wirkungen des Reitens im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurden.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Therapeutischen Reiten als Oberbegriff für die drei Fachbereiche Hippotherapie, Heilpädagogisches Voltigieren/Reiten und Behindertenreitsport. Es werden die jeweiligen Fachbereiche definiert und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede erläutert. Darüber hinaus wird der Bezug zum allgemeinen Reitsport hergestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Hippotherapie, einer medizinisch-therapeutischen Maßnahme im Rahmen der Krankengymnastik. Es werden die Ziele und die Wirkungsweise der Hippotherapie erläutert und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Behandlung von körperlichen Beeinträchtigungen und Krankheiten dargestellt.
Das vierte Kapitel behandelt den Behindertenreitsport, der sich mit der Förderung von Menschen mit Behinderungen durch den Reitsport beschäftigt. Es werden die verschiedenen Disziplinen des Behindertenreitsportes vorgestellt und die positiven Auswirkungen des Reitens auf die körperliche und psychische Gesundheit von Menschen mit Behinderungen erläutert.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren, die sich mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen durch den Reitsport beschäftigen. Es werden die Ziele und die Wirkungsweise des Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens erläutert und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Behandlung von psychischen und sozialen Problemen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Therapeutische Reiten, Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Behindertenreitsport, Pferd als Therapiepartner, Mensch-Pferd-Beziehung, körperliche und psychische Gesundheit, Förderung, Rehabilitation, Inklusion, Pädagogik, Psychologie, Sport, Medizin, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hippotherapie?
Hippotherapie ist eine medizinisch-therapeutische Maßnahme auf dem Pferd, die als Krankengymnastik zur Behandlung körperlicher Beeinträchtigungen eingesetzt wird.
Was ist der Unterschied zwischen Voltigieren und Reiten in der Therapie?
Beim Voltigieren werden gymnastische Übungen auf dem Pferd ausgeführt, während beim therapeutischen Reiten die Interaktion und Einwirkung auf das Pferd im Fokus stehen.
Wie hilft das Pferd in der Psychologie und Pädagogik?
Heilpädagogisches Reiten fördert Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung sowie bei psychischen Problemen.
Welche Vorteile bietet Behindertenreitsport?
Er fördert die Inklusion, verbessert die körperliche Koordination und stärkt das Selbstbewusstsein von Menschen mit Behinderungen durch sportliche Aktivität.
Seit wann gibt es therapeutisches Reiten?
Die Wurzeln reichen bis ins Altertum zurück; im 20. Jahrhundert wurden die spezifischen therapeutischen Wirkungen wissenschaftlich wiederentdeckt.
- Arbeit zitieren
- Diana Kirstein (Autor:in), 2006, Die Rolle des Pferdes in Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277682