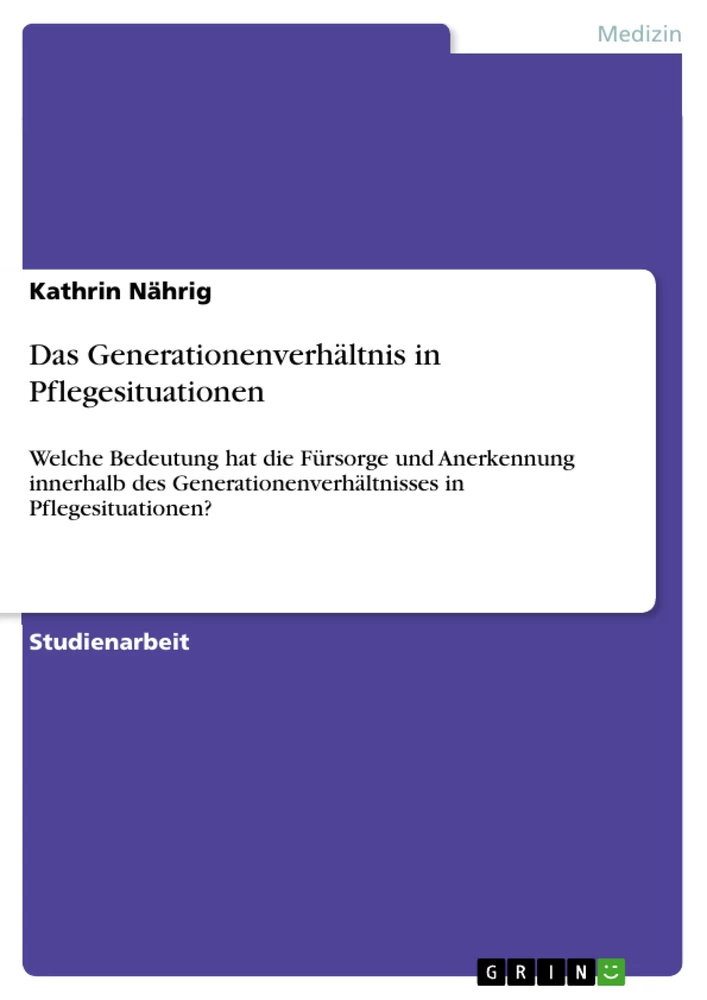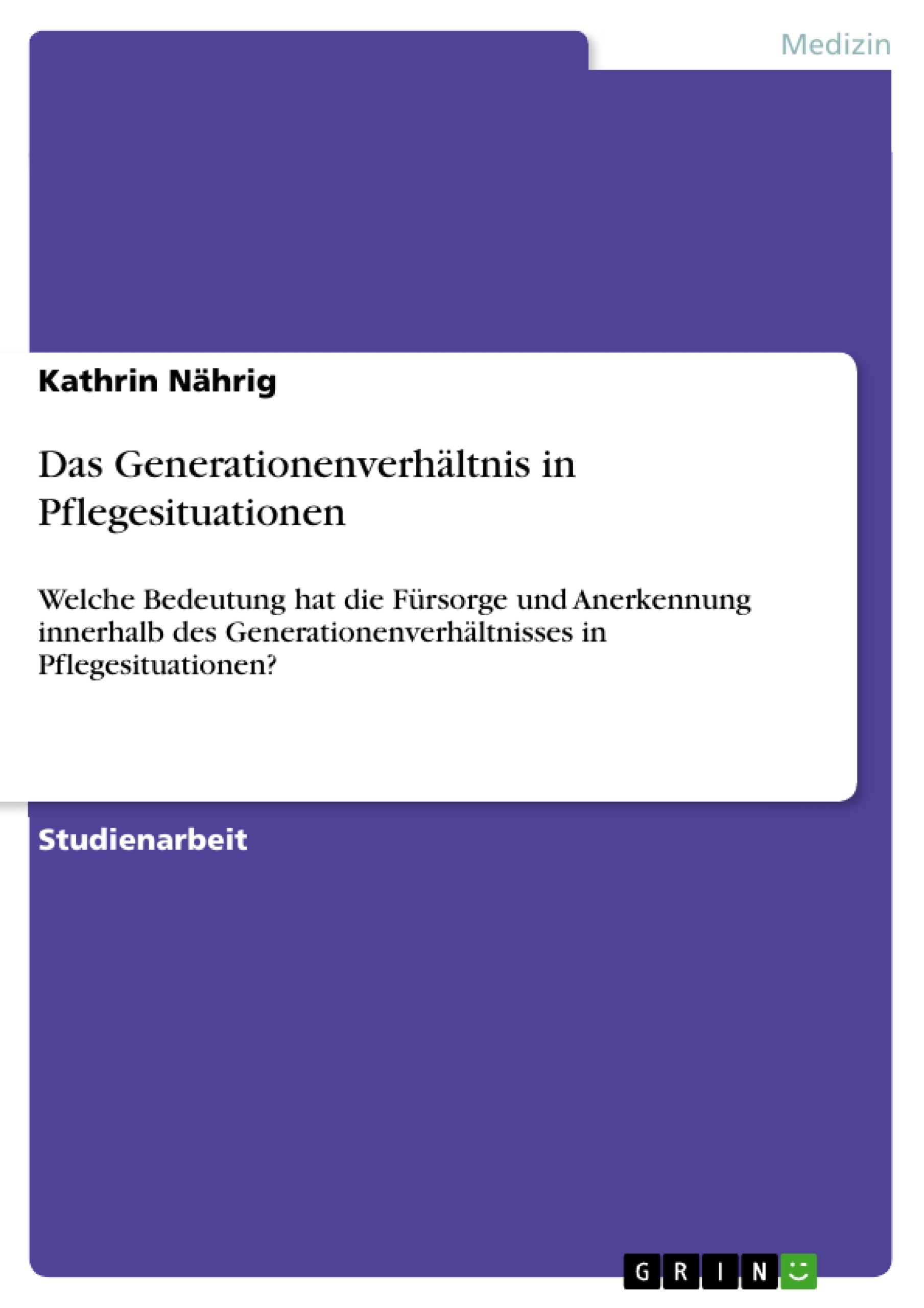Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thema und Motivation
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Das Generationenverhältnis
2.1 Pädagogisch anthropologischen Bedeutung orientiert an den Dimensionen der Sozialität und Kulturalität
3 Familiäre Pflegesituation
3.1 Pflegen und sich pflegen lassen als Grundbedürfnis
3.2 Belastungen der Pflegeperson
3.3 Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem
3.3.1Beziehung durch Körperkontakt
3.3.2 Widersprüchliche Gefühle
3.3.3 Beziehungsqualität
4 Schlussfolgerung
1 Einleitung Einleitung Einleitung
1.1 Thema, Motivation und Aufbau der Arbeit
Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist in Deutschland ein Wandel der Altersstruktur zu erkennen. Aufgrund der drastisch rückläufigen Säuglings- und Kindersterblichkeit und des medizinischen Fortschritts steigt der Anteil der Bevölkerung, der ein höheres Lebensalter erreicht, an. Zum einen führt diese zunehmende Lebenserwartung dazu, dass die Anzahl der Hochaltrigen und somit auch die der älteren, kranken und beeinträchtigten Menschen zunimmt und auch weiterhin zunehmen wird. Zum anderen, dass noch nie zuvor so viele Generationen so lange gleichzeitig in der Gesellschaft und in der Familie zusammengelebt haben. Da diese Menschen ihren Lebensalltag meist nicht mehr ohne fremde Hilfe meistern können, gewinnt die Unterstützung bei deren Bewältigung und als Pflegeinstanz vor allem die Familie an großer Bedeutung. Dies ist auch zurückzuführen auf das Inkrafttreten der Pflegeversicherung 1995 und des Pflege- Weiterentwicklungsgesetztes 2008. Denn hierbei stehen die Sicherung der häuslichen Pflege und die Betreuung im Mittelpunkt, um stationäre Unterbringungen zu vermeiden. Bei diesem Aspekt darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die häusliche Pflege, trotz vieler Unterstützungsangebote, eine große Herausforderung, Belastung und auch Überforderung darstellen kann. Doch nicht nur der Trend der Hochaltrigkeit, sondern auch Erscheinungen wie Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung und Singularisierung gehen mit dem Strukturwandel des Alters einher. Diese strukturellen Veränderungen sind fundamental für den Wandel des Verhältnisses der Generationen zueinander und ihren Umgang miteinander. Jedoch spielen dabei auch historisch- politische Veränderungen, technologische Neuerungen und Notlagen des Sozialstaats eine nicht geringere Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Motivation
- Aufbau der Arbeit
- Das Generationenverhältnis
- Pädagogisch anthropologischen Bedeutung orientiert an den Dimensionen der Sozialität und Kulturalität
- Familiäre Pflegesituation
- Pflegen und sich pflegen lassen als Grundbedürfnis
- Belastungen der Pflegeperson
- Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem
- Beziehung durch Körperkontakt
- Widersprüchliche Gefühle
- Beziehungsqualität
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Generationenverhältnis in Pflegesituationen und untersucht die Bedeutung von Fürsorge und Anerkennung innerhalb dieser Beziehungen. Die Arbeit analysiert die pädagogisch-anthropologische Bedeutung des Generationenverhältnisses, beleuchtet die Belastungen der Pflegeperson und die Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem.
- Pädagogisch-anthropologische Bedeutung des Generationenverhältnisses
- Belastungen der Pflegeperson
- Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem
- Rolle von Fürsorge und Anerkennung in Pflegesituationen
- Strukturwandel des Alters und seine Auswirkungen auf das Generationenverhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Motivation und den Aufbau der Arbeit. Sie beleuchtet den Wandel der Altersstruktur in Deutschland und die zunehmende Bedeutung der familiären Pflege.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Generationenverhältnis und seiner pädagogisch-anthropologischen Bedeutung. Es werden die Dimensionen der Sozialität und Kulturalität im Kontext des Generationenverhältnisses betrachtet.
Das dritte Kapitel analysiert die familiäre Pflegesituation. Es werden die Belastungen der Pflegeperson, die Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem sowie die Bedeutung von Körperkontakt, widersprüchlichen Gefühlen und der Beziehungsqualität in Pflegesituationen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Generationenverhältnis, die familiäre Pflegesituation, die Belastungen der Pflegeperson, die Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem, Fürsorge, Anerkennung, Sozialität, Kulturalität, Strukturwandel des Alters, Hochaltrigkeit, Pflegeversicherung, häusliche Pflege, Altenwohnheim.
Häufig gestellte Fragen
Warum nimmt die Bedeutung der familiären Pflege in Deutschland zu?
Dies liegt am Strukturwandel des Alters, der steigenden Lebenserwartung und gesetzlichen Regelungen wie der Pflegeversicherung, die häusliche Pflege bevorzugen.
Welche Belastungen entstehen für die pflegenden Angehörigen?
Häusliche Pflege kann zu großer körperlicher und psychischer Herausforderung, Belastung und oft auch zur Überforderung der Pflegeperson führen.
Welche Rolle spielt der Körperkontakt in der Pflegesituation?
Der Körperkontakt ist ein zentrales Element der Beziehung zwischen Pflegendem und zu Pflegendem und beeinflusst die Beziehungsqualität maßgeblich.
Was versteht man unter dem "Strukturwandel des Alters"?
Darunter fallen Phänomene wie die Hochaltrigkeit, Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung und die Zunahme von Einpersonenhaushalten (Singularisierung) im Alter.
Welche pädagogisch-anthropologische Bedeutung hat das Generationenverhältnis?
Es orientiert sich an den Dimensionen der Sozialität und Kulturalität und untersucht, wie Generationen durch Fürsorge und Anerkennung interagieren.
- Quote paper
- Kathrin Nährig (Author), 2012, Das Generationenverhältnis in Pflegesituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277754