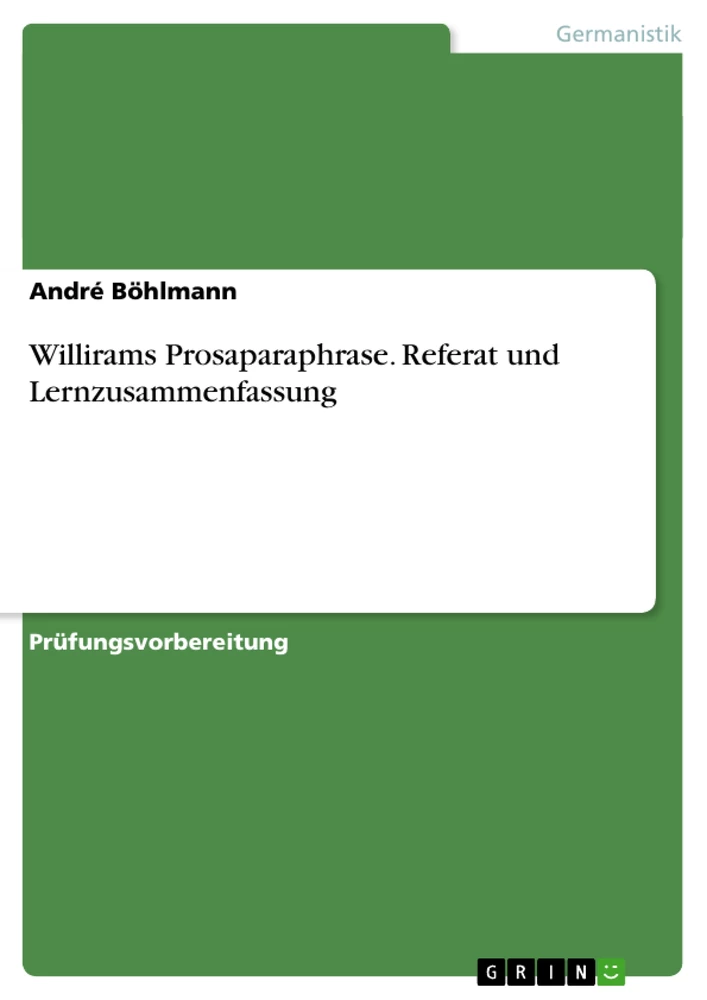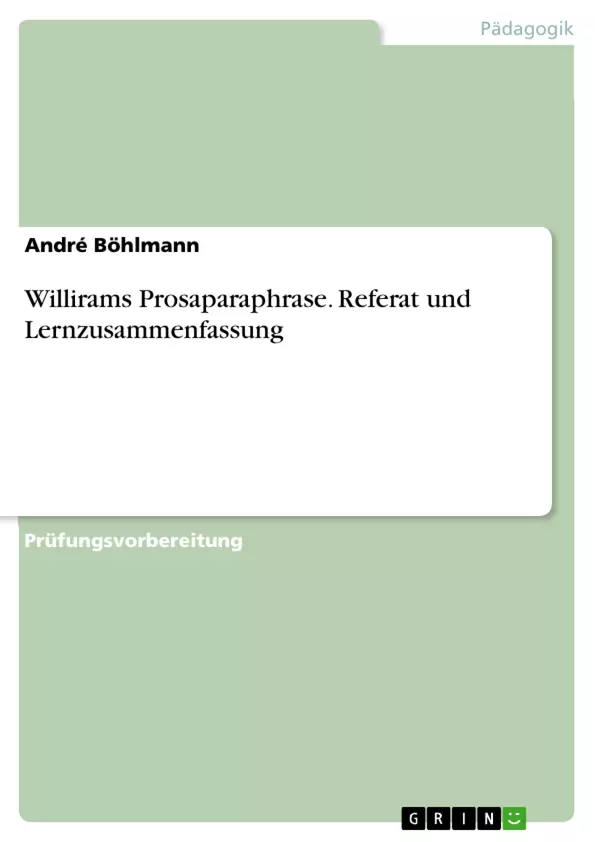Die Zusammenfassung diente als Vorbereitung auf eine schriftliche Examensprüfung zu Willirams Prosaparaphrase.
Inhaltsverzeichnis
- Zweisprachigkeit und Willirams Prosaparaphrase
- Zwei Sprachen verwendet – daher automatisch zweisprachiges Werk?
- Betrachtung der Mischsprache bei Williram
- Quantitätsvergleich
- Die Lateinischen Elemente
- Die deutschen Elemente
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die sprachliche Gestaltung von Willirams Prosaparaphrase des Hohenliedes. Sie untersucht die Verwendung von Deutsch und Latein in der Mischsprache und beleuchtet die Rolle der beiden Sprachen im Werk. Die Arbeit zielt darauf ab, die sprachliche Kompetenz Willirams zu beleuchten und die Funktion der Mischsprache im Kontext der exegetischen Arbeit zu erforschen.
- Die Rolle von Deutsch und Latein in Willirams Prosaparaphrase
- Die sprachliche Kompetenz Willirams
- Die Funktion der Mischsprache in der exegetischen Arbeit
- Die Quellen und Einflüsse auf Willirams Sprache
- Die Bedeutung der deutschen Elemente in der Mischsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Frage, ob die Verwendung von zwei Sprachen in Willirams Prosaparaphrase automatisch zu einem zweisprachigen Werk führt. Es wird argumentiert, dass die aktive Beherrschung zweier Sprachen von der bloßen Kenntnis einzelner fremdsprachlicher Vokabeln zu unterscheiden ist. Im Mittelalter war es üblich, dass Gebildete Deutsch und Latein beherrschten, daher waren sprachliche Verständnisprobleme bei den Rezipienten von Willirams Paraphrase nicht zu erwarten. Williram selbst sprach Deutsch als Erstsprache, dennoch finden sich Teile, in denen er ausschließlich Latein verwendet.
Das zweite Kapitel analysiert die Mischsprache bei Williram. Es wird untersucht, welche Aufgaben die beiden verwendeten Sprachen erfüllen und welche Sprache als Erst- und Zweitsprache zu betrachten ist. Deutsch wird als Erstsprache des Ebersberger Abtes verstanden, da er in einer deutschsprachigen Familie aufgewachsen ist und sich des Lateins nur bediente, wenn er sich unter Gelehrten bewegte. Latein war jedoch für fast alle Sprecher, mit denen Williram verkehrte, nur Zweitsprache. Die Mischsprache bei Williram zeichnet sich dadurch aus, dass das Deutsche mit Elementen der Zweitsprache durchsetzt ist, während das Latein rein gehalten wird.
Das dritte Kapitel untersucht die lateinischen Elemente in Willirams Paraphrase. Es wird festgestellt, dass Williram ein gutes Latein schreibt und seine Grammatik auf höchstem Niveau beherrscht. Sein Latein besitzt Vorbildcharakter, besonders im Vergleich zum Gebrauchslatein des 11. Jahrhunderts. Die lateinischen Einschübe stammen zum Teil aus der Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung. Willirams Sprache ist stark vom biblischen Latein geprägt. Neben der Vulgata wirkten auf Williram die Schriften der Kirchenväter, insbesondere Hoheliedkommentare. Unter den Schriften findet sich auch der Hoheliedkommentar von Haimo von Halberstadt, den Williram teilweise zitiert.
Das vierte Kapitel analysiert die deutschen Elemente in Willirams Paraphrase. Es wird festgestellt, dass Williram vier rein deutschsprachige Kapitel in seiner Paraphrase verwendet. Diese Kapitel sind jedoch kurz und stellen Ausnahmen in der exegetischen Tätigkeit Willirams dar. Die deutsche Sprache begegnet in allen Teilen eines Satzes und wird von Williram bewusst eingesetzt, um bestimmte Aussagen zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Mischsprache, Zweisprachigkeit, Willirams Prosaparaphrase des Hohenliedes, Deutsch, Latein, Exegese, Sprachkompetenz, Quellen, Einflüsse, Kirchenväter, Vulgata, Hoheliedkommentar, Haimo von Halberstadt, deutsche Elemente, lateinische Elemente.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Willirams Prosaparaphrase?
Es handelt sich um eine bedeutende Auslegung des biblischen Hohenliedes aus dem 11. Jahrhundert, verfasst von Williram von Ebersberg in einer Mischung aus Latein und Althochdeutsch.
Warum verwendete Williram eine Mischsprache?
Williram nutzte Deutsch als Erstsprache für die Anschaulichkeit und Latein als Gelehrtensprache für die theologische Präzision, was typisch für die exegetische Arbeit seiner Zeit war.
Wie gut war Willirams Latein?
Die Arbeit stellt fest, dass Williram das Latein auf höchstem Niveau beherrschte, stark geprägt vom biblischen Stil der Vulgata und den Schriften der Kirchenväter.
Welche Quellen beeinflussten sein Werk?
Neben der Bibel (Vulgata) dienten Kommentare von Kirchenvätern und Zeitgenossen wie Haimo von Halberstadt als wichtige Vorlagen für seine Exegese.
Welche Bedeutung hat das Werk für die deutsche Sprachgeschichte?
Es ist ein herausragendes Dokument für die Entwicklung der deutschen Literatursprache im Mittelalter und zeigt die frühe wissenschaftliche Auseinandersetzung in Volkssprache.
- Quote paper
- André Böhlmann (Author), 2013, Willirams Prosaparaphrase. Referat und Lernzusammenfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277761