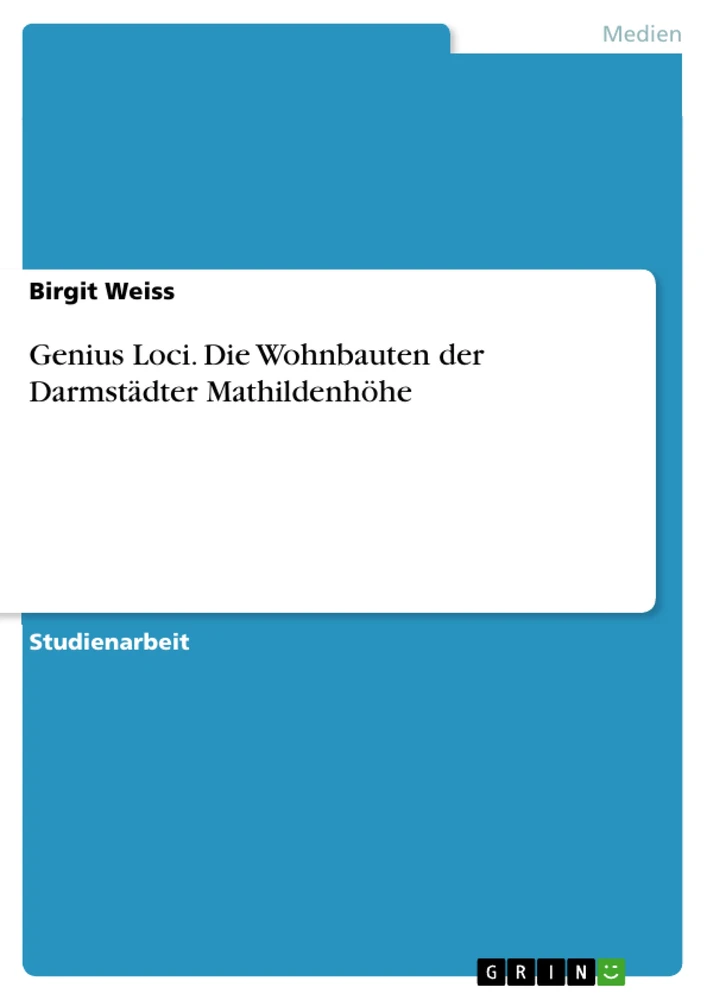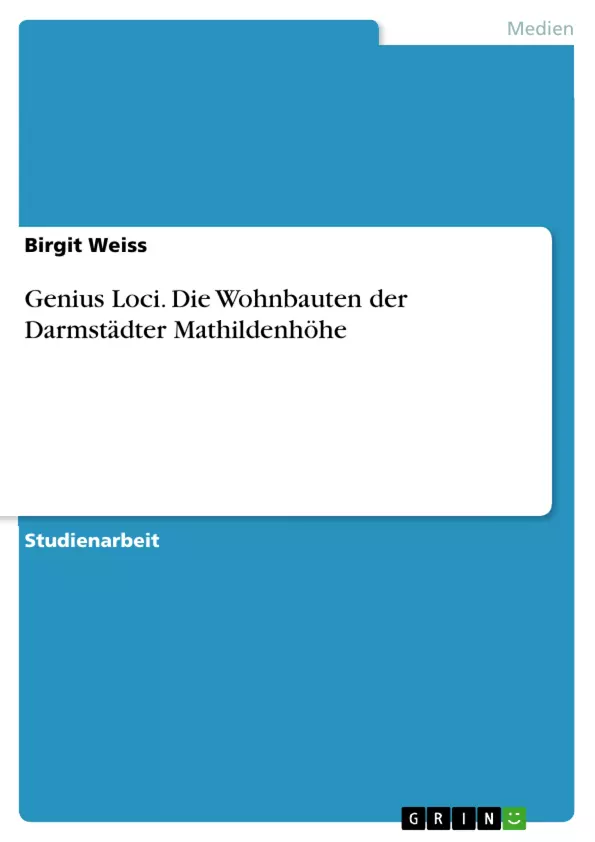Die Mathildenhöhe in Darmstadt wurde durch den Erzherzog Ernst Ludwig von Hessen als Künstlerkolonie gegründet. Er berief verschiedenste Künstler nach Darmstadt, damit sie dort gemeinschaftlich im Sinne eines Gesamtkunstwerkes arbeiteten und auch auf der Mathildenhöhe lebten. Aus diesem Ansinnen heraus entstanden verschiedene Vorschläge zum modernen Wohnen von den Künstlern der Kolonie, die sie in eigenen Häusern aber auch in anderen Wohnprojekten auf dem ihnen zur Verfügung gestellten Areal realisierten und präsentierten.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vornehmlich mit den Wohnbauten der Künstler von 1901. Es werden aber auch die anderen Wohnprojekte der Folgeausstellungen kurz beleuchtet, um das Gesamtkonzept des Modernen Wohnens zu präsentieren und den Genius Loci der Künstlerkolonie zu verorten. Weiters werden kurze Hintergrundinformationen zur Person des Großherzogs, zu den kulturpolitischen Hintergründen und den Zielsetzungen der Künstlerkolonie sowie zu den ersten Künstlern der Mathildenhöhe gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes.
- Großherzog Ernst Ludwig von Hessen
- Mathildenhöhe
- Allgemeines
- Kulturpolitischer Hintergrund
- Idee und Zielsetzung der Künstlerkolonie
- Die ersten Künstler der Kolonie
- Joseph Maria Olbrich
- Peter Behrens
- Hans Christiansen
- Patriz Huber
- Rudolf Bosselt
- Paul Bürck
- Ludwig Habich
- Erste Ausstellung auf der Mathildenhöhe: „Ein Dokument deutscher Kunst“ 1901
- Allgemeines zu den Wohnbauten der Künstler
- Ernst-Ludwig-Haus
- Außenansicht
- Innenansicht
- Genius Loci
- Allgemeines zu den Olbrichschen Villen
- Haus Olbrich
- Haus Christiansen
- Großes Haus Glückert
- Haus Habich
- Kleines Haus Glückert
- Haus Keller
- Haus Deiters
- Haus Behrens
- Außen
- Innen
- Genius Loci
- Kritik am Luxuscharakter der ersten Ausstellung
- Zweite Ausstellung 1904
- Neuberufene Künstler
- Dreihäusergruppe
- Außen- und Innengestaltung
- Bedeutung und Genius Loci
- Dritte Ausstellung: „,,Hessische Landesausstellung für freie und angewandte Kunst“ 1908
- Oberhessisches Haus
- Haus Wagner-Gewin
- Haus Sutter
- Kleinwohnungskolonie
- Vierte und letzte Ausstellung 1914
- Mietshäuser
- Ende der Künstlerkolonie
- Abschließendes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darmstädter Mathildenhöhe als Künstlerkolonie und beleuchtet insbesondere die Wohnbauten der Künstler, die in den verschiedenen Ausstellungen zwischen 1901 und 1914 präsentiert wurden. Der Fokus liegt auf dem Konzept des modernen Wohnens und der Verortung des Genius Loci der Künstlerkolonie. Die Arbeit geht zudem auf den Hintergrund der Gründung, den Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, die kulturpolitischen Hintergründe und die Ziele der Künstlerkolonie sowie auf die wichtigsten Künstler der Mathildenhöhe ein.
- Das Konzept des modernen Wohnens im Kontext der Künstlerkolonie Mathildenhöhe
- Die Bedeutung des Genius Loci für die Künstlerkolonie und deren Wohnbauten
- Die Rolle des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen bei der Gründung und Entwicklung der Mathildenhöhe
- Die kulturpolitischen Hintergründe und Ziele der Künstlerkolonie
- Die wichtigsten Künstler der Mathildenhöhe und ihre Beiträge zum Gesamtkonzept der Kolonie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der Arbeit und beleuchtet den Hintergrund der Gründung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe durch den Großherzog Ernst Ludwig von Hessen. Es werden dessen kulturelle Interessen und die Motivationen für die Gründung der Kolonie im Kontext der Zeit erörtert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Mathildenhöhe selbst, ihrer Geschichte, den kulturpolitischen Hintergründen und den Zielen der Künstlerkolonie. Zudem werden die wichtigsten Künstler vorgestellt, die in der Kolonie tätig waren.
Kapitel drei analysiert die erste Ausstellung auf der Mathildenhöhe im Jahr 1901, die „Ein Dokument deutscher Kunst“. Es werden die wichtigsten Wohnbauten der Künstler präsentiert, darunter das Ernst-Ludwig-Haus und die Olbrichschen Villen, und deren architektonische und gestalterische Besonderheiten werden hervorgehoben.
Kapitel vier befasst sich mit der zweiten Ausstellung der Künstlerkolonie im Jahr 1904 und konzentriert sich auf die neu hinzugekommenen Künstler und die Dreihäusergruppe, die in dieser Ausstellung präsentiert wurde.
Das fünfte Kapitel gibt einen Überblick über die dritte Ausstellung im Jahr 1908, die „Hessische Landesausstellung für freie und angewandte Kunst“. Es werden die wichtigsten Wohnbauten der Ausstellung, wie das Oberhessische Haus, das Haus Wagner-Gewin und die Kleinwohnungskolonie, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Darmstädter Mathildenhöhe, Künstlerkolonie, Jugendstil, Ernst Ludwig von Hessen, Wohnbauten, Genius Loci, Gesamtkunstwerk, moderne Architektur, Kunstgewerbebewegung, Ausstellung, Modernes Wohnen, Architekturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Idee hinter der Künstlerkolonie Mathildenhöhe?
Die Kolonie sollte als Gesamtkunstwerk dienen, in dem Künstler gemeinsam arbeiteten und lebten, um neue Konzepte für das moderne Wohnen zu präsentieren.
Wer gründete die Darmstädter Mathildenhöhe?
Die Gründung erfolgte durch Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, der ein starkes Interesse an der Förderung von Kunst und Kunstgewerbe hatte.
Welche Architekten waren an der ersten Ausstellung 1901 beteiligt?
Prägende Künstler waren unter anderem Joseph Maria Olbrich, der das Ernst-Ludwig-Haus entwarf, sowie Peter Behrens, der dort sein eigenes Haus realisierte.
Was bedeutet der Begriff „Genius Loci“ in diesem Kontext?
Er beschreibt den besonderen „Geist des Ortes“, der durch die Architektur und das gemeinschaftliche Wirken der Künstler auf der Mathildenhöhe geschaffen wurde.
Welche Kritik gab es an der ersten Ausstellung?
Kritisiert wurde vor allem der Luxuscharakter der Wohnbauten, was in späteren Ausstellungen (z.B. 1908) zur Entwicklung von Kleinwohnungskolonien führte.
- Arbeit zitieren
- BA Birgit Weiss (Autor:in), 2012, Genius Loci. Die Wohnbauten der Darmstädter Mathildenhöhe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277785