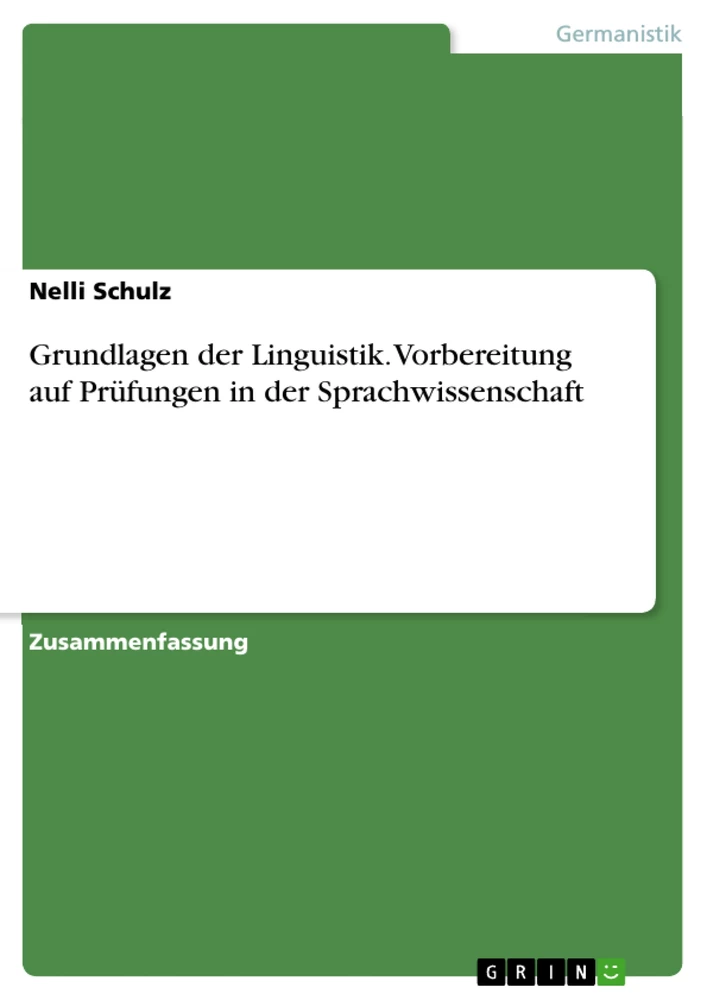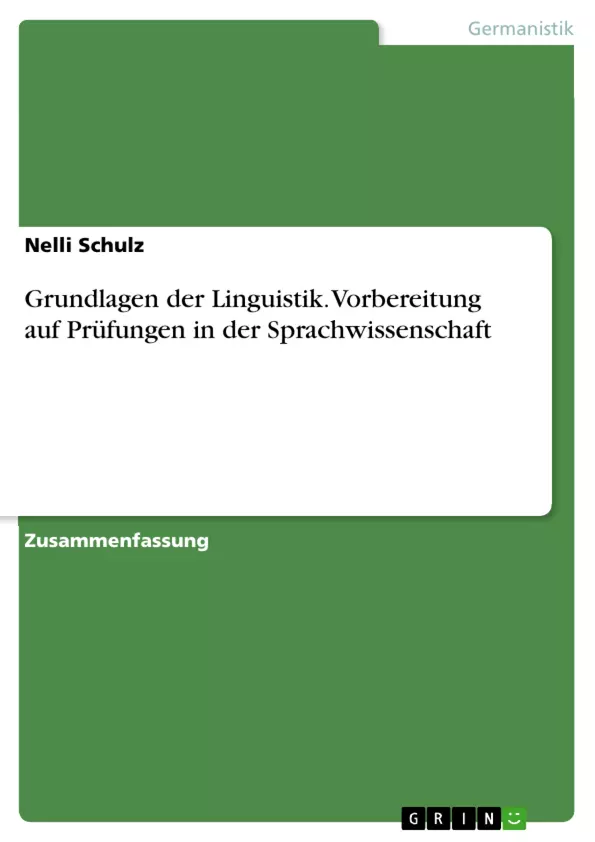Diese Lernzusammenfassung umfasst das Thema "Grundlagen der Linguistik/Sprachwissenschaft" in Stichpunkten. Es wird kurz erklärt, was ist Sprache, welche Kommunikationsmodelle es gibt, was Zeichen sind. Weitere Themenbereiche sind Morphologie, Wortarten und Sprachmodelle.
Inhaltsverzeichnis
- Was versteht man in der Linguistik unter Sprache?
- Welche Spezifika hat die menschliche Sprache gegenüber anderen Zeichensystemen?
- Was ist mit verbalen, paraverbalen und nonverbalen Codes von Sprache gemeint?
- Welche Funktionen kann Sprache erfüllen?
- Wie werden diese in dem Organonmodell von Karl Bühler zusammengefasst?
- Welche zwei grundlegenden Auffassungen von Sprache lassen sich im Sinne der Abgrenzung von Systemlinguistik und pragmatisch orientierter Linguistik unterscheiden?
- Skizzieren Sie die historische Entwicklung der Sprachwissenschaft von ihren antiken Vorläufern bis zum heutigen Stand der modernen Linguistik. Welche wichtigen Wendepunkte lassen sich dabei feststellen?
- Aus welche Teildisziplinen besteht die moderne Linguistik?
- Was versteht die Semiotik unter einem Zeichen? Was versteht man unter einem sprachlichen Zeichen?
- Welche Typen von Zeichen kann man nach der Theorie von Charles Sanders Pierce unterscheiden?
- Welche Probleme können bei der Zuordnung von Zeichen zu Zeichentypen auftreten?
- Welche Relationen stellt Charles W. Morris in seinem Semiotischen Dreieck man bezüglich der Rolle des Zeichenbenützers vornehmen?
- Was versteht man unter
- Semiotik'
- 'Strukturalismus'
- Erklären Sie folgende Termini de Saussurres:
- Nach de Saussure wird die Bedeutung („valeur“ - der Wert) eines Sprachzeichens erst durch seine Position im Sprachsystem bestimmt. Erklären Sie vor diesem Hintergrund die Konzepte des Syntagmas und Paradigmas!
- Die natürliche Sprache ist ein System von minimalen Zeichen, die zu komplexen Zeichen kombiniert werden können. Erklären Sie anhand dieser Definition das Prinzip der 'double articulation' (auch nach Martinet).
- Wie heißen diese minimalen Zeichen? Welche Methode gibt es, um sie offenzulegen und zu klassifizieren?
- Skizzieren Sie die wichtigsten Grammatik- und Syntaxtheorien der modernen Linguistik.
- Erklären Sie kurz folgende Termini aus dem Bereich der Morphologie:
- Was sind Affixe? Welche Funktionen können diese erfüllen? Wie kann man Affixe strukturell kategorisieren.
- Was versteht man unter Wortbildung?
- Was versteht man bezüglich der Wortbildung unter:
- Welche Wortarten gibt es in der traditionellen Grammatik (Schwächen)?
- Was sind Funktionswörter/ Strukturwörter?
- Was ist ein Satz? Diskutieren Sie verschiedene Anschauungen unter den Aspekten der Grammatikalität und der kommunikativen Funktion von Sätzen.
- Wie ist ein komplexer Satz aufgebaut?
- Was versteht man unter Satztyp und Satzmodus? Welche Einteilung wird im Rahmen der Topologie vorgenommen?
- Was bezeichnet man als Vor-, Mittel- und Nachfeld?
- Welche Methoden kennen Sie, um zwischen Ergänzungen und Angaben zu unterscheiden?
- Welche semantisch bestimmten Klassen von Angaben gibt es?
- Haben auch Substantive und Adjektive eine Valenz?
- Wie kann man Verben semantisch und funktional kategorisieren?
- Was versteht man unter Aktionsart und Aspekt?
- In welche semantischen Verben Klassen lassen sich Substantive einteilen?
- Was versteht man unter absoluten bzw. relativen Adjektiven?
- Welche semantischen Klassen von Adverbien gibt es?
- Welche Typen von Partikeln unterscheidet man?
- Was sind
- Interjektionen
- Modalwörter
- Welche Pronomen gibt es?
- Was sind Attribute und in welchen Formen kommen sie vor?
- Mit welchem Test können Sie die Glieder eines Satzes bestimmen?
- Nominalprädikat: eigene Verbbedeutung gering Bedeutung liegt auf Substantiv.
- Wie gehen Sie bei der Analyse von Satzstrukturen systematisch vor (nach Holly/Heringer)?
- Was wird bei von Polenz dem Satzinhalt zugerechnet? Woraus besteht eine Prädikation?
- Was sind Zusätze? Was ist mit einem komprimiertem Ausdruck gemeint?
- Welche pragmatische Funktionen kann eine Passivkonstruktion erfüllen?
- Was versteht man unter einem Subjektschub?
- Welche Prädikatsklassen unterscheidet von Polenz?
- Was versteht man unter
- Polysemie: Ausdruck hat 2 oder Bedeutungen; alles was gesamt haben ☐ Grundbedeutung (z.B. Maus Tier, Computerzubehör)
- Denotation
- Konnotation
- Kollokation
- Warum gibt es in der deutschen Sprache kaum synonyme Wörter?
- Bestimmen Sie die semantischen Relationen von
- Sportler - Basketballer (Hypernymie).
- Meister - Auszubildender (Konversion).
- wach - schlafend (komplementär),
- Kellner Ober (Synonym).
- blau - gelb-rot - grün (Heteronymie)
- hell - dunkel (Antonymie).......
- Synonymie: Bedeutungsgleichheit, Bedeutungsähnlichkeit ..
- Welche Ziele setzen sich die Vertreter der Komponentialsemantik?
- Welchen Ansatz verfolgt die Prototypensemantik?
- Welchen Ansatz verfolgt Wittgenstein mit seiner „Gebrauchstheorie der Bedeutung“?
- Wie wird im Konzept der Vorstellungstheorie die Relation von Bezeichnung, Begriff und Objekte/ Sachverhalte der Realität gesehen und wie wird dort Bedeutung aufgefasst?
- Welchen Aspekt von Wortbedeutungen betrachtet die Etymologie?
- Nach welchen Kriterien kann man den Wortschatz einer Sprache untergliedern?
- Wodurch und wie verändert sich der Wortschatz des Deutschen?
- Wie verfährt man bei einem semasiologischen bzw. onomasiologischen Ansatz?
- Was ist mit dem Containermodell der Kommunikation gemeint? Warum verzerrt dieses Modell die kommunikative Wirklichkeit?
- ,,Thoughts do not travel"
- Den Worten müssen endlich Taten folgen. Warum wird diese populäre Forderung den Leistungen sprachlicher Kommunikation nicht gerecht?
- Was versteht man in der Linguistik unter Handlung? Welche Kriterien müssen dabei für eine Handlung erfüllt sein?
- Interpretation als Prozess. Inwiefern sind Handlungen Interpretationskonstrukte?
- Was versteht man unter Sprachhandlungsmustern?
- Sprechakttheorie: Sprache als Handlung .
- Welche Teilakte einer Handlung werden von der Sprechakttheorie unterschieden? Charakterisieren Sie diese!
- Was sind Illokutionsindikatoren? Welche gibt es? Nennen Sie Beispiele!
- Analysieren Sie die Illokution/ die Sprachhandlung VERSPRECHEN.
- Bestimmen Sie die Illokution der Äußerung Ich möchte aussteigen.
- Was versteht man unter indirekten Sprechaktausdrücken? Welche kommunikativen Funktionen erfüllen sie? .
- Welche Sprechaktklassen unterschiedet Searle?
- Bestimmen Sie nach der Typologie von Searle die Sprechaktklassen von.
- flehen direktiva.
- Welche Defizite weist die Sprechakttheorie in Bezug auf die Analyse natürlicher Kommunikation auf?
- Was sind performative Verben? Warum ist verleumden keines?
- Welche Partikel sind Indikatoren für deklarativen Akt?
- Welche Grundidee steckt hinter den Kommunikationskonzept von Grice?
- Welche Konversationsmaximen gibt es nach Grice und wozu dienen sie?
- Wie kann man das Konzept der Konversationellen Implikatur beschreiben?
- Welche Aufgabenstellung prägt die pragmatische Sprachanalyse?
- Warum sind Absicht, Wille und Bewusstheit nicht konstitutiv für das Handeln von Menschen?
- Nennen Sie Beispiele für bestimmte Handlungsarten?
- Wie kann man Verhalten und Handeln auseinanderhalten? Welche Fragen können Sie bei der Bestimmung von Verhalten und Handeln als Test einsetzen?
- Können Unterlassungen auch Handlungen. Begründen Sie und geben Sie ein Beispiel an!
- Warum ist Verstehen ein Zustand, der sich nach Durchlaufen eines Prozesses einstellt oder auch nicht. Interpretieren hingegen eine Handlung? ..
- Von welchem Kommunikationsbegriff gehen Watzlawick, Beavin, Jackson bei ihrem Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren!“ aus?
- Was bedeutet es, dass das Verstehen bereits in der Handlung enthalten ist?
- Was versteht man unter einem Text?
- Was ist.
- Textfunktion
- Kohärenz
- Kohäsion...
- Textverstehen
- Textarbeit..
- Warum muss ein angemessenes Kommunikationsmodell den Unterschied zwischen Meinen und Verstehen berücksichtigen?
- Welche kommunikativen Funktionen von Texten unterscheidet Brinker?
- Was sind Textsorten?
- Welche kommunikativen Aufgabenfelder gibt es nach Holly?
- Was sind textsortenkonstitutive und textsortentypische Muster?
- Was versteht man unter Kommunikationsform?
- Welchen Bezugsbereichen lassen sich Texte zuordnen?
- Wie kann man die thematische Struktur von Texten beschreiben?
- Was versteht man unter Grundmustern thematischer Entfaltung?
- Wie sind einzelne Textteile miteinander verknüpft (Kohäsionsmittel & Kohärenzmittel)?
- Rekkurrenz: materielle Wiederaufnahme eines einmal eingeführten Textelements im nachfolgenden Text z.B. gleiche Lexem...
- Was gehört alles zur Organisationsebene eines Textes?
- Was bezeichnet man als Kontakt- und Beziehungsebene eines Textes?
- Was ist mit Interaktionsmodalität gemeint?
- Was ist ein Gespräch?....
- Wodurch unterscheidet sich mündliche und schriftliche Kommunikation?
- Erläutern Sie den Zusammenhang von Gespräch/ Interaktion und sozialer Wirklichkeit.
- Was sind Gesprächssorten und welche Funktionen haben diese für die Kommunikation?
- Aus welchen theoretischen Wurzeln hat sich die Gesprächsanalyse entwickelt?
- Was sind Grundprinzipien der ethnomethodologischen Konversationsanalyse?
- Welche Aspekte erfasst eine holistische pragmalinguistische Gesprächsanalyse?
- Welche Komponenten umfasst die Organisationsebene von Gesprächen? Wie werden Gespräche eröffnet bzw. beendet?
- Was versteht man unter Turns, Turntaking, Sequenzen?
- Nach welchen Prinzipien verlaufen Sprecherwechsel?
- Welche verständnissichernden Mittel gibt es?
- Welche Phänomene auf der Ausdrucksebene sind für gesprochene Sprache typisch?
- Was versteht man in der linguistischen Pragmatik unter Stil?
- Welche Verfahren gibt es (nach Püschel), um den Stil eines Textes herauszuarbeiten?
- Was sind Textsortenstile?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Skript dient der Vorbereitung auf die Zwischenprüfung im Fach Germanistische Sprachwissenschaft. Es behandelt grundlegende Konzepte und Theorien der Linguistik, die für das Verständnis der deutschen Sprache und ihrer Funktionsweise relevant sind. Das Skript umfasst Themen wie die Definition von Sprache, ihre Spezifika, Funktionen und Codes, die historische Entwicklung der Sprachwissenschaft, die Semiotik, die Struktur des Sprachsystems, die Grammatik, die Wortbildung, die Satzstruktur, die Semantik, die Pragmatik, die Sprechakttheorie, die Konversationsanalyse und die Textlinguistik.
- Definition und Eigenschaften von Sprache
- Die historische Entwicklung der Sprachwissenschaft
- Die Struktur des Sprachsystems und die Bedeutung von Zeichen
- Grammatik, Wortbildung und Satzstruktur
- Semantik, Pragmatik und die Analyse von Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das Skript beginnt mit einer grundlegenden Definition von Sprache und ihren Spezifika im Vergleich zu anderen Zeichensystemen. Es werden die verschiedenen Codes von Sprache (verbal, paraverbal, nonverbal) und ihre Funktionen (Darstellung, Ausdruck, Appell) erläutert. Anschließend wird das Organonmodell von Karl Bühler vorgestellt, das die Funktionen von Sprache in einem Dreiecksmodell zusammenfasst.
Im weiteren Verlauf des Skripts wird die historische Entwicklung der Sprachwissenschaft von ihren antiken Vorläufern bis zur modernen Linguistik skizziert. Es werden wichtige Wendepunkte und die Entstehung verschiedener Teildisziplinen der Linguistik beleuchtet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Semiotik, der Lehre von Zeichen. Es werden die verschiedenen Typen von Zeichen nach Charles Sanders Pierce und die Relationen im Semiotischen Dreieck nach Charles W. Morris erläutert.
Die Struktur des Sprachsystems nach Ferdinand de Saussure wird im Detail behandelt, einschließlich der Konzepte des Syntagmas und Paradigmas. Das Prinzip der 'double articulation' wird anhand der minimalen Zeichen der Sprache erklärt.
Die Grammatik und Syntax werden in den folgenden Kapiteln behandelt, einschließlich der wichtigsten Theorien der modernen Linguistik. Es werden verschiedene Termini aus dem Bereich der Morphologie erläutert, wie z.B. Affixe, Wortbildung und Wortarten.
Die Satzstruktur wird anhand verschiedener Anschauungen und Modelle erklärt, einschließlich der Unterscheidung zwischen Satztyp, Satzmodus und Satzgliedern. Es werden Methoden zur Unterscheidung zwischen Ergänzungen und Angaben sowie die semantischen Klassen von Angaben vorgestellt.
Die Semantik, die Lehre von der Bedeutung, wird in den folgenden Kapiteln behandelt. Es werden verschiedene Ansätze zur Analyse von Wortbedeutungen vorgestellt, wie z.B. die Komponentialsemantik, die Prototypensemantik und die Gebrauchstheorie der Bedeutung.
Die Pragmatik, die Lehre vom Sprachgebrauch, wird in den letzten Kapiteln des Skripts behandelt. Es werden die Sprechakttheorie, die Konversationsanalyse und die Textlinguistik vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Definition von Sprache, die Funktionen von Sprache, die historische Entwicklung der Sprachwissenschaft, die Semiotik, die Struktur des Sprachsystems, die Grammatik, die Wortbildung, die Satzstruktur, die Semantik, die Pragmatik, die Sprechakttheorie, die Konversationsanalyse und die Textlinguistik.
- Quote paper
- Nelli Schulz (Author), 2004, Grundlagen der Linguistik. Vorbereitung auf Prüfungen in der Sprachwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277832