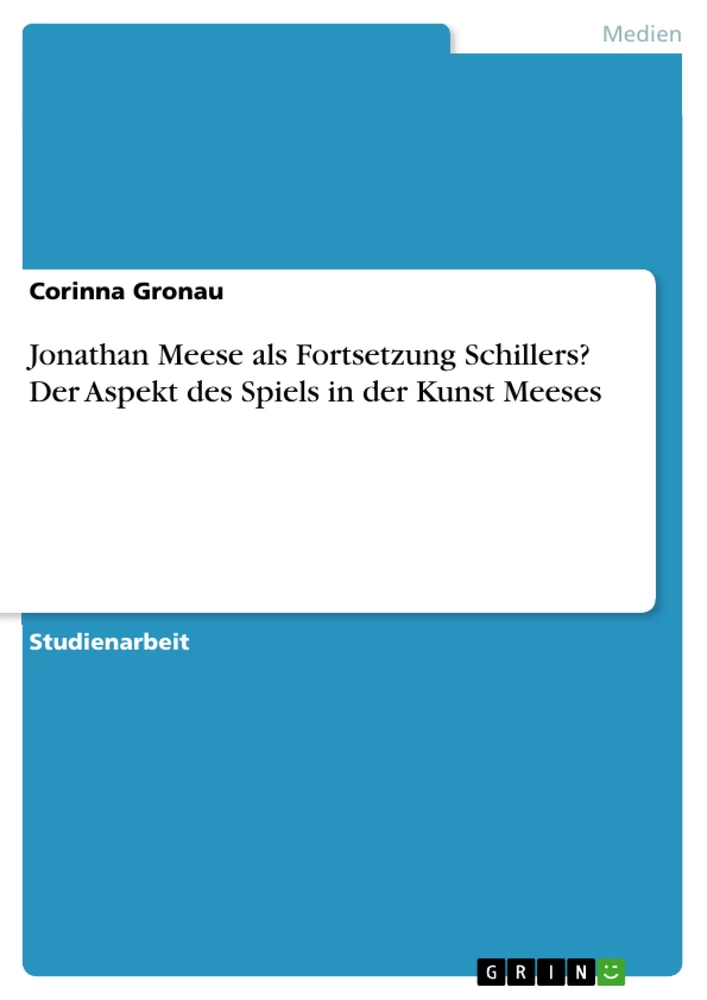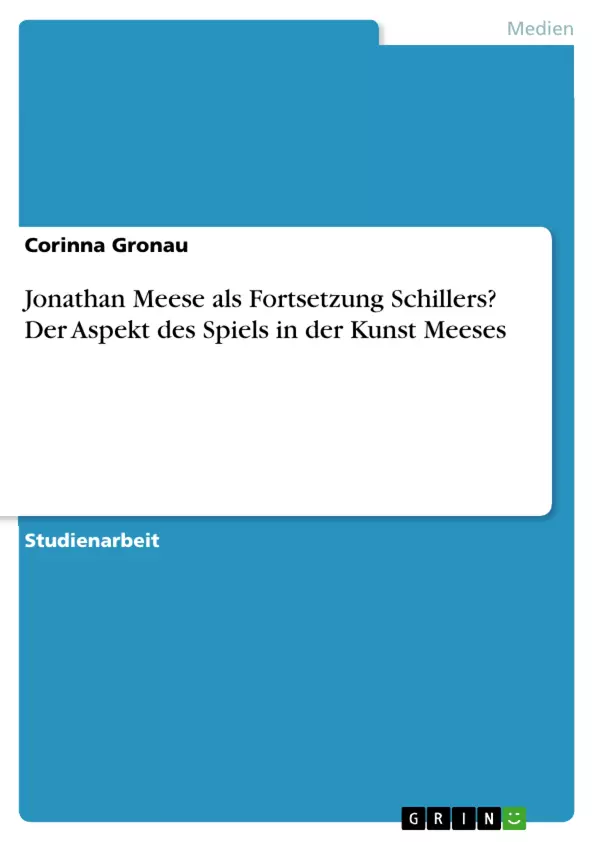„Die Raketenabschussbasis der Kunst, rattenscharf klargemacht, ist ein Plateau der Neutralität, dort dürfen alle und alles spielen. Spiele total, lieber Jonathan, indem Du das Spiel sich selbst spielen lässt, ja, ja, ja, wie 'Die Liebhaberin' oder Scarlett Johansson oder Dr. No oder alle, alle Bluthundbabies!“
Was Jonathan Meese in diesem kurzen Zitat äußert, ist nicht weniger, als das Konzept seiner Kunst, formuliert in seiner „eigenen Sprache“. Der 1970 geborene Künstler gilt als Deutschlands jüngster und radikalster Maler und Aktionskünstler.
Sein Werk umfasst neben Malerei und Performances auch Skulpturen, Installationen, Collagen, Manifeste, Videokunst und Theaterarbeiten. Seine Kunst ist bevölkert von „Macht-Menschen“, Mythen und Geistesgrößen der Historie, Stars und Sternchen der Popkultur oder Helden aus Filmen: Hitler, Caligula, Stalin, Marquise de Sade, Richard Wagner, Balthus, Zardoz oder Dr. No sind nur einige der Figuren, die wiederkehrender Bestandteil der künstlerischen Produktion Meeses sind. Während seiner Performances brüllt er schon mal so lange «Heil Hitler», bis ihm der Schaum vor dem Mund steht.
Doch wie kann man diesen auf den ersten Blick eigenwilligen und provokanten Künstler fassen?
In der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, Meese mit Friedrich Schiller zu erklären. In seiner Abhandlung „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ von 1795 hebt Schiller die Bedeutung der Kunst für den Menschen hervor: der einzige Weg zur individuellen wie zur gesellschaftlichen Freiheit seien Schönheit und Kunst. Für Schiller wurde das Spiel zum Schlüsselbegriff seiner Philosophie der Freiheit, denn „der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (15. Brief, S. 64) .
Zunächst soll die Rolle des Spiels bei Schiller isoliert werden, um anschließend anhand einer ausgewählten Performance von Meese – „Erzstaat Atlantisis“ – einen Vergleich vorzunehmen. Welcher Stellenwert kommt dem Moment des Spiels bei Meese zu? Welche Relevanz „spielt“ es in Meeses Kunstkonzept, dass im einleitenden Zitat schon angedeutet wurde? In einem Vergleich mit Joseph Beuys, der eine offene Form des Kunstbegriffs propagierte und mit seinen Aktionen in den 1960er Jahren für Aufsehen sorgte, soll die Besonderheit der „Meeseschen“ Kunst herausgearbeitet werden, um abschließend zu einem Urteil über den Einfluss des „Spielbegriffs“ Schillers für die Kunstproduktion Meeses zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedrich Schiller - „Über die ästhetische Erziehung des Menschen"
- Wichtige Thesen
- Der Spielbegriff
- Jonathan Meeses „Erzstaat Atlantisis"
- Eröffnungsperformance
- Spiel als Performance
- Rollenspiel
- Wortspiel
- Werkimmanente Bedeutung des Spiels
- Vergleich mit Joseph Beuys
- „Kukei, akopee-Nein!, Braunkreuz, Fettecken, Modellfettecken"
- ,,Soziale Plastik"
- ,,Diktatur der Kunst“ versus „Ich trete aus der Kunst aus“
- Schillers Spielbegriff und die „Diktatur der Kunst“ – Parallelen
- Fazit
- Abbildungen
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Kunst des zeitgenössischen Künstlers Jonathan Meese im Kontext der ästhetischen Philosophie Friedrich Schillers. Ziel ist es, die Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen" für die Kunstproduktion Meeses zu untersuchen. Dabei wird die Performance „Erzstaat Atlantisis" als Fallbeispiel herangezogen und mit dem Werk von Joseph Beuys verglichen.
- Schillers Spielbegriff als Konzept der Freiheit und Ganzheit
- Die Rolle des Spiels in Meeses Kunst und Performance
- Der Vergleich mit Beuys' „Sozialer Plastik" und der „Diktatur der Kunst"
- Die Relevanz von Schillers ästhetischer Theorie für die zeitgenössische Kunst
- Die Bedeutung von Macht, Mythen und Popkultur in Meeses Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Inwiefern lässt sich die Kunst von Jonathan Meese mit Schillers Spielbegriff erklären? Die Arbeit untersucht zunächst Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen" und beleuchtet die wichtigsten Thesen des Textes, insbesondere die Bedeutung des Spiels für die menschliche Freiheit und Ganzheit. Anschließend wird die Performance „Erzstaat Atlantisis" von Meese analysiert und die Rolle des Spiels in dieser Arbeit herausgearbeitet. Im Vergleich mit Joseph Beuys wird die Besonderheit der „Meeseschen" Kunst beleuchtet und die Relevanz von Schillers Spielbegriff für die zeitgenössische Kunst diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Spielbegriff, die ästhetische Erziehung, die Kunstfreiheit, die Freiheit des Individuums, Jonathan Meese, „Erzstaat Atlantisis", Joseph Beuys, „Soziale Plastik", „Diktatur der Kunst", Macht, Mythen, Popkultur und die Relevanz von Schillers ästhetischer Theorie für die zeitgenössische Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Jonathan Meese und Friedrich Schiller zusammen?
Die Arbeit untersucht Meeses Kunstkonzept vor dem Hintergrund von Schillers „Briefen über die ästhetische Erziehung“, insbesondere in Bezug auf den zentralen Begriff des Spiels.
Was bedeutet Schillers Zitat: „Der Mensch spielt nur, wo er ganz Mensch ist“?
Für Schiller ist das Spiel der Weg zur Freiheit und Ganzheit des Individuums, da es die Kluft zwischen sinnlichem Trieb und Vernunft überbrückt.
Was versteht Jonathan Meese unter der „Diktatur der Kunst“?
Es ist sein Konzept einer radikalen Autonomie der Kunst, in der das Spiel regiert und die Kunst über Ideologien oder politischen Systemen steht.
Wie unterscheidet sich Meese von Joseph Beuys?
Während Beuys mit der „Sozialen Plastik“ die Kunst in die Gesellschaft tragen wollte, propagiert Meese eine radikale Neutralität der Kunst („Ich trete aus der Kunst aus“), die sich dem direkten sozialen Zugriff entzieht.
Welche Rolle spielt das Rollenspiel in Meeses Performances?
In Performances wie „Erzstaat Atlantisis“ nutzt Meese Rollen- und Wortspiele, um Mythen und historische Figuren zu dekonstruieren und den Raum der Kunst als totales Spielfeld zu nutzen.
- Quote paper
- Corinna Gronau (Author), 2011, Jonathan Meese als Fortsetzung Schillers? Der Aspekt des Spiels in der Kunst Meeses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277868