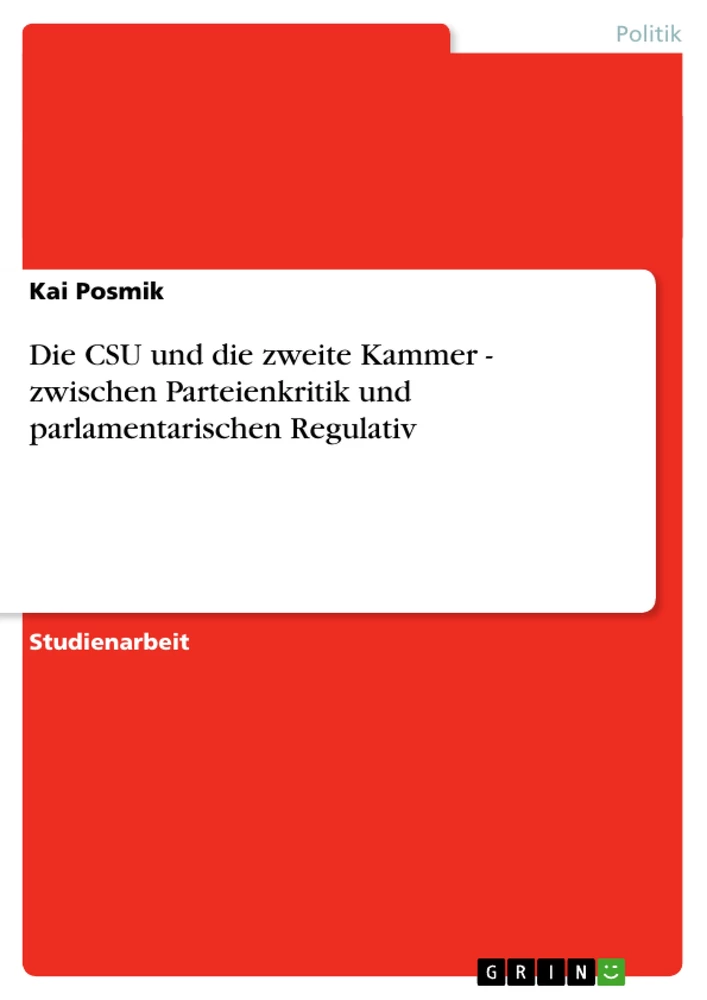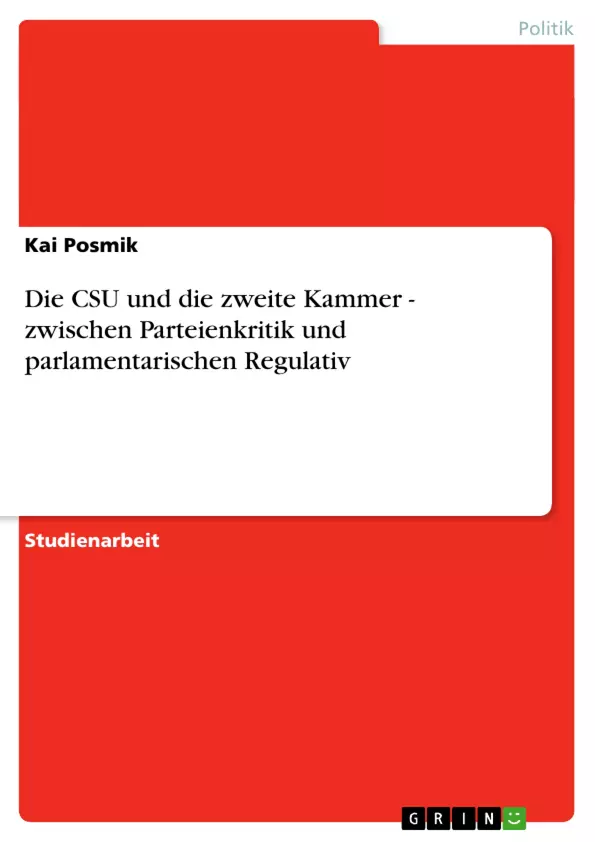Als sich der 8. Februar 1998 seinem Ende zuneigte und die Wahllokale zum Volksentscheid über die Zukunft des bayerischen Senats geschlossen und die ersten Prognosen bekannt gegeben wurden, war schnell klar, dass dieser Tag in die jüngere Geschichte des Freistaates eingehen würde. Mit fast 70 % 1 war eine zuvor wohl selbst von den Initiatoren nicht für möglich gehaltene Mehrheit der Wähler für eine vollständige Abschaffung dieses unter allen Ländern der Bundesrepublik einmaligen Phänomens einer Zweiten Kammer. Während man in Bayern von einem „Wendepunkt in der politischen Kultur“ 2 sprach, schüttelten nicht wenige im übrigen Bundesgebiet den Kopf, hatten sie doch von einem Senat zuvor noch nie etwas gehört. Und in der Tat, für viel Aufregung sorgte diese Zweite Kammer nicht, in den etwas mehr als vier Jahrzehnten ihrer begrenzten Existenz. Sie sollte es allerdings auch nicht, denn konzipiert und in der bayerischen Verfassung normiert war der Senat lediglich als ein begutachtendes und beratendes Gremium (Art. 40 BV). 3 Seine Möglichkeiten beschränkten sich darauf, gegen vom Landtag vorgelegte Gesetze „begründete Einwände“ zu erheben (Art. 41 BV), ein Änderungsgebot war damit allerdings nicht verbunden. Eine Tatsache, die den Senatsgegnern immer wieder in ihrer Fundamentalkritik bestärkte und schließlich auch das Hauptargument der Abschaffungsbewegung gewesen ist: Seine augenscheinliche Überflüssigkeit.
Ob diese Kritik berechtigt war oder nicht, wird hier nicht zu thematisieren sein, zumal der einerseits kritisierte, andererseits befürwortete Senat nicht mehr existiert. Vielmehr soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, warum und wie die CSU den Gedanken der Zweiten Kammer so vehement verfolgte, sei es zunächst im Vorbereitenden Verfassungsausschuss oder später in der Verfassungsgebenden Landesversammlung des Jahres 1946. Und dass die Idee der Zweiten Kammer in Bayern eine genuin christlich-soziale war, die vor allem bei Sozialdemokraten und Kommunisten auf strikte Ablehnung stieß, ist heute wie damals unstrittig. Dabei verfolgte die CSU ihr ehrgeiziges Ziel vor allem unter zwei Aspekten: Erstens sollten die Mitglieder der Zweiten Kammer nicht durch allgemeine Wahlen berufen werden, hätte man doch dann einen zweiten Landtag gehabt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Theoretische Grundlagen
- I. Der Bikameralismus
- II. Theorie der (berufs-)ständischen Vertretung
- III. Das Zweikammersystem in der bayerischen Geschichte
- C. Die CSU und die zweite Kammer
- I. Der Scharnagl-Entwurf und ständische Gedanken in der CSU
- II. Von der mächtigen Zweiten Kammer zum ohnmächtigen Senat
- D. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle der CSU bei der Schaffung einer zweiten Kammer in Bayern. Sie untersucht die Gründe für die vehemente Unterstützung der CSU für diese Idee und die Entwicklung vom Wunsch nach einer starken zweiten Kammer zum letztlich ohnmächtigen Senat. Dabei wird auch auf die Rolle der innerparteilichen Fraktionierung und die Haltung der anderen Parteien, insbesondere der bayerischen Sozialdemokraten, eingegangen.
- Die Bedeutung der zweiten Kammer im Kontext des Bikameralismus
- Die Theorie der ständischen Vertretung und ihre Relevanz für die CSU
- Die Rolle der CSU bei der Etablierung einer zweiten Kammer in Bayern
- Die Gründe für das Scheitern der CSU bei der Schaffung einer mächtigen zweiten Kammer
- Die Bewertung der Niederlage der CSU im Kontext der bayerischen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der zweiten Kammer in Bayern dar und führt den historischen Hintergrund des Senats sowie die Bedeutung der Abschaffung dieses Gremiums im Jahr 1998 aus. Sie erläutert die Fragestellungen der Arbeit und gibt einen Überblick über die Struktur und den Aufbau.
B. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Rolle der CSU in der Diskussion um die zweite Kammer notwendig sind. Es werden sowohl die Funktionsweise des Bikameralismus als auch die Theorie der ständischen Vertretung beleuchtet. Der Abschnitt widmet sich außerdem der historischen Einordnung des Zweikammersystems in Bayern.
C. Die CSU und die zweite Kammer: Im Hauptteil der Arbeit werden die Hintergründe für die CSU-Unterstützung der zweiten Kammer aufgezeigt. Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Entwurf von Karl Scharnagl und den ständischen Ideen, die die CSU motivierten. Der zweite Abschnitt analysiert den Prozess, der zur Umwandlung der mächtigen zweiten Kammer in einen ohnmächtigen Senat führte und die Rolle der innerparteilichen Fraktionierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bikameralismus, zweite Kammer, ständische Vertretung, CSU, Bayerischer Senat, Karl Scharnagl, Landesverfassung, politische Kultur, bayerische Geschichte, politische Fraktionierung, Parteienpolitik, Staats- und Hegemonialpartei
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der bayerische Senat 1998 abgeschafft?
Der Senat wurde nach einem Volksentscheid mit fast 70 % Zustimmung abgeschafft, da er als überflüssig und machtloses Begutachtungsgremium ohne echte Entscheidungsgewalt kritisiert wurde.
Welche Rolle spielte die CSU bei der Gründung des Senats?
Die CSU war die treibende Kraft hinter der Idee einer zweiten Kammer, die als ständische Vertretung konzipiert war, um ein parlamentarisches Regulativ zum Landtag zu schaffen.
Was ist das Prinzip des Bikameralismus?
Bikameralismus bezeichnet ein Zweikammersystem in der Legislative, bei dem eine zweite Kammer (wie der Senat) die Arbeit der ersten Kammer (Landtag) beraten oder kontrollieren soll.
Was versteht man unter ständischer Vertretung?
Die Idee sah vor, dass Mitglieder der zweiten Kammer nicht durch allgemeine Wahlen, sondern als Vertreter gesellschaftlicher Gruppen (z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaft) berufen werden.
Warum blieb der bayerische Senat letztlich „ohnmächtig“?
Seine Befugnisse beschränkten sich laut Verfassung auf Einwände und Beratung. Er hatte kein echtes Vetorecht und konnte Gesetze des Landtags nicht verhindern.
- Citation du texte
- Kai Posmik (Auteur), 2004, Die CSU und die zweite Kammer - zwischen Parteienkritik und parlamentarischen Regulativ, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27800