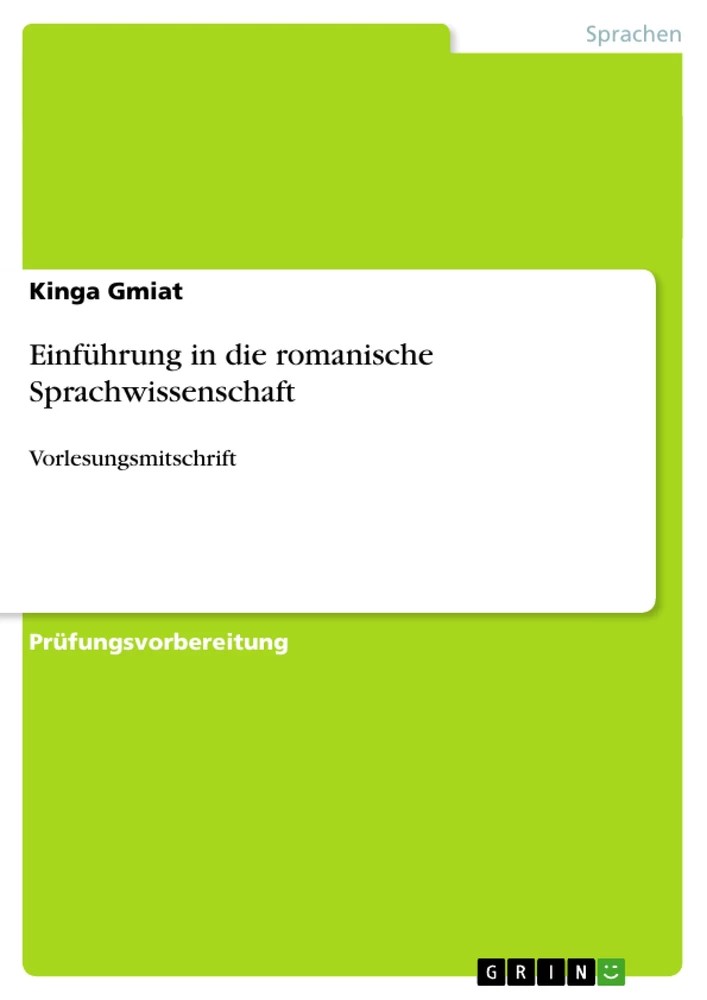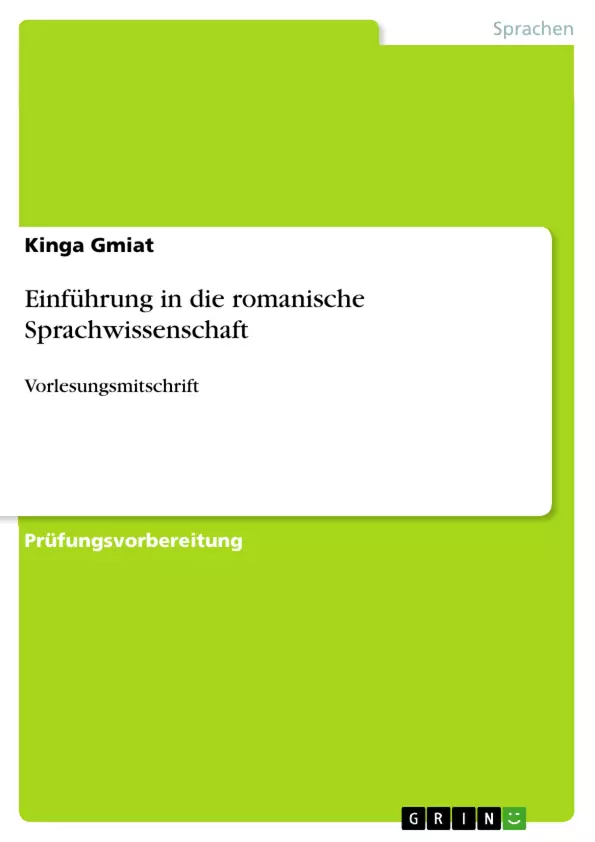Die Mitschrift aus der Vorlesung "Einführungsvorlesung zur romanistischen Sprachwissenschaft" umfasst unter anderem folgende Gebiete:
Funktion der Sprache
Phonologie/Phonetik
Artikulationsorgane
Artikulatinsorte
Lexikologie/Lexikographie
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
- Funktion der Sprache
- Sprecher und Hörer
- Artikulationsorgane
- Voraussetzung zur Lauterzeugung
- Phonologie/Phonetik
- Artikulationsarten (Konsonanten)
- Vokale (Differenzierungen)
- Vokaltrapez
- Artikulationsort
- Typisierungen von Äußerungen
- 2 Ebenen der sprachlichen Kommunikation
- Phoneme und Phone
- Lexikologie/Lexikographie
- Wortschatz
- Lexem und Wort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine Einführung in die romanische Sprachwissenschaft. Ziel ist es, grundlegende Konzepte der Sprachproduktion, -wahrnehmung und -struktur zu erläutern. Die Arbeit konzentriert sich auf die phonetische und phonologische Ebene sowie auf grundlegende Aspekte der Lexikologie.
- Die Funktion von Sprache in der Kommunikation
- Die phonetische und phonologische Beschreibung von Lauten
- Das Verhältnis von Phonetik und Phonologie
- Die Artikulationsorgane und der Prozess der Lautbildung
- Grundlegende Begriffe der Lexikologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die romanische Sprachwissenschaft: Dieses einführende Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Abschnitte. Es wird die Funktion der Sprache als Vermittlungsmedium von Vorstellungsinhalten mittels sprachlicher Zeichen erläutert, wobei der lineare Charakter sprachlicher Zeichen im Gegensatz zur nicht-linearen Verarbeitung von Ideen im Kopf des Sprechers hervorgehoben wird. Die Rolle des Sprechers und des Hörers in der erfolgreichen Kommunikation wird ebenfalls thematisiert.
Funktion der Sprache: Dieser Abschnitt behandelt die grundlegende Funktion der Sprache als Werkzeug zur Übermittlung von Ideen und Vorstellungen. Er betont die Verknüpfung sprachlicher Zeichen mit Lautformen und deren lineare Anordnung als charakteristisches Merkmal von Sprache. Die Bedeutung der gemeinsamen Sprachbasis für Verständigung zwischen Sprecher und Hörer wird hervorgehoben.
Sprecher und Hörer: Hier wird der Prozess der Sprachproduktion und -rezeption detailliert beschrieben. Der Sprecher ordnet seine Ideen in Kategorien ein und wählt entsprechende sprachliche Zeichen, um sie zu vermitteln. Der Hörer, wiederum, referiert auf das gleiche Objekt und rekonstruiert die Idee des Sprechers dank der Konzeptualisierung und des gemeinsamen sprachlichen Wissens.
Artikulationsorgane: In diesem Abschnitt werden die am Prozess der Lautbildung beteiligten Organe ausführlich beschrieben. Es werden sowohl die Artikulationsorgane im engeren Sinne (Lippen, Zähne, Zunge etc.) als auch die Organe, die die Atmung steuern (Lunge, Zwerchfell etc.) genannt, die essentiell für die Lauterzeugung sind.
Voraussetzung zur Lauterzeugung: Dieser Teil befasst sich mit den physiologischen Voraussetzungen der Lautproduktion. Atmung und Ausatmung sowie die Schwingung der Stimmlippen im Kehlkopf werden als grundlegende Faktoren für die Lauterzeugung identifiziert.
Phonologie/Phonetik: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen Phonetik (physische Aspekte der Lautbildung) und Phonologie (systematische Organisation der Laute). Es beschreibt verschiedene Artikulationsarten von Konsonanten (Plosive, Frikative, etc.) und die Differenzierung von Vokalen nach Öffnungsgrad, Zungenstellung, Lippenstellung und Nasalität. Der Vokaltrapez dient als anschauliches Modell zur Darstellung der Kardinalvokale.
Typisierungen von Äußerungen: Der Abschnitt erläutert die Notwendigkeit, Äußerungen zu typisieren, um trotz individueller Variationen in der Aussprache das Verständnis zu gewährleisten. Es wird die Unterscheidung zwischen der konkreten Sprachrealisierung ("parole") und dem abstrakten Sprachsystem ("langue") hervorgehoben.
2 Ebenen der sprachlichen Kommunikation: Dieser Abschnitt vertieft die Unterscheidung zwischen "parole" und "langue", betont die Notwendigkeit einer abstrakten Zuordnung von Lautrealisationen zu Lauttypen ("types") und erklärt, wie diese Zuordnung die Unterscheidung von Bedeutungen ermöglicht.
Phoneme und Phone: Hier wird der Unterschied zwischen Phonemen (bedeutungsdifferenzierenden Lauten) und Phon (konkrete Lautrealisierungen) erläutert. Der Begriff "Allophon" wird eingeführt, um Varianten desselben Phonems zu bezeichnen, die keine Bedeutungsunterschiede hervorrufen.
Lexikologie/Lexikographie: Das Kapitel behandelt die Lexikologie als Lehre vom Wortschatz und die Lexikographie als Lehre vom Wörterbuch. Es unterscheidet zwischen dem abstrakten Wortschatz (kollektiv, individuell, sektoriell), der konkreten Verwendung von Wörtern und dem konkreten Inventar von Wörtern (z.B. ein Wörterbuch). Die Begriffe Lexem und Wort werden definiert und abgegrenzt.
Schlüsselwörter
Romanische Sprachwissenschaft, Phonetik, Phonologie, Artikulation, Lautbildung, Phoneme, Phone, Allophone, Lexikologie, Lexikographie, Wortschatz, Lexem, Wort, Sprache, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Einführung in die romanische Sprachwissenschaft
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Einführung in die romanische Sprachwissenschaft. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Die behandelten Themen umfassen die Funktion der Sprache, die phonetische und phonologische Beschreibung von Lauten, die Artikulationsorgane, die Voraussetzungen zur Lauterzeugung, sowie grundlegende Aspekte der Lexikologie und Lexikographie.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Der Text gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einführung in die romanische Sprachwissenschaft (Grundlagen, Funktion der Sprache als Vermittlungsmedium), Funktion der Sprache (Übermittlung von Ideen), Sprecher und Hörer (Sprachproduktion und -rezeption), Artikulationsorgane (Organe der Lautbildung), Voraussetzungen zur Lauterzeugung (Atmung, Stimmlippen), Phonologie/Phonetik (Lautbeschreibung, Artikulationsarten, Vokale), Typisierungen von Äußerungen (Parole und Langue), zwei Ebenen der sprachlichen Kommunikation (Parole und Langue im Detail), Phoneme und Phone (bedeutungsdifferenzierende Laute vs. konkrete Lautrealisierungen), und Lexikologie/Lexikographie (Wortschatz, Lexem, Wort).
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Textes?
Ziel des Textes ist es, grundlegende Konzepte der Sprachproduktion, -wahrnehmung und -struktur zu erläutern. Der Fokus liegt auf der phonetischen und phonologischen Ebene sowie auf grundlegenden Aspekten der Lexikologie. Die Arbeit behandelt die Funktion von Sprache in der Kommunikation, die phonetische und phonologische Beschreibung von Lauten, das Verhältnis von Phonetik und Phonologie, die Artikulationsorgane und den Prozess der Lautbildung sowie grundlegende Begriffe der Lexikologie.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text erklärt?
Wichtige Schlüsselbegriffe umfassen: Romanische Sprachwissenschaft, Phonetik, Phonologie, Artikulation, Lautbildung, Phoneme, Phone, Allophone, Lexikologie, Lexikographie, Wortschatz, Lexem, Wort, Sprache, Kommunikation.
Wie werden Phoneme und Phone unterschieden?
Phoneme sind bedeutungsdifferenzierende Laute, während Phone konkrete Lautrealisierungen darstellen. Allophone sind Varianten desselben Phonems, die keine Bedeutungsunterschiede hervorrufen.
Was ist der Unterschied zwischen Lexikologie und Lexikographie?
Die Lexikologie befasst sich mit der Lehre vom Wortschatz, während die Lexikographie sich mit der Lehre vom Wörterbuch beschäftigt. Der Text unterscheidet zwischen dem abstrakten Wortschatz und dem konkreten Inventar von Wörtern (z.B. in einem Wörterbuch) und definiert die Begriffe Lexem und Wort.
Wie wird die Funktion der Sprache im Text beschrieben?
Der Text beschreibt die Sprache als Werkzeug zur Übermittlung von Ideen und Vorstellungen. Er betont die Verknüpfung sprachlicher Zeichen mit Lautformen und deren lineare Anordnung. Die Bedeutung einer gemeinsamen Sprachbasis für die Verständigung zwischen Sprecher und Hörer wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Sprecher und Hörer in der Kommunikation?
Der Sprecher ordnet seine Ideen und wählt entsprechende sprachliche Zeichen zur Vermittlung. Der Hörer rekonstruiert die Idee des Sprechers anhand der sprachlichen Zeichen und des gemeinsamen sprachlichen Wissens.
Welche Artikulationsorgane werden im Text genannt?
Der Text nennt sowohl die Artikulationsorgane im engeren Sinne (Lippen, Zähne, Zunge etc.) als auch die Organe, die die Atmung steuern (Lunge, Zwerchfell etc.), die essentiell für die Lauterzeugung sind.
Was sind die Voraussetzungen zur Lauterzeugung?
Die Lauterzeugung setzt Atmung und Ausatmung sowie die Schwingung der Stimmlippen im Kehlkopf voraus.
- Citation du texte
- BA Kinga Gmiat (Auteur), 2014, Einführung in die romanische Sprachwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278091