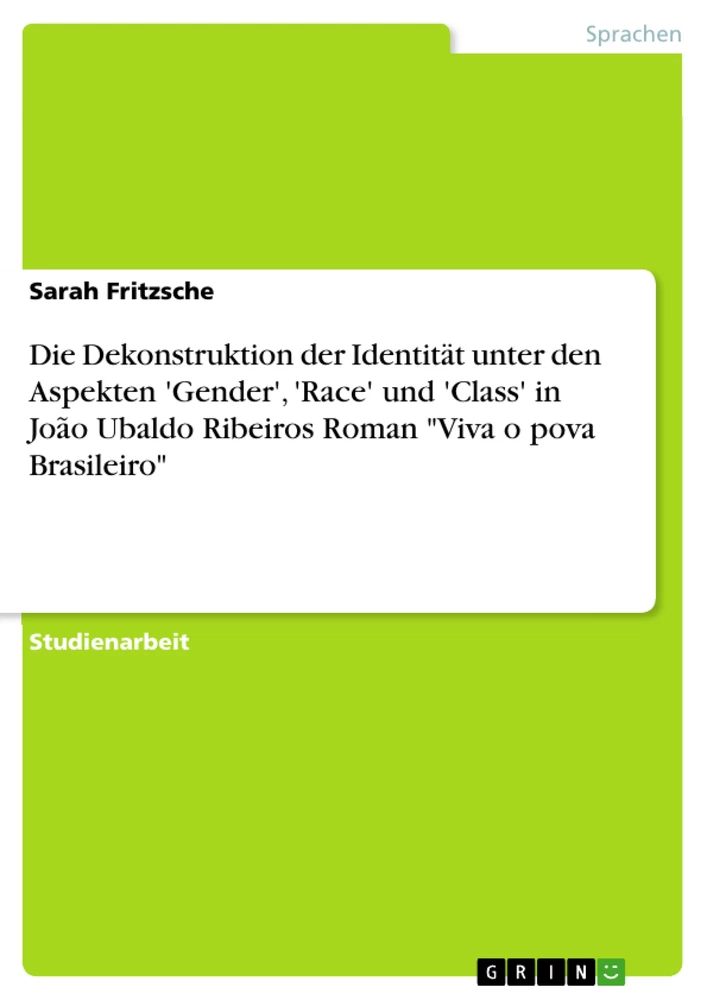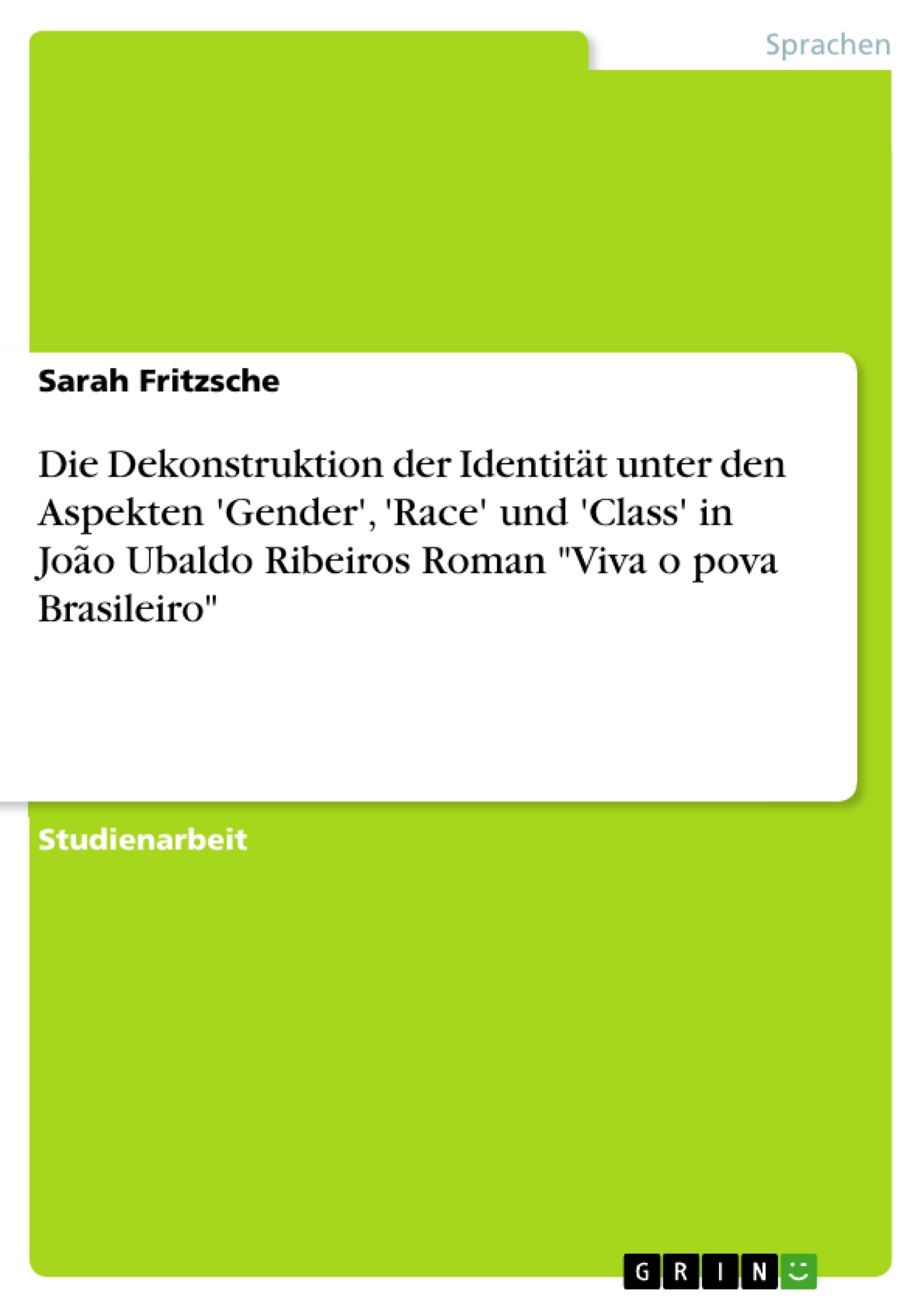Spätestens seit Beginn der Moderne spielen Fragen nach Nationalität, Ethnizität und kultureller Integrität eine große Rolle. Migranten zwischen den Kontinenten verändern v.a. seit Beginn der Kolonialisierung Amerikas im 15. Jahrhundert Gesellschaften. Kulturelle Hybridität und Heterogenität, Synkretismus etc. sind zwar als Folgen dieser Entwicklung unübersehbar und kreieren dennoch Angst, Unsicherheit, Identitätskrisen, Sexismus und Rassismus.
Der Roman Viva o Povo Brasileiro von João Ubaldo Riberiro setzt sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit solchen Phänomenen auseinander und offeriert eine andere Sicht auf die Vergangenheit Brasiliens, die Akteure der nationalen Geschichte und die Identitäten in einem so vielseitigen Land.
Diese Arbeit soll zeigen wie im Roman die Kategorien ʻgenderʼ undʻ raceʼ dekonstruiert werden. Im Zuge einer postmodernen Lektüre sollen traditionelle Vorstellungen von Identität neuen Perspektiven weichen, in denen logozentristische Denkmuster aufgebrochen werden.
Mithilfe feministischer, postkolonialer und poststrukturalistischer Interpretationsansätze soll erläutert werden, wie in dem Werk die Pluralität von Identität fokussiert und den LeserInnen gezeigt wird, wie starre Kategorien entgleiten können.
- Quote paper
- Sarah Fritzsche (Author), 2012, Die Dekonstruktion der Identität unter den Aspekten 'Gender', 'Race' und 'Class' in João Ubaldo Ribeiros Roman "Viva o pova Brasileiro", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278124