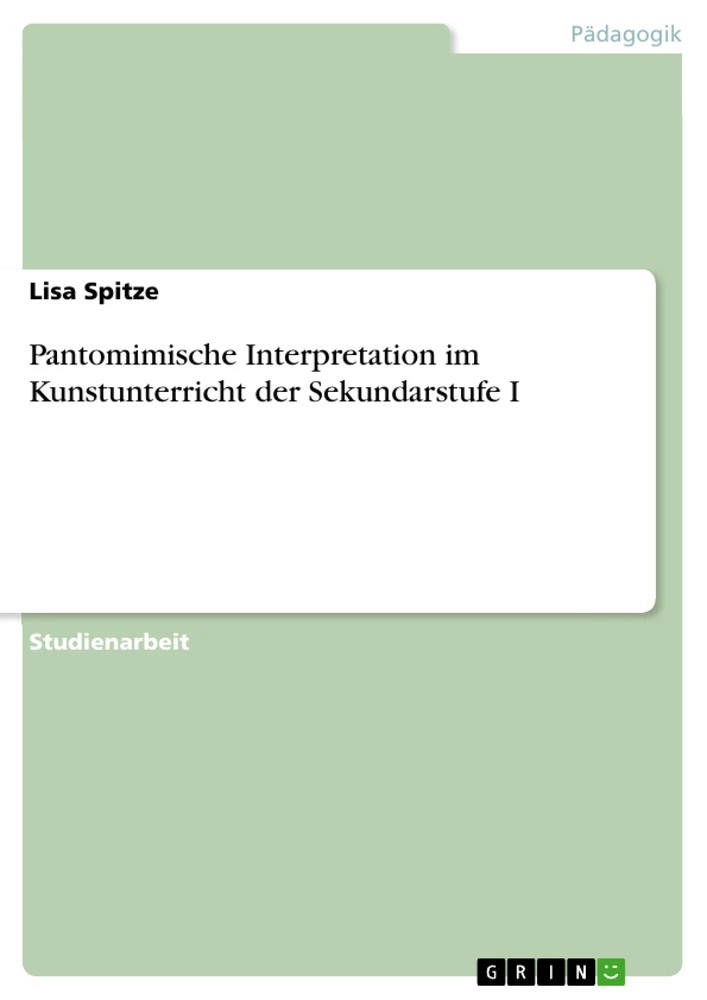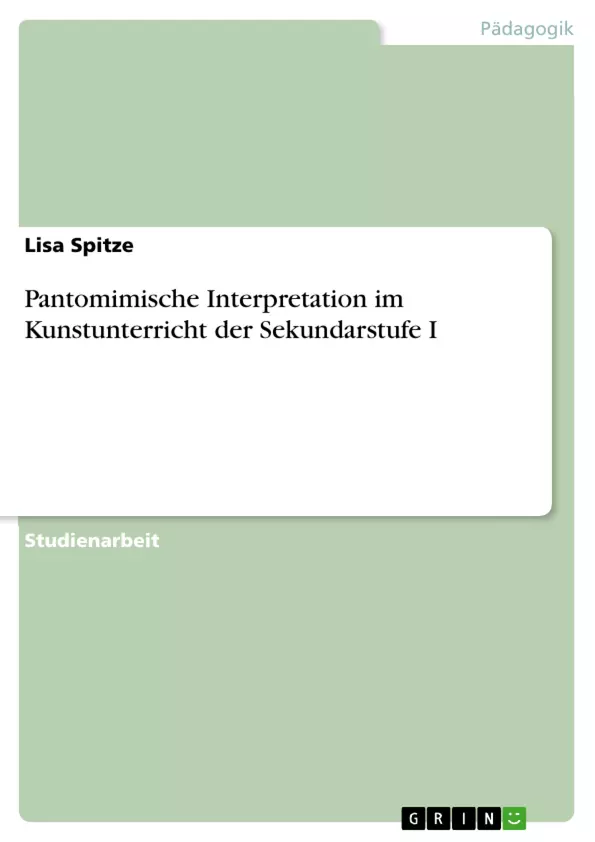Im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts findet das szenische Spiel zumeist Anwendung im Fachbereich Deutsch zugunsten des Textverstehens. Auch der Gebrauch von Pantomime im Fremdsprachenunterricht zum Vorteil einer vorerst körperlich statt sprachlicher Annäherung wird immer häufiger angetroffen. Kramer betont den Vorteil der Pantomime im pädagogischen Theaterspiel, der darin liege, dass besonders Schüler und Schülerinnen mit eingeschränkten verbalen Mitteln neue Ausdrucksmöglichkeiten erhielten. Dieser Aspekt hat im Rahmen eines differenzierten Unterrichts entsprechend der Heterogenität einer Schulklasse besondere Relevanz. Somit können gerade Kinder und Jugendliche mit sprachlichen Schwierigkeiten, insbesondere Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache Lernende, von der Methodik der Pantomime im Schulunterricht profitieren.
Der Einsatz von Pantomime im Kunstunterricht findet allerdings keine Berücksichtigung, trotz der Kongruenz von Bildender Kunst, Ästhetik und Formen des Theaters. Auch dass im Kunstunterricht neben handwerklicher Gestaltung, sprachlicher Ausdruck erforderlich ist, wird zumeist außer Acht gelassen. Dabei bedarf es insbesondere im Rahmen einer künstlerischen Reflexion, im Sinne einer überdenkenden Distanz zum eigenen oder fremden Werk, verbaler Kommunikation.
Aus diesem Grund beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit mit der Anwendung der Pantomime im Kunstunterricht am Beispiel einer Unterrichtsstunde zum Thema der Werkinterpretation in der Sekundarstufe I.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernvoraussetzungen
- Einordnung und Beschreibung der geplanten Stunde im Rahmen der Einheit
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Einbindung der Pantomime in den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Sie untersucht die Möglichkeiten und Vorteile dieser Methode im Kontext der Werkinterpretation und zeigt, wie Pantomime Schüler und Schülerinnen dabei unterstützen kann, Kunstwerke auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu erforschen.
- Einleitung und Motivation für den Einsatz der Pantomime im Kunstunterricht
- Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation und Körperbewusstsein
- Entwicklungspsychologische Aspekte des Lernens und der Identitätsfindung
- Didaktische Analyse der Pantomime im Kontext des Kunstunterrichts
- Praktische Anwendung der Pantomime in einer Unterrichtsstunde zur Werkinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung argumentiert für den Einsatz der Pantomime im Kunstunterricht, da diese Methode sowohl das Textverstehen als auch die Förderung nonverbaler Kommunikation ermöglicht und insbesondere Schülern mit sprachlichen Schwierigkeiten zugutekommt.
- Das Kapitel "Lernvoraussetzungen" beleuchtet die Entwicklungspsychologischen Aspekte der Schüler und Schülerinnen der zehnten Klasse, insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung der Identität und die Bedeutung von Selbstreflexion.
- Das Kapitel "Einordnung und Beschreibung der geplanten Stunde im Rahmen der Einheit" beschreibt die konkrete Unterrichtsstunde, die die Grundlage für die praktische Anwendung der Pantomime bildet.
- Das Kapitel "Sachanalyse" behandelt die interpretatorischen Ebenen eines Kunstwerkes sowie die Pantomime als Unterrichtsgegenstand, um die theoretischen Grundlagen für die didaktische Analyse zu legen.
- Die "Didaktische Analyse" ordnet die Pantomime im Rahmen des Kunstunterrichts curricular ein und zeigt die Relevanz dieser Methode für die Lernenden auf.
- Die "Methodische Analyse" beschreibt die einzelnen Schritte und Maßnahmen der Unterrichtsstunde, um den praktischen Einsatz der Pantomime zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Pantomime, Kunstunterricht, Werkinterpretation, Sekundarstufe I, nonverbale Kommunikation, Körperbewusstsein, Selbstreflexion, Entwicklungspsychologie, didaktische Analyse, methodische Analyse, Unterrichtsentwurf.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Pantomime im Kunstunterricht sinnvoll?
Pantomime ermöglicht eine körperliche Annäherung an Kunstwerke und hilft Schülern, Interpretationen auszudrücken, ohne auf rein verbale Mittel angewiesen zu sein.
Wie hilft Pantomime Schülern mit Sprachschwierigkeiten?
Da die Methode nonverbal ist, bietet sie Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eine alternative Ausdrucksmöglichkeit und fördert so die Teilhabe am Unterricht.
Welche Rolle spielt die Selbstreflexion dabei?
Durch das Nachstellen von Bildinhalten gewinnen Schüler eine überdenkende Distanz zum Werk, was die künstlerische Reflexion und die Identitätsfindung unterstützt.
In welcher Altersstufe wird Pantomime hier eingesetzt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Sekundarstufe I, speziell auf Schüler der zehnten Klasse, bei denen die Ausbildung der Identität ein zentrales Thema ist.
Was ist das Ziel einer pantomimischen Werkinterpretation?
Das Ziel ist ein tieferes Verständnis der emotionalen und kompositorischen Ebenen eines Kunstwerkes durch körperliches Erleben und anschließende verbale Kommunikation.
- Citar trabajo
- Lisa Spitze (Autor), 2014, Pantomimische Interpretation im Kunstunterricht der Sekundarstufe I, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278241