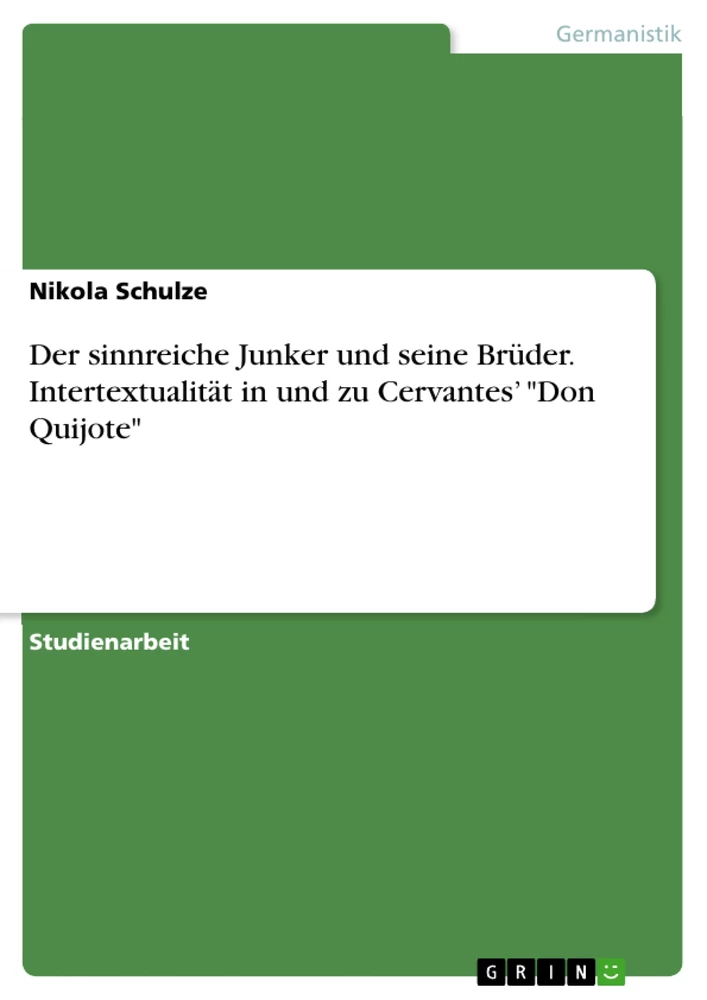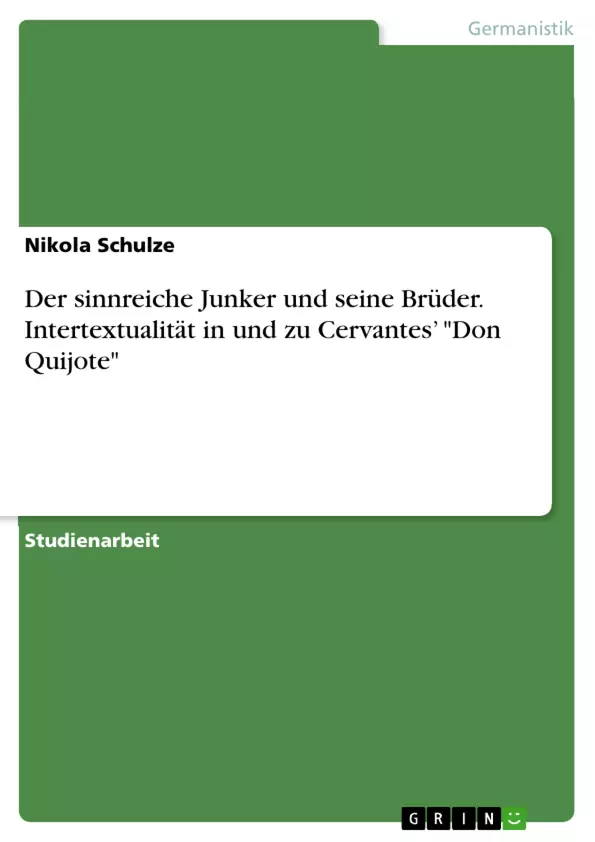Der spanische Roman El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha von Miguel de Cervantes (im Folgenden stets kurz Don Quijote genannt) hat in der Literatur einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er erlebte bis jetzt 2300 Auflagen und 68 Übersetzungen und ist damit nach der Bibel das am häufigsten übersetzte Buch. Die Figur wurde als Synonym für die unterschiedlichsten Typen verstanden und löste eine Flut von Nachahmungen, Parodien und anderen Adaptionen aus.
Aus diesem Grund ist der Roman besonders geeignet, ihn als Beispiel für das Prinzip der Intertextualität anzuführen. Nicht nur, dass er als intertextueller Bezug von zahlreichen Texten heranzuführen ist, er bezieht sich selbst auch in einem großen Maße auf eine bestimmte Gattung: Die Ritterromane.
Die vorliegende Arbeit kann und will nicht den Stand der gesamten Intertextualitätsdebatte wiedergeben, geschweige denn eine neue Theorie entwickeln. Die bekannten Definitionen werden kurz umrissen, um das in dieser Arbeit verwendete Verständnis darin einzubetten.
Vor dem Hintergrund einer relativ eng gesteckten Definition dieses Begriffs soll der Facettenreichtum von Intertextualität anhand einiger weniger Beispiele gezeigt werden, die natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben können. Die Arbeit beschränkt sich auf zwei sehr unterschiedliche Exemplare des englischen Sprachraums, die außerdem aus unterschiedlichen Epochen stammen und erwähne Beispiele aus anderen Ländern und Epochen nur am Rande. Der Don Quijote wurde in England am stärksten rezipiert.
Die Arbeit beschäftigt sich also zum einen mit der Frage, welche Literatur den Quijote-Roman beeinflusst hat und zum andern, wie der Don Quijote die nachfolgende Literatur beeinflusst hat. Dies soll unter anderem verdeutlichen, dass Intertextualität eng verknüpft ist mit der Einflussforschung und der Rezeptionsgeschichte. Sie ist sozusagen ein wichtiger Teil dieser Forschungsrichtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Intertextualität
- Schwierigkeiten der Definition
- Bisherige Definitionen
- Intertextuelle Bezüge Don Quijotes auf die Ritterromane
- Die Ritterromane allgemein
- Der Ritterroman Amadís de Gaula
- Die Rezeptionsgeschichte Don Quijotes an Beispielen
- Henry Fielding: Joseph Andrews (1742)
- Gilbert K. Chesterton: The Return of Don Quixote (1927)
- Sonderfall: Der Bezug auf sich selbst
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Intertextualität und untersucht, wie es sich im Roman „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes manifestiert. Sie analysiert die intertextuellen Bezüge des Romans auf die Ritterromane und untersucht, wie der Don Quijote die nachfolgende Literatur beeinflusst hat. Die Arbeit beleuchtet die Rezeptionsgeschichte des Romans anhand ausgewählter Beispiele und zeigt, wie Intertextualität eng mit der Einflussforschung und der Rezeptionsgeschichte verbunden ist.
- Definition und Bedeutung des Begriffs Intertextualität
- Intertextuelle Bezüge des Don Quijote auf die Ritterromane
- Die Rezeptionsgeschichte des Don Quijote
- Intertextualität als Verbindung von Einflussforschung und Rezeptionsgeschichte
- Der Don Quijote als Beispiel für die Komplexität und Vielschichtigkeit von Intertextualität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Don Quijote als Beispiel für das Prinzip der Intertextualität vor. Sie erläutert die Relevanz des Romans für die Intertextualitätsforschung und die Bedeutung der Rezeptionsgeschichte. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Begriff der Intertextualität. Er beleuchtet die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition zu finden, und stellt verschiedene Ansätze von Theoretikern wie Michail Bachtin, Julia Kristeva und Roland Barthes vor. Der dritte Abschnitt untersucht die intertextuellen Bezüge des Don Quijote auf die Ritterromane. Er beleuchtet die Ritterromane allgemein und analysiert den Einfluss des Romans „Amadís de Gaula“ auf Cervantes' Werk. Der vierte Abschnitt widmet sich der Rezeptionsgeschichte des Don Quijote anhand ausgewählter Beispiele. Er analysiert die Werke „Joseph Andrews“ von Henry Fielding und „The Return of Don Quixote“ von Gilbert K. Chesterton und zeigt, wie der Don Quijote die nachfolgende Literatur beeinflusst hat. Der Abschnitt beleuchtet auch den Sonderfall des Bezugs des Don Quijote auf sich selbst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff Intertextualität, den Roman „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes, die Ritterromane, die Rezeptionsgeschichte, die Einflussforschung, die Dialogizität von Texten und die Rezeption des Don Quijote in der englischen Literatur. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Romans für die Intertextualitätsforschung und zeigt, wie der Don Quijote als Beispiel für die Komplexität und Vielschichtigkeit von Intertextualität dient.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit über „Don Quijote“ und Intertextualität?
Die Arbeit untersucht, wie sich Intertextualität im Roman von Cervantes manifestiert, welche Ritterromane ihn beeinflussten und wie das Werk seinerseits die nachfolgende Literatur prägte.
Welche Rolle spielen Ritterromane für den „Don Quijote“?
Der Roman bezieht sich massiv auf die Gattung der Ritterromane, insbesondere auf „Amadís de Gaula“, um diese zu parodieren oder nachzuahmen.
Welche Autoren der englischen Literatur werden als Beispiele für die Rezeption genannt?
Die Arbeit analysiert Henry Fieldings „Joseph Andrews“ (1742) und Gilbert K. Chestertons „The Return of Don Quixote“ (1927).
Wie wird Intertextualität in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit nutzt eine relativ eng gesteckte Definition und bezieht sich auf Theoretiker wie Michail Bachtin, Julia Kristeva und Roland Barthes.
Was ist der „Sonderfall“ der Intertextualität im Don Quijote?
Ein besonderer Aspekt der Untersuchung ist der intertextuelle Bezug des Romans auf sich selbst.
Warum gilt „Don Quijote“ als ideales Beispiel für Intertextualität?
Aufgrund seiner 2300 Auflagen und der Flut an Nachahmungen und Adaptionen zeigt der Roman wie kaum ein zweites Werk die Vielschichtigkeit literarischer Bezüge.
- Quote paper
- Nikola Schulze (Author), 2006, Der sinnreiche Junker und seine Brüder. Intertextualität in und zu Cervantes’ "Don Quijote", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278262